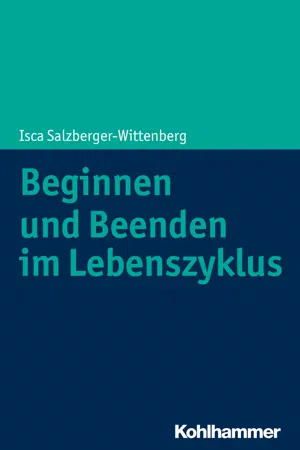
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Beginnen und Beenden im Lebenszyklus
- 167 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Beginnen und Beenden im Lebenszyklus
Über dieses Buch
Im Laufe des Lebens müssen wir mit großen und kleinen Veränderungen unserer Lebensumstände umgehen: Mit Beginn und Ende von Beziehungen, Verlusten und Gewinnen. Solche Veränderungen verursachen häufig starke emotionale Umwälzungen. Wie wir damit umgehen, hängt davon ab, ob sie zu physischem, mentalem, emotionalem, spirituellem Wachstum führen oder das Gegenteil bewirken: Stillstand der Entwicklung, Hoffnungslosigkeit, Depression, Verzweiflung oder zu mentalem Zusammenbruch. In diesem Buch wird untersucht, wie verschiedene Personen mit den Enden und Anfängen im Lebenszyklus, vom Säuglingsalter bis zum hohen Lebensalter umgehen und was ihnen hilft bzw. es ihnen erschwert, aus diesen Erfahrungen zu lernen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Beginnen und Beenden im Lebenszyklus von Isca Salzberger-Wittenberg, Gertraud Diem-Wille im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychology & Psychoanalysis. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Lernen aus Erfahrung beim Beenden und Beginnen
Seit vielen Jahren beeindruckt mich die Intensität und Tiefe der Gefühle, die beim Beginnen und Beenden lebendig werden. Eine Phase des Lebens abzuschließen und eine neue anzufangen, ein Studium aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen, Mitglied einer Organisation zu werden oder diese zu verlassen, eine neue Beziehung einzugehen oder eine frühere zu beenden – das Leben ist voller Anfänge und Abschlüsse, die uns mit der Notwendigkeit zur Veränderung konfrontieren. Dieses Buch stellt, ausgehend von meinen beruflichen und persönlichen Erfahrungen, die emotionalen Erschütterungen dar, die durch solche Veränderungen hervorgerufen werden, sowie die Art und Weise, wie verschiedene Personen und Gruppen sie zu bewältigen versuchen.
Wir neigen dazu, das Beenden mit Angst und einem Gefühl der Bedrohung zu assoziieren. Aber das ist nicht immer so: Eine unglückliche, einengende Ehe zu beenden, kann zum Beispiel eine Erlösung sein. Ein Mensch, der dauernd unter starken Schmerzen leidet und zunehmend in seiner Bewegung eingeschränkt ist, kann sich danach sehnen zu sterben. Ein Land zu verlassen, in dem man verfolgt wird, mag lebensrettend sein. Anfänge werden hingegen eher mit Hoffnung und Aufregung in Verbindung gebracht. Aber auch das muss nicht immer so sein. Man kann sich z. B. davor fürchten, eine Fortbildung machen zu müssen, um auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar zu sein. Auch wenn man sich über einen beruflichen Aufstieg freut, kann die damit verbundene Verantwortung durchaus Angst machen.
Beenden und Beginnen sind auf das Engste miteinander verknüpft. Jedes Beenden erfordert von uns, den damit einhergehenden Verlust zu bewältigen und von Neuem zu beginnen. Ein neuer Anfang bedeutet meist auch, einen Aspekt unseres Lebens und/oder eine frühere Sichtweise aufgeben zu müssen. Heiraten, ein Baby bekommen, ein neues Haus erwerben, ein Studium beginnen oder eine neue Stelle antreten, ein neues Abenteuer wagen – all diese Ereignisse versprechen uns ein reicheres, glücklicheres, erfüllteres Leben. Die Hoffnung, die wir in diese neuen Erfahrungen setzen, weckt unsere Vorfreude und veranlasst uns, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Und doch sagen wir oft, »Aller Anfang ist schwer«, und meinen damit, dass es auch schwierig und beängstigend sein kann, etwas Neues zu beginnen. Wir fragen uns, ob wir den Erwartungen entsprechen werden, und sind unsicher, ob wir die physische, geistige und emotionale Kraft haben, mit der neuen Situation fertig zu werden. Auch wenn wir uns wünschen, dem zu entkommen, was wir als unbefriedigend, einengend, frustrierend und uninteressant empfinden, und stattdessen unsere Erfahrungen erweitern, lernen, ausprobieren, etwas schaffen und uns auf etwas Neues einlassen wollen, bleibt dennoch die Unsicherheit, ob die neuen Erfahrungen unseren Erwartungen entsprechen werden.
Wird das ersehnte Baby Behinderungen haben, wird es schön sein, wird es unser Leben bereichern oder uns die Freiheit nehmen, die wir zurzeit genießen? Wird das neue Haus auf einem soliden Fundament errichtet werden? Wird der neue Job, das neue Studium enttäuschend und langweilig sein? Wird der neue Partner liebevoll und liebenswert sein, oder wird das Zusammenleben mit ihm schwierig werden? Werden wir zusammen glücklicher sein, oder wäre es besser, Single und unabhängig zu bleiben?
Bevor wir uns auf etwas Neues einlassen, wägen wir ab, ob es das Risiko wert ist, uns dem Unbekannten zu stellen. Trotz aller Einschränkungen und Enttäuschungen unseres gegenwärtigen Lebens kann es uns leichter und sicherer erscheinen, an der vertrauten Routine und den Gewohnheiten des individuellen oder institutionellen Lebens festzuhalten. Nicht umsonst heißt es: »Von zwei Übeln wählt man besser das, das man schon kennt.« Egal, wie unbequem und unbefriedigend unser gegenwärtiger Zustand ist, er ist zumindest vertraut, während das Unbekannte die Möglichkeit der Gefahr in sich birgt, die uns ängstlich und manchmal sogar panisch macht. Bis jetzt haben wir es irgendwie geschafft, aber wie wird es uns gehen, wenn wir uns neuen Erfahrungen, neuen Herausforderungen, neuem Wissen gegenüber öffnen? Jede Veränderung ist bedrohlich und es erfordert Glauben, Hoffnung und Mut, sich auf neue Erfahrungen einzulassen.
Bei einem Neubeginn müssen wir meist nicht nur etwas Vertrautes aufgeben, sondern auch auf etwas verzichten, das wir schätzen oder das uns Vorteile gebracht hat. Aber haben wir überhaupt eine Wahl? Nur bis zu einem gewissen Grad, denn im Lauf unseres Lebens gibt es unausweichliche Situationen des Beginnens und Beendens: das Ende der relativ sicheren Existenz im Mutterleib und den Beginn des Lebens in der Außenwelt; den Übergang von der Babyzeit zur Kindheit, bei dem die Vorteile, ein Baby zu sein, zum Teil aufgegeben werden müssen. Wenn wir später die Adoleszenz und das frühe Erwachsenenalter erreichen, müssen wir einige Privilegien der Kindheit aufgeben und jene Verantwortung übernehmen, die mit dem Erwachsensein verbunden ist. Eine Partnerbeziehung erfordert viele Anpassungen, und ein Kind zu bekommen, bedeutet eine massive Veränderung im Leben. In der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern sind ständige Veränderungen erforderlich, vor allem ein schrittweises Loslassen, wenn die Kinder älter werden, später das Haus verlassen, heiraten und eigene Kinder bekommen. Auch wenn wir uns auf die Vorteile freuen, die wir durch jede neue Entwicklungsstufe zu erlangen hoffen, werden wir vielleicht auf so manchen guten Aspekt der vorhergehenden Phase verzichten müssen. Diese Verluste können uns mitunter ängstlich und ärgerlich machen, wenn wir und auch andere meinen, dass wir eigentlich glücklich sein sollten. Der Groll über das, was wir aufgeben müssen, kann die Freude über das, was der neue Schritt zu bieten hat, ernsthaft trüben.
Es gibt aber auch Ereignisse im Leben, die hauptsächlich durch Verlusterfahrungen gekennzeichnet sind: die Trennung von Menschen, die wir lieben oder auf die wir uns verlassen; eine Krankheit, die unsere physische und/oder geistige Kraft einschränkt; der Verlust der Arbeit, das Altern, Trauerfälle und die Begrenztheit unseres Lebens. All diese Abschiede erzeugen so große Ängste, dass selten darüber gesprochen oder auch nur nachgedacht wird. Aber die Fähigkeit, sich diese Verlusterlebnisse bewusst zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, erlaubt uns – bis zu einem gewissen Grad – uns darauf mental und emotional vorzubereiten. Wenn wir das vermeiden, werden wir noch anfälliger, von Panik überwältigt zu werden, wenn das Befürchtete tatsächlich eintritt. Wir schämen uns dann vielleicht für das emotionale Durcheinander, in dem wir uns befinden, gestehen es uns selbst nur schwer ein und würden am liebsten davor davonlaufen. Oder wir sind vielleicht von unserer schmerzlichen, verwirrenden emotionalen Befindlichkeit überwältigt, fürchten aber, dass niemand unsere Ängste, unseren Ärger, unsere Trauer, Depression und Verzweiflung ertragen kann. All das lässt uns zögern, uns mitzuteilen und unsere Gefühle jemandem anzuvertrauen. Vielleicht ist auch tatsächlich kein Partner, kein Freund, kein Kollege gewillt, uns zuzuhören, da viele Menschen Angst haben, von dem emotionalen Schmerz eines anderen »angesteckt« zu werden. Viel Leid bleibt dann unbemerkt, und die Betroffenen müssen mit ihrem Schmerz allein zurechtkommen, was die Last umso schwerer macht. Wir sind leicht versucht, vor dem Schmerz des Verlusts davonzulaufen. Aber nur, wenn es uns gelingt, über das Verlorene zu trauern, können wir das Wertvolle der Vergangenheit innerlich lebendig halten. Wir sind sonst auch nicht in der Lage, auf Vergangenem aufzubauen und uns an den Erfahrungen zu erfreuen, die in der neuen Situation möglich sind.
Wir unterschätzen oft, wie sehr uns ganz gewöhnliche Anfangs- und Beendigungssituationen emotional aufwühlen können. Da ich im nächsten Kapitel viel über die emotionalen Reaktionen auf einen Neubeginn sagen werde, möchte ich an dieser Stelle genauer auf eine Erfahrung des Beendens eingehen, die mir ein eigentlich ganz gewöhnlicher Abschied nach einem kurzen Besuch in Australien vor 40 Jahren vor Augen geführt hat. Man hatte mich zu einem zweiwöchigen Aufenthalt in Brisbane eingeladen, wo ich Seminare für Psychiater, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Priester und praktizierende Ärzte leiten sollte. Ich forderte die Teilnehmer auf, in der ersten Woche Fallbeispiele von Patienten mitzubringen, mit denen sie gerade zu arbeiten begonnen hatten. In der zweiten Woche sollten Erfahrungen beim Beenden ihrer Arbeit mit den Patienten und Trennungen von den Klienten/Patienten im Mittelpunkt stehen.
Die meisten Teilnehmer zeigten großes Interesse und arbeiteten intensiv mit. Sie hatten sichtlich den Wunsch, diese Lernchance so gut wie möglich zu nützen. Von Zeit zu Zeit machte ich sie darauf aufmerksam, dass sie ähnliche emotionale Erfahrungen, wie sie ihre Patienten beim Beginnen und Beenden machten, auch hier im Seminar spüren würden, sowohl zu Beginn unserer Beziehung, aber auch, als wir uns dem Ende der Konferenz näherten. Ich teilte die Meinung der Gruppe, dass die Konferenz gut gelaufen war und sie viel gelernt hatten. Als ich jedoch am letzten Tag ins Plenum kam, war ich von der völlig veränderten Atmosphäre, die im Raum herrschte, total überrascht. Die Teilnehmer waren schweigsam, ihre Körperhaltung zeigte, dass sie sich ganz in sich zurückgezogen hatten. Manche sahen zornig aus, andere total unglücklich, und einige hatten einen leeren Gesichtsausdruck. Sie erinnerten mich an Kinder, die zu lange allein gelassen worden und deshalb so zornig waren, dass sie ihren Ärger nur nach außen projizieren konnten – unfähig, ihre Gefühle mit Worten auszudrücken. Schließlich sagte eine Teilnehmerin: »Nächstes Mal wollen wir lieber ein Buch bekommen, nicht eine Person, die uns nach zwei Wochen wieder verlässt«. Ich sprach daraufhin über ihre Enttäuschung und ihren Ärger darüber, dass sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende zuneigte. Meine Äußerung brachte jedoch keine Veränderung oder Verminderung der Feindseligkeit und Niedergeschlagenheit, die die Teilnehmer ganz offensichtlich empfanden. Der riesige Blumenstrauß, der mir am Ende überreicht wurde, kam mir mehr wie ein Kranz für mein Begräbnis als wie ein Zeichen der Anerkennung vor. Ich war zutiefst bestürzt und fühlte mich schuldig und verzweifelt, die Gruppe in so einem Zustand zurücklassen zu müssen. Ich fürchtete, der Ärger über meinen Abschied könnte die Teilnehmer der Gruppe dazu veranlassen, innerlich die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet hatten, zu zerstören. Damit wäre alles, was wir gemeinsam gelernt hatten, verloren, und ihre und meine Anstrengungen wären vergeblich gewesen. Ich fürchtete sogar, den Teilnehmern könnte es nun schlechter gehen als vor meinem Besuch.
Die Berichte, die ich anschließend von den Veranstaltern der Konferenz erhielt, schienen meine Befürchtungen zu bestätigen. Es gab viele Konflikte zwischen den verschiedenen Berufsgruppen und Anfeindungen dem Psychiater gegenüber, der mich eingeladen hatte. Ich machte mir Vorwürfe, den Prozess des Beendens nicht genug bearbeitet und die Teilnehmer genauso wie mich selbst nicht ausreichend auf den Abschied vorbereitet zu haben. Anhand meiner klinischen Erfahrungen und meiner eigenen Verlustgefühle beim Beenden von selbst kurzen beruflichen Tätigkeiten hätte ich wissen müssen, wie schmerzlich es ist, Abschied zu nehmen, und ganz besonders wenn das Zusammensein emotional intensiv und wertvoll war. Ich hätte wissen müssen, wie wichtig es ist, Zeit und Raum zum Nachdenken und gemeinsamen Bewältigen der Frustration zur Verfügung zu stellen, um über den Ärger, die Verzweiflung und die Einsamkeit sprechen zu können, die durch das Beenden hervorgerufen werden. Zweifellos verschärften die besonders großen Erwartungen an mich als Referentin aus Übersee – damals waren solche Besuche äußerst selten – diese Erfahrung des Verlassenwerdens noch zusätzlich.
Diese Erfahrung veranlasste mich zu dem Entschluss, in Zukunft in jedem von mir geleiteten Kurs der Bedeutung des Beendens mehr Raum und Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem nahm ich mir vor, den Prozess des Beginnens und Beendens auch in Organisationen zu untersuchen, und besonders an meinem eigenen Arbeitsplatz, der Tavistock Clinic in London. Glücklicherweise erhielt ich die Möglichkeit, im Rahmen des Einführungswochenendes an der Tavistock Clinic erstmals Selbsterfahrungsgruppen durchzuführen, bei denen den Neuankommenden Gelegenheit gegeben wird, ihre Gefühle am Anfang ihrer Ausbildung bei uns zu reflektieren. Die Neuankommenden aus Übersee fanden den Anfang in England natürlich besonders schwer. Später bot ich auch ein wöchentliches »Seminar zum Beenden« an, in dem wir den Abschluss von Therapien/Analysen mit Patienten diskutierten, die die Studenten behandelten. Wir sahen uns an, wie sich die verschiedenen Patienten beim Abschluss der Therapie fühlten und besprachen auch die Gefühle, die bei den jeweiligen Therapeuten wachgerufen wurden, besonders wenn die Behandlung verfrüht abgebrochen wurde. Es wurde rasch klar, dass jene Studenten, die dabei waren, ihre Ausbildung abzuschließen und deshalb auch die Tavistock Clinic verließen, es sehr schwer fanden, sich der doppelten Aufgabe des Beendens zu stellen: den Ärger ihrer Patienten über ihr Verlassenwerden zu erkennen und gleichzeitig über ihren Abschied von uns nachzudenken. Eine Studentin formulierte es folgendermaßen: »Ich wünschte, ich könnte meinen Patienten sagen: ›Mach mir nicht den Vorwurf, dass ich dich verlasse, mach lieber der Tavistock den Vorwurf, dass sie mich loswerden will.‹«
Schließlich gestattete mir das Lehrinstitut einen Abschiedsworkshop einzuführen, in dem Studierende und Lehrende, deren Arbeit an der Tavistock Clinic zu Ende ging, gemeinsam über ihre Gedanken und Gefühle beim Abschiednehmen sprechen konnten, über den Verlust ihrer Peer-Gruppe, ihrer Lehrer und der Organisation genauso wie über ihre Freude, ihre Ausbildung abgeschlossen zu haben und nun woanders als Therapeuten arbeiten zu können. Lange Zeit konnte ich unter den Lehrenden nur eine Kollegin finden, die erfahrene Psychologin Elsie Osborne, die bereit war, mich bei diesem Unternehmen zu begleiten. Sogar noch viele Jahre nach meiner Pensionierung wünschten sich die Studierenden einen Abschlussworkshop, und der Vorsitzende der Klinik fragte mich, ob ich bereit sei, den Workshop zu leiten. Natürlich sagte ich gerne zu. Nach einigen Jahren zeigten andere Mitglieder des Lehrpersonals Interesse, ihn weiterzuführen, und so wurde der jährliche Abschiedsworkshop Teil des offiziellen Lehrangebots der Tavistock Clinic.
Ich war erleichtert, sogar begeistert, als ich zwei Jahre nach meinem ersten Workshop in Brisbane eine zweite Chance bekam und eingeladen wurde, einen Workshop mit derselben Gruppe zu leiten. Diesmal wollte ich die Konferenz anders strukturieren. Mir war klar geworden, dass es ein Fehler gewesen war, alle Einheiten selbst zu leiten. Diesmal bat ich erfahrene australische Psychiater aus der Teilnehmergruppe, die Work-Discussion-Gruppen (mit jeweils 10 Teilnehmern) zu leiten. Ich sagte, ich würde die Plenarsitzungen mit allen 50 Teilnehmern leiten. Im Eröffnungsplenum wurde ich gefragt, wie ich mich am Ende des ersten Workshops gefühlt hatte, und ich fand es sinnvoll, eine ehrliche Antwort zu geben. Eine Psychiaterin war mutig genug zu sagen, dass sie beim Abschied mir gegenüber keine feindseligen Gefühle gehabt habe, aber jetzt, bei meiner Rückkehr in so einen Zustand äußerster Wut geraten war, dass sie kaum den Tagungsraum betreten konnte. Andere sprachen davon, wie schrecklich der Abschluss der letzten Konferenz gewesen war. Es war sehr hilfreich, gleich am Anfang über diese negativen Gefühle offen reden zu können. Ich sprach darüber, wie schwer es für einige Teilnehmer nun sein mochte, sich noch einmal auf eine tiefe emotionale Mitarbeit einzulassen, wissend, dass wir uns in zwei Wochen wieder trennen müssten. Ich sagte, ich hielte es für möglich, dass uns das Ende nicht so einen Schock wie beim letzten Mal bereiten würde, wenn wir in der Lage wären, es im Auge zu behalten und uns über unsere Gefühle darüber auszutauschen.
Wir hatten tägliche Besprechungen mit den Gruppenleitern, und zwar eine am Morgen und eine am Ende des Tages. Jeden Abend las ich die Berichte darüber, was in den Work-Discussion-Gruppen besprochen worden war. Zuerst handelten die Fälle, die von den Gruppenmitgliedern vorgestellt wurden, von Müttern, die ihre Kinder vernachlässigten oder ihre Familien verließen, von grausamen Müttern und von misshandelten Kindern, die in Pflegefamilien kamen. Es war sehr deutlich, dass die Falldarstellungen die Empfindungen der Teilnehmer mir gegenüber widerspiegelten, ich war die grausame Mutter des Workshops. Ich schrieb die Hauptthemen, die in den Work-Discussion-Gruppen diskutiert worden waren, an die Tafel, sodass alle Teilnehmer sie sehen konnten, wenn sie zur Plenarsitzung kamen. Bevor wir über die klinische Arbeit und über hilfreiche theoretische Konzepte sprachen, war von Anfang an die Beziehung der Mitglieder zu mir, der grausamen Mutter, die sie beim letzten Mal verlassen hatte und sie in zwei Wochen wieder verlassen würde, Gegenstand der Auseinandersetzung im Plenum. Bald wurden andere Themen, die sich in den Work-Discussion-Gruppen oder im Verlauf der Konferenz ergeben hatten, besprochen und genau analysiert. So verstanden wir, wie unser eigenes emotionales Lernen aus Erfahrung uns helfen konnte zu erkennen, was unsere Patienten erlebten. Diesmal wurde das Ende sorgfältig besprochen und durchgearbeitet. (Eine genauere Beschreibung dieser Arbeit ist zu finden in Salzberger-Wittenberg, 1978).
Obwohl wir alle das Ende als schmerzlich erlebten – sogar in einer gewissen Weise noch stärker als beim letzten Mal – war es wesentlich weniger verletzend. Nachdem wir uns mit der Frustration und dem Ärger intensiv auseinandergesetzt hatten, konnten wir zu den Gefühlen der Trauer und Dankbarkeit für die tiefe gemeinsame emotionale Erfahrung vordringen, die eine Teilnehmerin in einem sehr berührenden Gedicht ausdrückte. Wir alle hatten von der gemeinsamen Arbeit viel gelernt (natürlich besprach ich mit der Gruppe auch, wieviel ich von diesem und dem vergangenen Workshop selbst mitgenommen hatte). Unser Lernen hatte uns alle bereichert und konnte in uns weiter wirken, um in unseren Herzen und Gedanken eine Basis für eine weitere Bereicherung zu bilden. Die Gruppe kam einen Monat nach meiner Abreise zu einer Nachbesprechung zusammen, und bei diesem Treffen gründete sie die Psychotherapeutische Vereinigung Brisbane. Ich fühlte mich ermutigt, noch mehr als bisher mit Gruppen im Hier und Jetzt zu arbeiten, sowohl mit Studentengruppen als auch mit Selbsterfahrungsgruppen für Psychologen im pädagogischen Bereich, die an der Tavistock Clinic ihre Ausbildung machten.
Es mag merkwürdig erscheinen – ich jedenfalls empfand es so –, dass mir erst viele Jahre später allmählich klar wurde, worauf mein Interesse, meine Sensibilisierung für das Beenden und Beginnen vermutlich zurückzuführen waren: auf meine eigene, dramatische Erfahrung, Deutschland, wo ich geboren wurde und meine Kindheit und das frühe Erwachsenenalter verbrachte, verlassen und ein neues Leben in England beginnen zu müssen. Ich war neun Jahre alt, als Hitler an die Macht kam. Juden in angesehenen Berufen verloren ihre Stellung, Bücher von jüdischen Autoren wurden vernichtet. Die Verfolgung der Juden nahm von Jahr zu Jahr zu. Jüdische Kinder wurden von öffentlichen Schulen ausgeschlossen. Glücklicherweise gab es zwei ausgezeichnete jüdische Schulen in meiner Heimatstadt Frankfurt, aber wir wurden auf dem Schulweg regelmäßig von Schülern der öffentlichen Schule abgefangen und angespuckt. Ich verstand, dass ich den Mund halten musste und nichts zu den abwertenden Bildern und Slogans über Juden sagen durfte, die auf den Straßen plakatiert waren, da man mich sonst verhaften würde. Meine beste Freundin war Hannelore, ein christliches Mädchen, das in der Wohnung über uns wohnte. Ihre Eltern mussten später ausziehen, da es verboten war, dass Juden und Nichtjuden im selben Haus wohnten. Ich habe nie wieder etwas von Hannelore gehört. Viele jüdische Familien emigrierten in den 1930er Jahren, aber viele blieben, da sie nicht glauben konnten, dass ein Mann wie Hitler in einem so zivilisierten und hochkultivierten Land bestehen könnte. Später mussten viele bleiben, weil sie kein Visum für ein anderes Land bekommen konnten oder sich nicht von älteren oder hilfsbedürftigen Verwandten trennen wollten.
Immer mehr Verbote und Angriffe auf Juden folgten. Ich konnte nicht verstehen, warum so viele Erwachsene immer noch hofften, dass sich die Dinge zum Besseren wenden würden. Obwohl sich mein Vater unserer gefährdeten Situation bewusst war, wollte er als Rabbiner einer großen Gemeinde dennoch bleiben, um sich um seine notleidenden und verzweifelten Gemeindemitglieder zu kümmern. Er erklärte: »Der Kapitän verlässt als Letzter das sinkende Schiff.« Und dann, in der Nacht des 9. November 1938, später als Kristallnacht bezeichnet, brach plötzlich die Hölle los und alle jüdischen Geschäfte und Warenhäuser sowie andere jüdische Besitztümer wurden zerstört, auch das hauptsächlich aus Glas gebaute Jugendzentrum, das sich neben unserem Haus befand. Mein Vater wurde früh am Morgen gerufen und wurde Zeuge des Brandes seiner und einer anderen Synagoge, in der er ebenfalls Gottesdienste abgehalten hatte. Danach wurde in unserer Stadt und in ganz Deutschland Jagd auf alle jüdischen Männer gemacht. Sie wurden in Konzentrationslager verschleppt, wie auch mein Vater einige Wochen später. Viele starben bald, sie wurden entweder ers...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Geleitwort zur deutschen Ausgabe
- Geleitwort zur englischen Ausgabe
- Inhalt
- Danksagung
- 1 Lernen aus Erfahrung beim Beenden und Beginnen
- 2 Vom Leben in der Mutter zum Leben in der Außenwelt
- 3 Getrenntsein und neue Verbindungen suchen
- 4 Das Abstillen – Entwöhnen von der Brust
- 5 Ein Kind in der Familie werden
- 6 Im Kindergarten
- 7 Beginnen und Beenden in der Schule
- 8 Hochschulausbildung und Eintritt ins Berufsleben
- 9 Heiraten
- 10 Eltern werden
- 11 Trauerfälle
- 12 Pensionierung
- 13 Alt werden und dem Tod begegnen
- Literatur
- Register