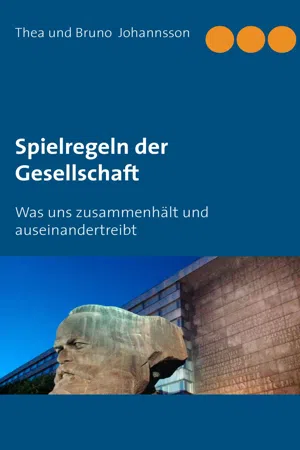![]()
Ist Eigentum Diebstahl?
Bruno (B): Heute ist Donnerstag der 18.11.2004. Wir beginnen mit einem neuen Thema. Thea (T) stellt die These. Sie lautet wie folgt:
Mit seinem Satz „Eigentum ist Diebstahl“ hatte Marx gar nicht so Unrecht.1 Zumindest lässt sich Eigentum an Naturgegebenem moralisch nicht begründen. Historisch baut jede Eigentumsverteilung auf dem Ergebnis von Kriegen auf, die man sehr oft auch als Raubzüge charakterisieren kann.
B: Wir wollen mit der Fragephase beginnen, bei der es mir darum geht, die These noch etwas besser zu verstehen. Meine erste Frage lautet: Was verstehst du unter Eigentum? Insbesondere: Geht es hier um Eigentum in jeder Form oder nur um Eigentum an Produktionsmitteln?
T: Ich habe besonders hervorgehoben das Eigentum an naturgegebenen Dingen. Nicht alle Produktionsmittel gehören dazu. Andererseits kann man nichts produzieren, ohne nicht irgendwann einmal auf Naturgrundlagen zurückgreifen zu müssen.
B: Um das mit Begriffen aus der Volkswirtschaftslehre zu bringen: Diese unterscheidet die Produktionsfaktoren Boden - dafür kann man auch sagen Natur und Umwelt - Arbeit und Kapital. Sie fasst dann die ersten beiden Faktoren Boden und Arbeit zusammen zu den so genannten ursprünglichen oder originären Produktionsfaktoren und bezeichnet Kapital als abgeleiteten Produktionsfaktor. Ich nehme an, gegen diese Einteilung hätte auch Marx nichts einzuwenden gehabt. Ich weiß nicht, ob er sie selbst verwendet hat.
T: Das mag sein. Es kommt mir nicht darauf an, Marx zu interpretieren. Ich habe den Begriff „naturgegeben“ verwendet, um dem Missverständnis zu entgehen, dass Boden etwa nur ein Areal sei. Ich meine damit z.B. auch die Bodenschätze. Alles, was der Mensch nicht selbst gemacht hat, fasse ich unter „naturgegeben“ zusammen.
B: Das läuft darauf hinaus, dass du den Produktionsfaktor Boden in einem weiten Sinne meinst. Vielleicht ist der Begriff Umwelt besser, wenn man die Natur als Teil der Umwelt betrachtet. Das müsste man aber beides eigentlich erst abgrenzen. Auf alle Fälle sind auch in der Volkswirtschaftslehre, wie sie momentan besteht, die Bodenschätze allemal mit drin, ebenso die Luft in ihren verschiedenen Schichten, dann auch die tieferen Bodenschichten, natürlich auch die Meerestiefen. Das alles betrachtet man durchaus als Produktionsfaktor „Boden“.
T: Ich nehme an, dass das erst im Lauf der Geschichte unter dem Begriff „Boden“ subsummiert wurde, mit zunehmendem Problembewusstsein der Menschen.
B: Man kann davon ausgehen, dass sich das erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat, genau genommen sogar erst in den siebziger Jahren, ausgehend von den USA, die in den Umweltfragen zumindest in der Wissenschaft eine gewisse Vorreiterrolle hatten. Möchtest du deine Aussage über Eigentum und Diebstahl auf diesen Produktionsfaktor oder Produktionsbereich beschränken? Dann hätten wir die Produktionsmittel, also das Kapital, nicht dabei. Es wäre eine eigene Aussage. Wie möchtest du das gern handhaben?
T: Ich möchte es auf die natürlichen Ressourcen beschränken. Dadurch, dass sich einzelne Menschen meistens mittels Gewalt das Verteilungsrecht dieser Ressourcen gesichert haben, entstand die Grundlage späterer Eigentumsordnungen. Es kamen noch andere Faktoren dazu, die moralisch vielleicht weniger anfechtbar waren, aber irgendwo hängt jede Eigentumsordnung, die sich etablieren konnte, mit dieser Anfangsverteilung zusammen.
B: Das ist eine Sicht der Geschichte, die ich so weit verstehe, aber nicht im Einzelnen nachvollziehen kann. Dazu müsste ich mich erst etwas näher mit geschichtlichen Abläufen befassen. Aber ich möchte die Frage dahingehend zuspitzen: Habe ich das richtig verstanden, dass du indirekt sagen möchtest, dass an den natürlichen Ressourcen Gemeineigentum praktiziert werden sollte?
T: Ich möchte zunächst noch keine Schlussfolgerung ziehen. Es könnte sein, dass etwas, das an sich zwar ungerecht ist, trotzdem effektiv ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So weit würde ich im Moment noch nicht gehen. Jedenfalls würde ich es schon als ein Ideal betrachten, vorausgesetzt, dass es sich praktisch durchführen lässt. Ich meine das Gemeineigentum an den natürlichen Ressourcen.
B: Das wäre die eine Sache. Du musst dich in dieser Hinsicht auch nicht festlegen, denn deine These geht in der Tat noch nicht so weit. Jedenfalls gehst du, wenn ich das richtig verstehe, von dem Satz „Eigentum ist Diebstahl“ aus und schränkst das etwas ein auf die natürlichen Ressourcen. Die Frage liegt nahe: Wie möchtest du hier „Diebstahl“ begründen, definieren. Du musst irgendeinen Maßstab anlegen, um etwas als Diebstahl zu bezeichnen, was sich in der Geschichte ergeben hat.
T: Ich hab es dann modifiziert. Es ist vielleicht doch eher Raub als Diebstahl. Diebstahl ist das, was heimlich und hinten herum passiert, während Raub ganz offen und mit dem „Recht des Stärkeren“ praktiziert wird. De facto war wohl meistens letzteres der Fall. Es ist zu Kriegen gekommen, schon seit Urzeiten, und es ist sehr auffallend, dass auch ganz offen und unverbrämt Kämpfe um das Land mit besseren Lebensbedingungen geführt wurden. Es waren Kämpfe um neuen Lebensraum, meinetwegen von Steppenbewohnern, die in Trockenzeiten in ihrem angestammten Lebensraum gar nicht überleben konnten. Und wie hat man diesen Lebensraum bekommen? Dadurch dass man denen, die vorher dort saßen, etwas weggenommen, sie vertrieben, sie unterjocht und verpflichtet hat, Tribute zu leisten dafür, dass sie auf ihrem eigenen Land weiter sitzen und arbeiten konnten. Ich glaube, das lässt sich sehr gut nachweisen, dass das mindestens seit Ende der Jungsteinzeit ständig der Fall war. Die Frage ist, ob man sagt: „Damals haben es die Leute so empfunden. Sie haben gesagt: "Wir haben unser Leben eingesetzt. Wir haben gesiegt. Also sind wir im Recht.“ Das ist das Recht des Stärkeren. Heute, wo wir das Faustrecht und das Recht des Stärkeren eigentlich nicht mehr als Recht anerkennen, hängt unsere ganze Eigentumsordnung noch mit dem zusammen, was sich zu den damaligen Zeiten als Besitz und Eigentum herauskristallisiert hat. Irgendwann kamen dann Rechtsgrundsätze ins Spiel, aber die sind immer vom Status quo ausgegangen, der schon auf diesen Raubzügen aufgebaut war.
B: Angenommen man käme zu dem Schluss, die gegenwärtige Eigentumsordnung beruhe auf Raubzügen, dann wäre es trotzdem nicht einfach, das alles wieder rückgängig zu machen.
T: Es ist erstens nicht einfach und zweitens evtl. sachlich nicht möglich. Und außerdem könnten die Völker aus den benachteiligten Gebieten dieser Erde sagen: Ist es das Recht derer, die zufällig in einer guten Gegend zuerst ankamen und sich vermehrt haben, dort zu bleiben? Wenn die Naturressourcen Allgemeingüter sind, wie weit reicht dann die Allgemeinheit? Beziehen wir uns dabei auf ein Staatsvolk, so dass es innerhalb einer Nation verteilt wird? Oder beziehen wir uns auf die ganze Menschheit, wobei jeder Mensch eigentlich Eigentumsrechte hätte an allem, was die Natur hervorbringt überall auf der Erde? Und wie ist es zwischen den Generationen? Was ist, wenn sich einige Völker vor anderen für Geburtenbeschränkung entscheiden? Eigentlich tun sie das zu dem Zweck, dass ihre Nachkommen eine bessere Lebensgrundlage haben. Das wäre völlig sinnlos, wenn die anderen Völker, die diese Beschränkung nicht auf sich nehmen, Rechte gemäß ihrer Bevölkerungsgröße hätten. Umgekehrt wird jeder, der erst einmal als Mensch existiert, auf sein Lebensrecht pochen. Es ist also nicht etwa einfach, Kriterien zur Verteilung herauszuschälen.
B: Ich will noch einmal zurückkommen auf die These. Du hast gewissermaßen selbst Fragen aufgeworfen, die offenbar auch für dich noch keineswegs geklärt sind. Um die These noch etwas zu erhellen, würde es mich interessieren, ob du diese Beschränkung des Eigentums auf nicht Naturgegebenes auch innerhalb eines Volkes für Privatgrundstücke vorschlagen würdest bzw. für wünschenswert hältst. Das würde bedeuten, es gäbe in einem solchen Staat kein Grundeigentum. Geht das so weit? Oder beziehst du dich mehr auf den Zusammenhang zwischen den Völkern, dass bestimmte Völker gute Regionen, andere Völker schlechtere Regionen haben? Wie weit geht deine Überlegung?
T: Auch das Eigentum an Grundstücken kann man, moralisch gesehen, anfechten. Grundstücke sind ohne Zweifel eine Naturgegebenheit. Das moralische Problem entsteht dadurch, dass dann, wenn eine Eigentumsordnung erst einmal entstanden ist, Leistungen der Eigentümer in die Grundstücke gesteckt werden. Ist ein Areal von Natur aus gutes Ackerland oder ist es gutes Ackerland, weil es von Generationen gehegt und gepflegt, bebaut und gedüngt wurde. Wenn letzteres der Fall wäre: Wie werden diese Eigentümer dafür kompensiert und entlohnt, dass sie das getan haben?
B: Verstehe ich das richtig, dass du für eine Eigentumsordnung plädierst - auch bei Grundeigentum - die eigentlich der der Indianer entspricht? Denn die Indianer hatten, so weit ich informiert bin, die Regel, dass es am Land kein Eigentum geben soll, dass das Land allen gehört.
T: Das halte ich für eine recht sinnvolle Vorstellung und ich glaube auch, dass es einen Zeitraum in der Geschichte gab, in der das in allen Völkern einmal die Vorstellung und die herrschende Form war. Das Land hat der Sippe gehört, also den Bewohnern gemeinsam und wurde immer wieder neu aufgeteilt. Ich meine, in Israel gab es die Regel, dass nach 7 mal 7 Jahren das Land neu aufgeteilt werden sollte.
B: Das ist immerhin bemerkenswert. Es gab das so genannte Erbteil. Jedem einzelnen Stamm wurde ein bestimmtes Gebiet zugeordnet und innerhalb der Stämme kann man davon ausgehen, dass jede Sippen ihr Erbteil hatte. Dass das alle fünfzig Jahre neu verteilt werden sollte, das ist dann eine eigene Sache. Aber jedenfalls gab es in Israel Eigentum an Grundbesitz für mindestens 50 Jahre. Ich glaube, so viel können wir aus der Geschichte Israels entnehmen.
T: Wenn man sagt 50 Jahre, so könnte man das als eine Art sehr langer Pacht gegenüber dem Gesamtvolk betrachten, allerdings in dem Sinne, dass man keine Pachtgebühren gezahlt hat und wusste, es kann wieder eine Umverteilung geben.
B: Geht deine Vorstellung dahin, dass man also z.B. für Deutschland sagen könnte. Das ganze Territorium gehört dem Staat, also der öffentlichen Körperschaft Bundesrepublik Deutschland. Diese verpachtet es für eine bestimmte Zeit an bestimmte Leute mit oder ohne Entgelt. Wäre das eine Vorstellung, die dir nahe käme?
T: Angenommen es wäre ein wirklich demokratischer Staat, in dem das Volk die Kontrolle über die Regierung hat, so wäre das eine Vorstellung, mit der ich mich anfreunden könnte. Um das Land zu nutzen, müssen die einzelnen wissen, wer welches Stück Land nutzen darf Eventuell wird es mit Auflagen und nur für ganz bestimmte Zwecke vergeben. Ich wäre dann allerdings der Meinung, dass es sinnlos ist, das Land so aufzuteilen, das jeder eine gleiche Parzelle erhält. Es wären Pachtgebühren zu zahlen, die auf das ganze Volk zu verteilen sind, so dass mehr oder weniger jeder einen Anspruch auf einen Anteil am so erwirtschafteten Gesamtvermögen hat.
B: Also du stellst dir vor, dass auf jeden Fall Pacht bezahlt wird und dass diese Pacht dann eine Art Staatseinnahme ist.
T: Aber eine Staatseinnahme, die ich mir so vorstelle, dass sie in einen großen Topf fließt und dann pro Kopf auf die Staatsbürger verteilt wird, nicht dass die Regierenden damit schalten und walten können.
B: Na gut, das wäre eine Detailfrage. Noch eine weitere Detailfrage: Kannst du dir vorstellen, dass Land auch versteigert wird, dass man alle fünfzig oder hundert Jahre Landauktionen durchführt?
T: Versteigert nicht in dem Sinne, dass das ganze Geld auf einmal bezahlt wird. Aber wenn man fragt „Wer ist bereit die größte Pacht pro Monat oder Jahr zu zahlen?“ und dementsprechend den Zuschlag erteilt, so könnte ich mir das vorstellen. Dabei sollte der Staat die Möglichkeit haben, nur unter bestimmten Auflagen zu verpachten. Wenn jemand für diese Nutzungsvorgabe das meiste bietet, okay, dann soll er den Zuschlag erhalten.
B: Ich schlage vor, wir lassen das als Schlusswort für heute gelten.
B: Heute ist Samstag der 20. November 2004 und wir wollen Theas These weiter diskutieren. Wir befinden uns noch in der Fragephase. Meine nächste Frage ist: Wie stellst du dir die Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln vor? Es war die zentrale These von Marx, die dann auch die Weltgeschichte weitgehend geprägt hat, dass Produktionsmittel möglichst zu sozialisieren sind.
T: Wobei Marx sicherlich auch an die sehr kapitalintensiven Produktionsmittel in erster Linie dachte. Denn im Prinzip ist auch eine Nähnadel oder eine Säge im Haus ein Produktionsmittel. Und ich denke Produktionsmittel, die ein einzelner noch benutzen kann – klammern wir mal das Problem der Automatisierung und der Roboter aus – da hätte auch Karl Marx nichts dagegen gehabt, wenn die in privater Hand bleiben. Das Problem war für ihn, dass es Maschinen gibt, die sehr viel Kapitaleinsatz erfordern, um sie überhaupt zu bauen und an denen dann mehrere Arbeitnehmer beschäftigt sind. Da diese Maschinen so effektiv arbeiten, war es gesellschaftlich nicht sinnvoll zu sagen, jeder arbeitet lieber mit seinem kleinen Handgerät zu Hause. Aber andererseits führte das dazu, dass der Kapitalist, der das Geld für diese Maschinen vorzuschießen in der Lage war, über das Produkt allein bestimmen durfte. Und das fand Marx nicht in Ordnung. Dieser Sachverhalt hat allerdings nichts mit den natürlichen Ressourcen zu tun. Sicherlich wäre die obige Situation so auch nie aufgetreten, wenn nicht vorher Menschen in der Lage gewesen wären, Kapital durch Aneignung der natürlichen Ressourcen anzuhäufen. Ich nehme an, wenn eine gleichmäßigere Eigentumsverteilung zu Beginn der industriellen Revolution da gewesen wäre, dann hätte diese vielleicht in sozialer Hinsicht ganz andere Folgen gehabt. Wobei Marx sicherlich fragen würde: Hätte sie dann überhaupt stattfinden können?
B: Das ist ein Blick in die Lehren von Karl Marx, die du hoffentlich richtig abgespeichert hast. Ich kann da nicht so gut mitreden. Aber das ist eigentlich auch nicht unser Thema, sondern es geht mehr um die Frage: Wie gestalten wir heute oder in Zukunft die Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln? Und da möchte ich meine Frage noch einmal wiederholen: Wie siehst du diesen Sachverhalt, nachdem wir nun einige Jahrhunderte Erfahrungen haben mit den verschiedenen Eigentumsordnungen in Bezug auf Produktionsmittel in den verschiedenen Staaten: Fällt das auch unter die Rubrik „Eigentum ist Diebstahl?“ Mit anderen Worten: Eigentum an Produktionsmitteln ist Diebstahl?
T: Nicht automatisch. Wie gesagt, die Frage ist, woher kommt das Geld für exzessiv teure Produktionsmittel. Wenn sich jemand selbst ein Produktionsmittel herstellt und hat das Material von der Gemeinschaft zugebilligt bekommen nach den Regeln, die in der Gemeinschaft gültig waren, kann man das eigentlich nicht als Diebstahl einordnen. Das mit dem Diebstahl würde ich wirklich nur auf die Naturressourcen beziehen, für die eben niemand etwas getan hat, die einfach da sind. Jemand maßt sich an und sagt: "Gehört mir."
Du hast die Frage aufgeworfen: Wie gestalten wir eine sinnvolle Eigentumsordnung? Das ist durch diese These, dass alle Eigentumsordnungen unserer Zeit auf Raubzügen der Vergangenheit beruhen, noch keineswegs geklärt. Denn da stehen gleich zwei Fragen im Raum. Die eine Frage ist: Was ist gerecht? Und da gäbe es auf jeden Fall moralische Gründe, das Eigentum nicht so als sakrosankt zu betrachten, wie es sich heute darstellt. Die andere Frage ist: Was ist effektiv? Was führt dazu, dass die Ressourcen der Erde am besten und sinnvollsten für alle Menschen genutzt werden? Das wieder ist eine ganz andere Frage. Beide Fragen müsste man beantworten können, wenn es um die optimale Eigentumsordnung geht. Insbesondere bei der zweiten Frage fühle ich mich als blutiger Laie. Da hätten vielleicht die Volkswirte uns einiges zu sagen.
B: Die Fragen, die du da aufwirfst, sind in der Volkswirtschaftslehre voll und ganz bekannt. Sie werden seit Jahrzehnten diskutiert, von sehr prominenten Volkswirten diskutiert, auch von Nobelpreisträgern. Auf Englisch heißen diese beiden Begriffe „equity“ für Gerechtigkeit, was wörtlich Gleichheit heißt, und „efficiency“. für Effizienz. Zwischen equity und efficiency wird durchaus ein Konflikt gesehen, der mit Sicherheit nicht leicht zu lösen ist. Ich glaube sogar, dass dies einer der Grundkonflikte ist, in dem sich in der gegenwärtigen Zeit die deutsche Wirtschaftspolitik und möglicherweise die Wirtschaftspolitik weltweit befinden. Das wäre ein heißes Thema. Aber immerhin ist an dieser Sache deutlich erkennbar, dass hier philosophische Gesichtspunkte, - indem ich überlege, was ist gerecht, - und ökonomische Gesichtspunkte zusammenspielen und dass man das eine nicht ohne das andere klä...