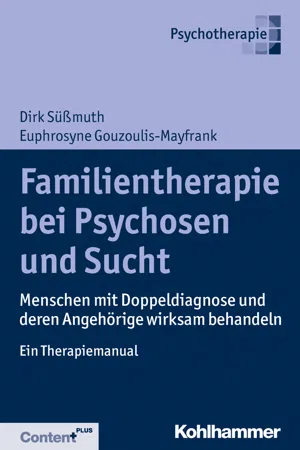
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Familientherapie bei Psychose und Sucht
Menschen mit Doppeldiagnose und deren Angehörige wirksam behandeln - Ein Therapiemanual
- 106 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Familientherapie bei Psychose und Sucht
Menschen mit Doppeldiagnose und deren Angehörige wirksam behandeln - Ein Therapiemanual
Über dieses Buch
Menschen mit der Komorbidität einer Psychose und Suchterkrankung benötigen eine komplexe, integrierte psychosoziale Behandlung. Familieninterventionen sind ein wichtiger Baustein davon, allerdings lag hierfür bislang kein Manual in deutscher Sprache vor. Die hier vorgestellte Gruppenintervention wird teils in der Angehörigen- und teils in der gemischten Angehörigen- und Patientengruppe durchgeführt. Sie enthält Module für die Psychoedukation, Rezidivprophylaxe, Kommunikationstraining und Selbstfürsorge für Angehörige. Das Manual bietet zahlreiche konkrete Formulierungsvorschläge sowie ausführliche Arbeitsmaterialien und Vorlagen zum Download zum direkten Einsatz in der therapeutischen Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Familientherapie bei Psychose und Sucht von Dirk Süßmuth,Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Psychotherapie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung, Hintergrund
1.1 Häufigkeit von Doppeldiagnosen und Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf
Doppeldiagnosen haben in Forschung und Praxis in den letzten Jahrzehnten vermehrt Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Substanzstörung bei Personen mit psychischer Störung deutlich höher liegt als in der Allgemeinbevölkerung: Eine großangelegte epidemiologische Studie in den USA konnte bereits in den 1980er Jahren zeigen, dass bei Patienten mit Schizophrenie die Lebenszeitprävalenz für die Entwicklung einer komorbiden Substanzstörung bei ca. 47% lag (verglichen mit ca. 17% in der Allgemeinbevölkerung (Regier et al. 1990)). Kleinere Folgestudien schätzten die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer komorbiden Substanzstörung bei Menschen mit Psychose ebenfalls auf durchschnittlich ca. 50%, wobei die Prävalenzraten je nach Behandlungssetting deutlich nach oben und unten abwichen (Drake & Mueser 2000, Rush & Koegl 2008, Westermeyer 2006). Eine großangelegte europäische Studie zur Erfassung komorbider substanzbezogener Störungen von 1204 schizophren Erkrankten im Alter von 18 bis 64 Jahren in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zeigte im Ländervergleich in Großbritannien die höchste Lebenszeitprävalenz für die Entwicklung komorbider Substanzstörungen (35%), gefolgt von Deutschland (21%) und Frankreich (19%), wobei die Prävalenzraten für die vorangegangen zwölf Monate ungefähr halb so hoch lagen (Carra et al. 2012b). Mehrere regional in Deutschland durchgeführte Studien berichteten unterschiedliche Lebenszeitprävalenzraten: während in München »nur« 21,8% der schizophrenen Patienten eine komorbide Substanzstörung aufwiesen (Soyka et al. 1993), waren es in Köln 29,4% (Schnell et al. 2010) und in Hamburg 47,5% (Krausz et al. 1996). Auf jeden Fall weisen aber die hohen Prävalenzraten darauf hin, dass Psychosen und komorbide Substanzstörungen nicht zufällig, sondern als »Doppeldiagnose« überproportional häufig vorkommen (Gouzoulis-Mayfrank 2007).
Der schädliche Gebrauch oder eine Abhängigkeit von Alkohol und Cannabis scheint den Großteil der komorbiden substanzbezogenen Störungen bei Psychosepatienten in Deutschland auszumachen, gefolgt vom Mischkonsum anderer Substanzen (Hambrecht & Häfner 1996, Schnell et al. 2010). In den USA und Australien scheinen die Prävalenzraten für den komorbiden Konsum von Stimulanzien (insbesondere Kokain) bei Psychosepatienten höher als in Europa zu liegen (Carra et al. 2012b, Chakraborty et al. 2014, Mueser et al. 1990, Sara et al. 2014).
Schizophrene Patienten mit komorbider Substanzstörung sind überzufällig jung, männlich, ledig und haben ein niedrigeres Ausbildungsniveau im Vergleich zu an Schizophrenie Erkrankten ohne komorbide Substanzstörung (Schnell et al. 2010, Toftdahl et al. 2016, Wobrock et al. 2004).
Vergleicht man die Krankheitsverläufe von Psychosepatienten mit und ohne komorbide Substanzstörung, so zeigt sich, dass die Substanzstörung den Verlauf der psychotischen Erkrankung negativ beeinflusst und weitere unspezifische Symptome und psychosoziale Konflikte nach sich zieht. Psychosepatienten mit komorbider Substanzstörung brechen im Vergleich zu anderen Psychosepatienten häufiger die Behandlung vorzeitig ab (Archie & Gyömörey 2009, Miner et al. 1997), nehmen häufiger ihre Psychopharmaka nicht wie verordnet ein (Drake & Brunette 1998, Swartz et al. 1998), weisen einen höheren Symptomschweregrad auf (Barbee et al. 1989), sind durchschnittlich für längere Zeit unbehandelt (Chakraborty et al. 2014), erleiden häufiger psychotische Rezidive (Archie & Gyömörey 2009, Drake & Brunette 1998), müssen häufiger (Drake & Brunette 1998, Schmidt et al. 2011) und für längere Zeiträume stationär behandelt werden als Psychosepatienten ohne komorbide Substanzstörung (Blachut et al. 2013) und sind affektlabiler (Alterman et al. 1980), depressiver und suizidgefährdeter (Blachut et al. 2013, Chakraborty et al. 2014, Drake & Wallach 1989). Sie zeigen häufiger »störendes« Verhalten (Blachut et al. 2013, Drake & Brunette 1998, Drake & Wallach 1989), haben häufiger familiäre Konflikte und instabilere Wohnverhältnisse (Drake & Brunette 1998) und sie geraten häufiger in Konflikt mit dem Gesetz (Barry et al. 1996). Darüber hinaus geht mit komorbiden Substanzstörungen ein erhöhtes Risiko körperlicher Folgeerkrankungen und Infektionskrankheiten wie z. B. HIV oder Hepatitis einher (Drake & Brunette 1998, Thompson et al. 1997). Patienten mit einer Psychose und komorbider Substanzstörung weisen generell ein niedrigeres globales, allgemeines Funktionsniveau als Patienten ohne komorbide Substanzstörung auf (Drake & Brunette 1998); dennoch sind sie kognitiv nicht grundsätzlich mehr beeinträchtigt im Vergleich zu Psychosepatienten ohne komorbide Substanzstörung (Addington & Addington 1997).
1.2 Entstehungsmodelle von Doppeldiagnosen
Für die Komorbidität von Psychosen und Substanzstörungen werden in der Forschung gegenwärtig mehrere Erklärungsmodelle diskutiert:
1.2.1 Sekundäre Suchtentwicklung
Bei den Modellen der sekundären Suchtentwicklung wird angenommen, dass Substanzstörungen die Folge von psychotischen Störungen sind. Zentral ist hier die Selbstmedikationshypothese (Khantzian 1985, 1997): je nach vorhandener Symptomatik einer Psychose würden die Erkrankten Substanzen konsumieren, um z. B. psychotische Positiv- oder Negativsymptome, kognitive Beeinträchtigungen oder unerwünschte medikamentöse Nebenwirkungen zu lindern. In der aktuellen Forschung gibt es nur schwache Belege für die Selbstmedikationshypothese (Pettersen et al. 2013, Saddichha et al. 2010), häufig haben die Erkrankten bereits vor Ausbruch der Psychose Substanzen konsumiert (Coulston et al. 2007, Gregg et al. 2007) und richten ihren Konsum eher nach der Verfügbarkeit der Substanzen als nach den Symptomen, unter denen sie leiden (Acier et al. 2007, Mueser et al. 2002).
Zu den Modellen der sekundären Suchtentwicklung zählt man auch das Modell der Affektregulation. Es postuliert, dass Patienten mit Hilfe des Substanzkonsums versuchen, dysphorische Affekte zu bekämpfen, die mit den psychotischen Symptomen selbst oder mit Auswirkungen der Psychose einhergehen (Dixon et al. 1991), und dass ähnliche Merkmale wie Impulsivität oder Affektlabilität bei Psychosepatienten zu Substanzkonsum führen, wie sie es auch bei Konsumenten ohne psychotische Störung tun können (Gregg et al. 2007).
Ein weiteres Modell der sekundären Suchtentwicklung ist das Supersensitivitätsmodell (Mueser et al. 1998b). Demnach weisen einige an Schizophrenie Erkrankte biologische und psychologische Vulnerabilitäten auf, die sie besonders anfällig für negative Auswirkungen von Substanzkonsum machen: geringere Substanzmengen reichten dementsprechend bei Menschen mit Psychose aus, um Komplikationen wie Wahrnehmungsstörungen oder inhaltliche Denkstörungen zu entwickeln. Auch dieses Supersensitivitätsmodell lässt sich jedoch schwer belegen, so konnten Gonzalez et al. (2007) keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Schweregrads allgemeiner psychischer Belastung zwischen Personen mit einfacher Substanzstörung und Doppeldiagnosepatienten aufdecken.
Schließlich führt in vielen Fällen ein ungünstiger Verlauf einer psychotischen Erkrankung zu einem sozialen Abstieg, der mit einem Umzug in soziale Brennpunkte und vermehrtem Kontakt zu einem sozialen Umfeld einhergeht, in dem Substanzkonsum und abweichendes Verhalten eher toleriert werden. Somit könnte dieser »social drift« vieler Patienten mit Psychose ebenfalls den Substanzkonsum begünstigen, wie einige Autoren nahe legen (Gouzoulis-Mayfrank 2007, Mueser et al. 1998b).
1.2.2 Psychoseinduktion
Nach dem Modell der Psychoseinduktion geht man im Gegensatz zur Selbstmedikationshypothese davon aus, dass der Konsum bestimmter psychotroper Substanzen wie Cannabis oder Stimulanzien den Ausbruch von Schizophrenien triggert (Kirkbride 2013). Erstmalig ergab eine vielzitierte Studie an schwedischen Rekruten, dass der Konsum von Cannabis dosisabhängig das Risiko für die spätere Entwicklung einer Schizophrenie sechs- bis siebenfach erhöhte (Andreasson et al. 1987, Zammit et al. 2002). Später lieferten prospektiv-epidemiologische Studien aus Neuseeland Hinweise darauf, dass ein früher Cannabiskonsum bereits in der Adoleszenz die Entwicklung subklinischer psychotischer Symptome und schizophreniformer Störungen im jungen Erwachsenenalter begünstigt (Arseneault et al. 2002, Fergusson et al. 2005, Fergusson et al. 2003). Eine großangelegte finnische Studie zeigte zudem, dass 46% der Fälle von cannabisinduzierten Psychosen acht Jahre nach der ersten stationär-psychiatrischen Behandlung in Schizophrenien übergingen (Niemi-Pynttari et al. 2013), wobei ein junges Lebensalter das Risiko zusätzlich zu vergrößern schien, an einer Schizophrenie zu erkranken (Kirkbride 2013).
Dennoch reicht der Drogenkonsum alleine nicht für die Entstehung einer Psychose aus; am ehesten haben wir es mit einem Zusammenspiel zwischen einer spezifischen Vulnerabilität oder Veranlagung für eine Psychose und den Substanzwirkungen zu tun (Caspi et al. 2005, van Os et al. 2005).
1.2.3 Modelle gemeinsamer ätiologischer Faktoren
Bei diesen Modellen werden gemeinsame biologische, individuelle oder soziale Faktoren für die Entwicklung von Schizophrenien und Substanzstörungen angenommen (Gregg et al. 2007). Unter den möglichen gemeinsamen biologischen Faktoren (Power et al. 2014, Rhee et al. 2003, Tsuang et al. 2001) könnten Veränderungen im dopaminergen und/oder endocannabinoiden Neurotransmittersystem eine Rolle spielen (Blum et al. 2014, Chambers et al. 2001, Weiser & Noy 2005). Einige Autoren weisen auf eine Verbindung zwischen der antisozialen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenien und substanzbezogenen Störungen hin (Mueser et al. 1997a), andere auf traumatische Erlebnisse in der Kindheit (Scheller-Gilkey et al. 2004), kognitive Defizite (Tracy et al. 1995) oder bestimmte Temperamentseigenschaften als gemeinsame ätiologische Faktoren (Fernández-Mondragón & Adan 2015). Die Befundlage ist aber größtenteils widersprüchlich und deutet auch hier auf komplexere Zusammenhänge hin (Gregg et al. 2007).
1.2.4 Bidirektionale und komplexere Modelle
Den bidirektionalen Modellen liegt die Annahme zugrunde, dass sich Schizophrenien und Substanzstörungen wechselseitig beeinflussen. So könnte der Substanzkonsum bei Personen mit einer erhöhten Vulnerabilität für Psychosen eine Schizophrenie auslösen, dadurch würde dann wiederum der Substanzkonsum aufrechterhalten werden, um unangenehme Begleiterscheinungen der Psychose zu bekämpfen (Gouzoulis-Mayfrank 2007, Meister et al. 2010). Einige neuere Untersuchungen weisen bidirektionale Zusammenhänge zwischen Psychose und Substanzstörung nach (Foti et al. 2010, Hides et al. 2006, Pettersen et al. 2013); sie verbinden somit die Annahmen der Selbstmedikationshypothese und der Psychoseinduktion. Sie könnten somit als integratives Modell zur Erklärung von Doppeldiagnosen dienen (Gouzoulis-Mayfrank 2007).
1.3 Behandlungsprinzipien bei Menschen mit Psychose und komorbider substanzbedingter Störung
Bis in die 1990er Jahre fand die Behandlung von Menschen mit der Doppeldiagnose Psychose und Substanzstörung überwiegend parallel oder sequentiell statt. Dieses Vorgehen wird in der Regel dem komplexeren Behandlungsauftrag nicht gerecht (Mueser et al. 2003, Ridgely et al. 1990). Häufig führen Symptome der einen Störung zum Ausschluss aus der Behandlung der anderen Störung, oder/und die Koordination zwischen den unterschiedlichen Behandlungssystemen misslingt (Gouzoulis-Mayfrank 2018, Mueser et al. 2003). Um die Defizite der nebeneinander bestehenden Behandlungssysteme zu überwinden, ging man in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu über, beide Störungen möglichst integriert in einem Setting bzw. durch ein Team zu behandeln.
Die nach aktuellem Stand langfristig erfolgreichsten Behandlungsprogramme arbeiten schwerpunktmäßig ambulant und sind langfristig ausgerichtet. Ein multiprofessionelles Behandlerteam, das in der Regel in der Behandlung beider Störungen erfahren ist, arbeitet idealerweise sektorübergreifend und bedarfsweise aufsuchend (Gouzoulis-Mayfrank 2018). Die Behandlung ist am Motivationsstadium der Patienten orientiert und zielt auf die Förderung einer Konsumreduktion oder Abstinenz ab, setzt aber nicht strikt Abstinenz voraus. Durch niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen wird sie den besonderen Bedürfnissen von Psychosekranken mit komorbider Suchtproblematik gerechter als traditionelle Behandlungssettings (Gouzoulis-Mayfrank 2007). Die meisten integrierten Behandlungsprogramme wurden im angloamerikanischen Raum entwickelt, aber auch im deutschsprachigen Raum wurden störungsspezifische Behandlungsmanuale entwickelt und regional implementiert (Bachmann et al. 1997, D’Amelio et al. 2007, Gouzoulis-Mayfrank 2007).
Alle Behandlungsprogramme mit langfristig positiven Ergebnissen beinhalten neben einer Pharmakotherapie psychosoziale Elemente aus der Motivationsbehandlung und Psychoedukation (Gouzoulis-Mayfrank 2018). Einige dieser Programme enthalten zusätzlich verhaltenstherapeutische Elemente und Familieninterventionen.
1.3.1 Elemente der psychosozialen Therapie
Mittels motivierender Gesprächsführung wird versucht, die intrinsische Motivation zur Konsumreduktion oder Abstinenz zu fördern, indem z. B. die kurz- und langfristigen individuellen Vor- und Nachteile des Substanzkonsums mit dem Patienten in nicht-wertender Art und Weise diskutiert werden (Miller & Rollnick 1992). Dabei orientiert sich der Therapeut am motivationalen Stadium der Patienten (Prochaska et al. 1992) und passt gegebenenfalls die Gesprächsführung bei eingeschränkten kognitiven Funktionen des Patienten an (Drake & Mueser 2000). Motivationale Interventionen sind ein Kernelement der Behandlung von Patienten mit Psychose und komorbider Substanzstörung, einzelne Studien weisen positive Effekte selbst bei Kurzbehandlungen auf, die nur ein bis drei motivierende Gespräche beinhalteten (s. Gouzoulis-Mayfrank, 2007).
Mittels Psychoedukation werden Patienten über die möglichen Zusammenhänge zwischen der Psychose und komorbidem Substanzkonsum aufgeklärt und es werden die Risiken eines fortgesetzten Substanzkonsums dargestellt. Durch die Vermittlung potentieller Entstehungsmodelle der Erkrankungen und ihrer Interaktionen sollen die Entwicklung eines individuellen Krankheitsmodells und die Abstinenzmotivation gefördert werden.
Einige der publizierten Behandlungsmanuale beinhalten zusätzlich verhaltenstherapeutische Interventionen, die schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet sind, mit den Patienten individuelle Strategien im Umgang mit Suchtdruck und Versuchungssituationen zu erarbeiten; auch dabei werden eventuell vorhandene eingeschränkte kognitive Funktionen der Patienten berücksichtigt (Carroll et al. 1998, D’Amelio et al. 2007, Gouzoulis-Mayfrank 2007, Graham et al. 2004). Durch das Einüben von abstinenzbezogenen Skills und allgemeinen sozialen Fertigkeiten sollen die Erkrankten dazu befähigt werden, gegenüber Versuchungssituationen standhaft zu bleiben und akuten Suchtdruck zu überwinden.
Im deutschsprachigen Raum wurden bislang zwei Behandlungsmanuale publiziert, in denen die Psychoedukation einen zentralen Bestandteil der Behandlung darstellt (D’Amelio et al. 2007, Gouzoulis-Mayfrank 2007). Gouzoulis-Mayfrank (2007) bietet einen ausführlichen Praxisteil, in dem die Zusammenhänge zwischen psychotischen Störungen und dem Konsum relevanter psychotroper Substanzen sowie die psychischen und körperlichen Folgen des Konsums der verschiedenen Substanzen vermittelt werden (KomPAkt: Komorbidität Psychose und Abhängigkeit: Psychoedukation). Darüber hinaus legten Schnell und Gouzoulis-Mayfrank (2007) ein verhaltenstherapeutisches Programm mit Skills-Training zum Umgang mit Craving sowie weiteren abhängigkeitsspezifischen Bereichen wie kognitive Umstrukturierung oder Soziales Kompetenztraining speziell für Psychosekranke vor (KomPASs: Komorbidität Psychose und Abhängigkeit: Skills-Training).
D’Amelio, Behrendt und Wobrock (2007) entwickelten das integrierte Behandlungsprogramm GOAL für Patienten mit schizophrener Psychose und komorbidem Substanzkonsum (GOAL: Gesund und ohne Abhängigkeit leben). GOAL besteht aus fünf Modulen: GOAL-Psychoedukation, welches neben Informationen über die komorbiden Erkrankungen auch Strategien für den Umgang mit Rückfällen und zur Rückfallprophylaxe vermittelt, GOAL-Praxis, bei dem im Rollenspiel Fertigkeiten (»Skills«) zur Rückfallprophylaxe und zur Gestaltung sozialer Kontakte eingeübt werden, GOAL-Kreativ, bei dem sich dem Drogenkonsum und seinen Auswirkungen über künstlerische Gestaltung angenähert werden soll, GOAL-Sport zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und GOAL-Nachsorge zur nachhaltigen und kontinuierlichen Rückfallprophylaxe.
In den letzten Jahren werden zunehmend Angehörige in die integrierten Behandlungsprogramme von Doppeldiagnose-Patienten mit einbezogen (Gouzoulis-Mayfrank 2018). In der Regel werden bewährte Interventionen aus Behandlungsprogrammen für Angehörige psychisch anders Erkrankter (wie z. B. Psychoedukation, Kommunikations- und Problemlösetrainings) miteinander kombiniert und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe an...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- 1 Einleitung, Hintergrund
- 2 Behandlungsmanual FIPA (Familienintervention bei Menschen mit Psychose und Abhängigkeitserkrankung)
- 3 Evaluation der Familienintervention FIPA
- 4 Zusammenfassung
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Literatur
- Zusatzmaterial – Handouts