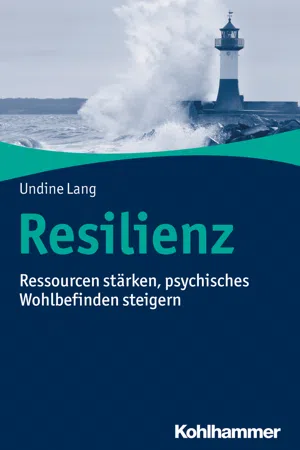
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Resilienz
Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern
- 267 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Über dieses Buch
Psychological crises are normal & nowadays, one in two people is likely to suffer from some form of mental illness at some time during the course of life. As a result, a paradigm shift is taking place, with a move away from attempts to control symptoms and more toward strengthening of resources. Many of those affected have learned to control the illness themselves, curing it or avoiding any future psychological illness from the start. This book presents 53 different ways of helping to promote mental and physical health.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Resilienz von Undine Lang im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Psychotherapeutische Beratung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil 1 Wie wirkt sich unsere Außenwelt auf unsere psychische Gesundheit aus?
Einführung
Viele äußere Faktoren können uns Menschen vor psychischen Erkrankungen schützen. Das heißt nicht gleichzeitig, dass sie automatisch unser Glück und Wohlbefinden beeinflussen oder definieren. Das heißt auch nicht, dass es ein automatisch ein Problem darstellt, wenn sie abhandengekommen sind oder fehlen. Diese Umgebungsfaktoren machen es einfach leichter, in Krisen zu navigieren und Probleme zu lösen. Sie ermöglichen uns mehr Optionen und mehr Spielraum, wenn Probleme auftreten, mit diesen umzugehen. Sie stellen also eine Art Backup dar, wenn im Leben Krisen auftreten, und stärken uns dann den Rücken. Wenn sich diese äußeren Umstände verändern, heißt das jedoch nicht automatisch, dass das Leben aus dem Ruder läuft, im positiven und im negativen Sinn. Sie sind wie eine Art Rettungsboot. Ein Schiff muss nicht kentern, nur weil es über kein Rettungsboot verfügt. Wenn es aber kentert, kann ein Rettungsboot hilfreich sein. Im Vorfeld von Krisen wird die Wichtigkeit von Umgebungsbedingungen eher überschätzt. Eine neue Studie, die von Ökonomen durchgeführt wurde, zeigte, dass Menschen die Bedeutung von Lebensereignissen wie Arbeitslosigkeit, Verlust des Partners, Krankheit, Scheidung, Heirat und Trennung im Vorfeld massiv überschätzen, das heißt sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie sich an die neue Situation nicht anpassen könnten (Odermatt und Stutzer 2019).
Wir streben vieles im Leben an, was aber nicht unbedingt immer unser Herzenswunsch ist und was unser Leben letztlich nicht unbedingt derart bereichert, wie wir uns das im Vorfeld vorstellen. Eine Untersuchung aus dem Jahre 1978 zeigte, dass sich beispielsweise das Leben von Menschen ein Jahr nach einer Querschnittslähmung oder einem Lottogewinn zwar gravierend verändert hatte, ihre grundsätzliche Lebenszufriedenheit jedoch wieder genau an dem Wert angelangt war, den sie schon vor diesen einschneidenden Lebensereignissen inne hatte (Brickmann et al. 1978).
Was sind diese äußeren Faktoren, die einen Schutz vor psychischen Krisen darstellen können? Einer der wichtigsten Schutzfaktoren vor psychischen Erkrankungen ist ein Arbeitsplatz. Wenn jemand keine Arbeit hat, kann das Risiko für Suizide um das Neunfache ansteigen. Auch glücklich verheiratet zu sein, schützt vor psychischen Erkrankungen, Männer mehr als Frauen. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen in der Stadt leben, ist es gut zu wissen, dass Grünflächen in den Städten wie auch ruhigere Gebiete vor psychischen Erkrankungen schützen. Auch das Leben auf dem Land schützt die psychische Gesundheit genauso wie der Umgang mit Tieren. Religion ist einer der stärksten Schutzfaktoren, um psychische Stabilität zu erreichen. Körperliche Gesundheit ist ein weiterer Schutzfaktor: Körperliche Erkrankungen verdoppeln das Risiko für psychische Erkrankungen und psychische Erkrankungen verdoppeln das Risiko körperlicher Erkrankungen. Freunde spielen eine große Rolle für den Erhalt der psychischen Gesundheit, vor allem wenn mit ihnen ein reger Austausch und Kontakt gepflegt wird. Fortschreitendes Alter ist ebenfalls ein Schutzfaktor, auch wenn im Alter mehr psychische Erkrankungen vorkommen. Die höchste Lebenszufriedenheit erreichen Menschen statistisch betrachtet zwischen ihrem 65. und 74. Lebensjahr. All diese und viele weitere Faktoren bilden unser »Lebens-Setup«, sie können Gesundheitsrisiken darstellen, wenn sie wegbrechen und uns in Krisenzeiten stärken und vor psychischen Erkrankungen schützen.
Wie männlich wir sind
Frauen leiden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an einer psychischen Erkrankung als Männer.
Michaela ist 36 Jahre alt und sie ist seit fünf Jahren als Finanzchefin sehr erfolgreich in einem börsennotierten Unternehmen tätig.1 Ihr Beruf ist ihr absoluter Traumjob, sie hat einen sehr väterlichen und fürsorglichen Chef, und ihr Ehemann, der erfolgreich als Anwalt tätig ist, hat sie in ihrer Karriere bisher immer unterstützt. Michaela ist sehr selbstbewusst und fröhlich, sie hatte nie psychische Probleme, sie hat viele Hobbys, ist sehr sportlich und hat eine gute Work-Life-Balance. Zusammen mit ihrem Mann ist sie in den letzten zehn Jahren immer wieder gerne verreist, war Segeln, Golfspielen, kann Kite-Surfen, ist eine Weinliebhaberin und tanzt sehr gerne. Vor einigen Jahren hatte sie mit ihrem Mann vereinbart, dass Michaela während ihrer Ausbildung das Studium ihres Mannes finanziert und er dann später quasi im Gegenzug die Kindererziehung übernehmen würde, damit Michaela direkt nach der Geburt in ihren Job, der ihr extrem wichtig ist, wieder einsteigen kann.
Nun hat Michaela vor drei Monaten ein gesundes Mädchen entbunden, ihr erstes Kind, und hatte eigentlich geplant, sofort wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Ihr Ehemann hat seine Arbeitsstelle pausiert, er hat unbezahlten Urlaub für zwei Jahre genommen, das Paar ist damit auf das Gehalt von Michaela angewiesen. Als sich Michaela nun wieder auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz macht, bemerkt sie plötzlich einen starken Druck auf der Brust, ihre Atmung wird immer schneller, sie fängt an zu schwitzen, zu zittern und bekommt Herzrasen, weiche Knie und muss sich festhalten, um nicht umzukippen. Michaela hatte so etwas noch nie erlebt und alarmiert den Notarzt. Der Notarzt bringt sie in die nächstgelegene Rettungsstelle. Dort wird eine ausführliche Diagnostik durchgeführt, EKG, Echokardiographie, Blutbild, EEG und eine Computertomographie. Danach kommt der konsiliarische Psychiater zu Michaela und erklärt ihr, dass sie eine Panikattacke erlitten hat. Panikattacken seien sehr gut heilbar, bei 90 % der Menschen würde eine dreimonatige Psychotherapie wieder zur völligen Genesung führen, sagt er. Im ersten Moment ist Michaela eher erleichtert, dass weder Herz-Kreislauf, noch Schilddrüse, noch Lungenfunktion, noch Magen oder Darm irgendwelche Auffälligkeiten aufweisen. Michaela informiert ihren Arbeitgeber und nimmt sich vor, eine Woche später wieder in ihren Beruf einzusteigen. Als sie sich nach einer Woche erneut auf den Weg zur Arbeit begibt, kommt es jedoch an exakt derselben Stelle, nämlich an der Haltestelle der Straßenbahn erneut zu einer Panikattacke, die sofort beendet ist, als Michaela den Nachhauseweg zu Fuß antritt. Es ist, als ob die Panik verhindern will, dass Michaela arbeiten geht. In der Folge entwickelt Michaela eine immer größere Angst davor, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, da ihr die Panikattacken unerträglich erscheinen und sie diese um jeden Preis vermeiden will. Sie hat in dem Moment Angst, sie könnte tot umfallen oder zumindest bewusstlos werden. Die Angst verdoppelt sich also sogar: Die Angst kommt einerseits in diesen bestimmten Momenten, wo sie den Weg zur Arbeitsstelle antritt, und dann besteht zwischen diesen Momenten zusätzlich die Angst vor der Angst. Nach einigen Monaten fängt Michaela an, immer mehr Situationen zu vermeiden, an Arbeit ist gar nicht zu denken. Auch kommt es mit ihrem Ehemann zu Konflikten, da dieser anfängt, sich um die finanzielle Situation Sorgen zu machen. Ihr Arbeitgeber wird etwas ungeduldig und sie hat zusätzlich dem Baby gegenüber ein sehr schlechtes Gewissen, einfach wieder arbeiten zu gehen. Sie hat die Bindung zu ihrem Baby unterschätzt, als sie mit ihrem Mann ihre Zukunft geplant hatte.
Kurzerhand beschließt Michaela, sich in eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Dort wird sie deutlich entlastet, sie spricht endlich über sich, über ihre Gewissenskonflikte, über die Belastung, die die derzeitige Situation für sie auslöst, die finanzielle Verantwortung und Gefühle als Mutter und über die körperlichen Symptome, die ihre Angst verursacht, und über die ganze auslösende Situation. In nur wenigen Sitzungen kann die Panik wieder eingedämmt werden, Michaela lernt Entspannungstechniken und setzt sich wieder bewusst und in kleinen Schritten angstauslösenden Situationen aus. Dann wird gemeinsam mit dem Ehemann und dem Arbeitgeber eine Lösung für die weitere Zukunft vereinbart, nämlich dass Michaela und er sich die Verantwortung für das Baby teilen. Ihr Mann steigt wieder auf Teilzeitbasis in den Beruf ein und damit kann sich Michaela um das Baby kümmern und trägt nicht die volle finanzielle Verantwortung. Die Panikattacken verschwinden so schnell, wie sie aufgetreten waren.
Etwa ein Fünftel der Bevölkerung erleidet im Lauf des Lebens eine Angsterkrankung oder Depression, diese beiden Krankheitsbilder sind die häufigsten psychischen Erkrankungen. Frauen leiden etwa doppelt so häufig an Depressionen und Angsterkrankungen wie Männer, die Ursachen dafür sind nicht geklärt (Bromet et al. 2011).
Je männlicher Frauen sind, desto geringer ist ihr Risiko, Angsterkrankungen oder Depressionen zu bekommen, je weniger männlich Männer sind, desto höher ist ihr Risiko (Angst 1999). Es gibt psychische Erkrankungen, die bei Männern häufiger vorkommen, so werden beispielsweise illegale Drogen von Männern etwa doppelt so häufig konsumiert, der Konsum von illegalen Drogen ist jedoch selten. Früher war auch die Alkoholabhängigkeit und der riskante Konsum von Alkohol bei Männern häufiger als bei Frauen, sie waren dreimal so häufig betroffen, hier haben jedoch die Frauen »aufgeholt«: sie sind mittlerweile in den jüngeren Jahrgängen ab etwa 1966 fast genauso häufig betroffen wie Männer (Slade et al. 2016). Bei den sehr selten in der Bevölkerung vorkommenden Psychosen gilt, dass Frauen zwar genauso häufig, aber anders und später erkranken und nach der Menopause häufiger von Psychosen betroffen sind, die bei Männern nicht auftreten. Insgesamt schätzen Frauen ihr psychisches Wohlbefinden im Vergleich zu Männern schlechter ein und sind auch rein statistisch betrachtet häufiger psychisch krank. Zusammenfassend sind Frauen durch psychische Erkrankungen stärker belastet als Männer.
Eine Ursache dafür, dass Frauen eher zu Depressionen neigen, könnte sein, dass Frauen mehr grübeln als Männer, was einen Risikofaktor für Depressionen darstellt. Grübeln bedeutet, dass Gedanken immer wieder um das gleiche Thema kreisen und gleichzeitig unangenehm sind. Grübelnde Gedanken halten Menschen von dem täglichen Leben mit allen positiven und negativen Momenten ab und stellen sich wie eine Barriere zwischen die Betroffenen und ihr Leben. Frauen sind in der Regel stärker in Beziehungen involviert, sei es die Pflege eines Angehörigen, Sorge um die Kinder oder Eltern und den Zusammenhalt der Familie. Die Pflege von Angehörigen ist ein Risikofaktor für das Entwickeln von Depressionen und Burn-Out. Frauen sind, da sie gleichzeitig sowohl im Beruf als auch im Privatleben gefordert sind, häufiger Doppelbelastungen ausgesetzt. Ein weiterer Grund, warum Frauen häufiger als Männer depressiv werden könnten, ist, dass sie statistisch betrachtet älter werden. Obwohl Menschen im hohen Alter allgemein zufriedener sind, kommen Depressionen in höherem Alter häufiger vor. Frauen sind eher vorsichtiger als Männer und etwas weniger risikobereit. Es fehlt ihnen dadurch vielleicht manchmal der Mut, aktive oder egoistische Entscheidungen zu treffen, was Depressionen zu einem späteren Zeitpunkt begünstigen kann. Die bei Frauen häufiger gestellte Diagnose Depression liegt auch darin begründet, dass Frauen häufiger professionelle Hilfe bei Ärzten suchen.
Im Arbeitsumfeld befinden sich Frauen in einem Spannungsfeld, wie Sheryl Sandberg, COO von Facebook und damit eine der mächtigsten Frauen der Welt, in ihrem Buch »Lean In: Women, Work, and the Will to Lead« beschreibt. Sie befinden sich in einem Dilemma, da sie sich nicht immer erlauben, erfolgreich zu sein und ihre Träume so proaktiv, selbstverständlich und selbstbewusst zu erfüllen wie Männer (Sandberg 2013).
Das fängt in der frühen Jugend an, wenn Jungen häufiger als Mädchen angeben, dass sie gerne Präsident werden würden. Mädchen stecken sich seltener hohe und ambitionierte Ziele. Sich Ziele zu stecken, schützt vor Depressionen. Jungen melden sich häufiger in der Schule, das heißt, dass sie schon früh zeigen, was sie können und dass sie selbstbewusster sind. Auch Selbstbewusstsein schützt vor Depressionen. Außerdem bestehen allgemeine Vorurteile gegenüber den Fähigkeiten von Mädchen und Jungen, sogenannte Stereotype. Ein Stereotyp ist beispielsweise, dass ein Mädchen schlechter rechnen kann als ein Junge. In einer Untersuchung hat man beobachtet, dass Mädchen, wenn sie vor einer Mathematikaufgabe ankreuzen müssen, ob sie weiblich sind oder männlich, schlechter abschneiden. Wenn also den Mädchen bewusst gemacht wird, dass sie ein Mädchen sind, können sie gewisse Dinge schon automatisch schlechter (Sandberg 2013, Danaher und Crandall 2008). Im späteren Leben streben Männer eher Führungspositionen an als Frauen und sehen sich eher als »visionär« und »bereit, Risiken einzugehen«, als »Führungspersönlichkeit« und »selbstsicher« (Sandberg 2013). Dadurch, dass Männer schon sehr früh planen, eine Führungsposition einzunehmen, nehmen sie diese auch eher ein. Dieses Phänomen wird in der Psychologie eine »sich selbst erfüllende Prophezeiung« (»self-fulfilling prophecy«) genannt. Jemand kann seinen eigenen Erfolg prophezeien, wenn er selbst davon ausgeht, dass er Erfolg haben wird. Geht man in ein Bewerbungsgespräch und denkt, »die werden mich niemals nehmen«, »ich passe nicht ins Team«, »ich bin nicht qualifiziert genug«, dann wird man die Stelle eher nicht bekommen, obwohl man vielleicht der Beste für die Stelle wäre. Vermittelt man dort hingegen »ich bin die Beste für diese Stelle« und »die Stelle ist die beste Stelle für mich«, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit die Stelle bekommen. Nur ein Fünftel der sog. Millenial Generation nimmt sich weibliche Vorgesetzte zum Vorbild, Frauen werden als weniger motiviert wahrgenommen, weniger kompetent, ihr Erfolg als weniger erstrebenswert und sie finden sogar weniger Mentoren (Goux 2012, Ellemers et al. 2004, Hewlett et al. 2010). Frauen haben ein geringeres Einstiegsgehalt (Moss-Racusin et al. 2012).
Frauen haben es bei der Erfüllung ihrer beruflichen Träume teilweise schwerer, teilweise stehen sie sich im Weg. Weil sie nicht selbstbewusst davon ausgehen, dass sie Karriere machen werden und weil sie nicht aktiv ihre Karriere bahnen, bleiben sie teilweise hinter ihren männlichen Kollegen zurück. Frauen werden durch Führungspositionen eher unbeliebter, Männer dagegen eher beliebter, wenn sie erfolgreich sind (Sandberg 2013, Heilman et al. 2012). Frauen wechseln seltener, was ihnen Nachteile in der Karriere bringen kann (Lyness und Schrader 2006) und richten sich eher nach dem Karriereplan ihrer Männer als umgekehrt (Sandberg 2013, Schiebinger et al. 2008). Frauen steigen wegen der Karriere ihres Ehemannes (60 %) oder der Kinder (43 %) aus ihrem Beruf aus (Hewlett und Buck 2005, Sandberg 2013). Ein Ausstieg aus dem Beruf von zwei bis drei Jahren bewirkt häufig eine Gehaltseinbuße von etwa 30 % (Rose und Hartmann 2004, Sandberg 2013).
Männer ermutigen Frauen eher nicht zu entsprechenden Karriereschritten, sie leiden eher unter den Erfolgen ihrer Frauen (Ratliff et al. 2013).
Wenn sie eine Familie gründen und im Beruf erfolgreich sein wollen, denken Frauen oft nicht, dass sie alles haben, sondern dass sie alles verlieren, d. h. sie haben Angst, ihre Familie, ihren Mann und ihre Eltern zu vernachlässigen, wenn sie im Beruf erfolgreich sind und schlagen dann vielleicht von vornherein wichtige Karriereschritte aus. Frauen sind insgesamt selbstkritischer, sie geben sich eher selbst die Schuld, wenn sie scheitern (Johnson und Helgeson 2002) und geben sich zum Beispiel in der ärztlichen Ausbildung schlechtere Noten obwohl sie objektiv betrachtet besser abschneiden (Lind et al. 2002). Im Jahr 2016 wurde publiziert, dass weibliche Ärztinnen eine geringere Sterblichkeit ihrer Patienten zu verzeichnen haben als männliche Ärzte (Tsugawa et al. 2016), trotzdem sind im deutschsprachigen Raum, je nach Fachdisziplin nur etwa 10 % der Chefarztpositionen an Frauen vergeben.
De facto muss eine Karriere nicht einen »Verlust« im Privatleben bedeuten. Wenn man Kinder untersucht, die nicht ausschließlich von ihren Müttern erzogen wurden, haben sie keine Nachteile, weder im Sozialverhalten noch im intellektuellen Bereich noch in der Bindung zur Mutter (Sandberg 2013). Es ist so, dass 1975 eine Vollzeitmutter genauso viele Stunden mit der Kinderbetreuung verbrachte wie heute eine berufstätige Mutter (Sandberg 2013, Bianchi et al. 2006). Rein statistisch betrachtet wirkt sich eine Berufstätigkeit der Mutter nicht negativ auf die mit den Kindern v...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Teil 1: Wie wirkt sich unsere Außenwelt auf unsere psychische Gesundheit aus?
- Teil 2: Wie wirkt sich unser Verhalten auf unsere psychische Gesundheit aus?
- Teil 3: Wie wirkt sich unsere Haltung auf unsere psychische Gesundheit aus?