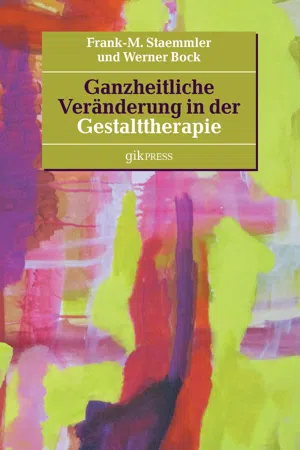
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie
Über dieses Buch
Fritz Perls entfaltete sein therapeutisches Können mehr intuitiv als in theoretisch gesichertem Rahmen. Die Autoren dieses Buches folgen in einer kritischen Revision der Entwicklung der Gestalttherapie und legen eine neue, systematische Beschreibung vor. Ein Buch, das aus mehr als einem Vierteljahrhundert der praktischen und theoretischen Beschäftigung mit Gestalttherapie erwachsen ist. Es ist inzwischen zu einem Klassiker in der deutschsprachigen Gestalt-Literatur geworden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie von Frank-M. Staemmler,Werner Bock im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psicologia & Storia e teoria della psicologia. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1. Kapitel
Fritz Perls und die Entwicklung der Gestalttherapie
Fritz Perls (1893 -1970) war eine faszinierende Persönlichkeit. »Halb Prophet und halb Landstreicher« nannte ihn seine Frau Laura; Perls fand diese Beschreibung passend und war stolz darauf (vgl. Shepard 1975, 3).
Er wird als Begründer einer neuen Therapieform, der von ihm so benannten »Gestalttherapie«, bezeichnet. Er selbst wollte sich nicht so sehen, sondern eher als »Entdecker oder Wiederentdecker«, denn: »Gestalt ist so alt wie die Welt« (Perls 1974, 24). Zurecht sieht Fritz Perls sein Verdienst darin, alte Weisheiten, die schon lange vor ihm in verschiedenen kulturellen Traditionen und Religionen (z. B. in der Bibel und im Zen-Buddhismus) existierten, für die Psychotherapie neu entdeckt zu haben (vgl. Gorton 1983).
Er hat sie mit den neuen philosophischen Strömungen der Phänomenologie und des Existentialismus, mit Erkenntnissen der Psychoanalyse und der Gestaltpsychologie verbunden (vgl. Smith 1976 und Kogan 1976) und diese verschiedenen Ansätze, Konzepte und Ideen in einem aufregenden, lebenslangen persönlichen Entwicklungsprozeß zu einer damals völlig neuen Form von Psychotherapie integriert – der seiner Meinung nach ersten wirksamen Form von Psychotherapie überhaupt (vgl. Perls 1980, 179). Die wichtigste Station in diesem Entwicklungsprozeß der Gestalttherapie war die Entdeckung des »Impasse« (ins Deutsche übersetzt als »Engpaß«, »Blockierung« oder »Sackgasse«).
Nach unserer Kenntnis seiner Biographie machte Perls diese »wesentlichste Entdeckung seines Lebens« (Cohn, in: Farau u. Cohn 1984, 304), mit der er seine Genialität und die Überlegenheit der Gestalttherapie gegenüber anderen Therapieformen begründete (vgl. Perls 1980, 99), in einem intensiven persönlichen Prozeß zwischen 1961 und 1964, in dem er die tödliche Bedrohung durch seine Herzkrankheit überwand und sich dabei völlig veränderte. Dadurch änderten sich auch sein Verständnis von Neurose und Therapie und seine Art, mit Klientinnen und Klienten zu arbeiten, noch einmal entscheidend – zwölf Jahre, nachdem er 1951 den Begriff »Gestalttherapie« geprägt hatte, und sechs Jahre vor seinem Tod.
Ilana Rubenfeld berichtet: »It’s interesting for me to see people who met him. I can tell when they met him – at what stage of his life he was at – because they latch on to a certain period of his life and they work like that. I feel lucky that I met him in the last four years because those four years were like a melting pot of many, many things. People of twenty years ago will say that he wasn’t doing Gestalt in the last few years. Or that he was doing a different Gestalt. He was a different Gestalt« (in: Shepard 1975, 203).
Perls hat also in verschiedenen Phasen seines Lebens therapeutisch sehr unterschiedlich gearbeitet. Er begann als Psychoanalytiker, entwickelte dann zwischen 1936 und 1940 erste eigene therapeutische Ansätze, die er unter dem Begriff »Konzentrationstherapie« zusammenfaßte und als eine »Revision der Psychoanalyse« verstand. Ab 1951 nannte er seine jetzt weiter ausgereifte neue Therapieform »Gestalttherapie« und arbeitete bis zu seinem Lebensende ständig an ihrer Weiterentwicklung. »Für Fritz war Gestalt immer das, was er zuletzt tat«, sagte uns Laura Perls etwas ironisch in einem Gespräch (Bock 1986). Wir sehen darin einen Ausdruck seiner stetigen Veränderung als Person und Therapeut.
Nach unserer Einschätzung kann die Entstehungsgeschichte der klassischen Gestalttherapie grob in zwei Phasen unterteilt werden: die Zeit von 1951 bis 1961, also die Gestalttherapie vor der Entdeckung des Engpaß; in bezug darauf, wie in dieser Zeit von Perls und anderen gestalttherapeutisch gearbeitet wurde, sprechen wir von der ›Frühform‹ der Gestalttherapie. Die Gestalttherapie, wie sie von Fritz Perls nach dieser wesentlichen Entdeckung praktiziert wurde, also in der Zeit von 1964 bis 1970, nennen wir ihre ›Spätform‹.
Beide Formen sind inhaltlich sehr unterschiedlich, und so haben sich nach Perls’ Tod, vermittelt durch seine jeweiligen Schülerinnen und Schüler aus diesen Phasen, offensichtlich auch verschiedene Traditionen und Formen von Gestalttherapie gebildet. Dementsprechend werden in Deutschland heute so unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen mit diesem Begriff verbunden, daß man von einer einheitlichen Bedeutung des Begriffes »Gestalttherapie« nicht mehr sprechen kann.
Interessanterweise wurde die erwähnte Veränderung von Fritz Perls, aus der heraus die Spätform der Gestalttherapie entstand, bis heute – wenn überhaupt – fast nur als persönliche Veränderung gewürdigt. Die weitreichenden Konsequenzen für Perls’ therapeutische Arbeit wurden auch von Gestalttherapeuten bisher kaum erkannt. Der für Perls am Ende seines Lebens so wichtige Begriff »Impasse« kommt z. B. in der Biographie von Martin Shepard (1975) überhaupt nicht vor.
Typisch für die übliche Perls-Rezeption in Deutschland ist z. B. die Darstellung der Gestalttherapie von Helmut Quitmann im Rahmen seines Buches über »Humanistische Psychologie« (1985). Er rezipiert im wesentlichen Inhalte des Buches von Perls, Hefferline und Goodman aus dem Jahre 1951, das bis heute offensichtlich immer noch als das theoretische Hauptwerk der Gestalttherapie gewertet wird (deutsch: 1979a, 1979b); er bezieht sich damit, wenn man unserer Unterteilung folgt, ausschließlich auf die Frühform der Gestalttherapie. Perls selbst hat angeblich außer den Ideen und dem Titel nichts zu diesem Buch beigetragen (vgl. Shepard 1975, 63), und seine theoretischen Überlegungen gingen nach 1964 in eine völlig neue Richtung. Um seine wichtigste Entdeckung, den Weg durch den Engpaß, umfassend im Zusammenhang darstellen zu können, entwickelte Perls 1964 sein Modell von den »Schichten der Neurose«, das Quitmann mit keinem Wort erwähnt.
In seinen letzten Lebensjahren wollte Perls in einem neuen Buch über die Gestalttherapie neben den neurotischen Mechanismen vor allem diese Schichten der Neurose ausführlich beschreiben (vgl. Petzold, in: Perls 1976, 7); er kam nicht mehr dazu. Das zweite Hauptwerk der Gestalttherapie blieb unvollendet. Perls’ letzte theoretische Überlegungen existieren daher nur als unsystematische Skizzen (Perls 1976; Perls u. Baumgardner 1990).
Wir beschreiben in diesem Buch unsere Form der Gestalttherapie als eine Weiterentwicklung der Perlsschen Spätform. Um die einzelnen von uns gemachten Entwicklungsschritte nachvollziehen zu können, ist es wichtig, zunächst die Entstehung der klassischen Gestalttherapie von ihrem Anfang an zu kennen – eine Entwicklung, die, wie gesagt, eng mit dem persönlichen Leben von Fritz Perls verbunden ist.
1. Die Lehrzeit in Deutschland
Nach zwei Mädchen wird Fritz Perls am 8. 7 1893 als das dritte Kind jüdischer Eltern in Berlin geboren. Er erinnert sich an viel Streit der Eltern in seiner Kindheit; den Vater haßt er sein Leben lang, gegen die besitzergreifende Mutter wehrt er sich, so gut er kann. Schon früh sucht er Kontakte außerhalb der Familie.
Er ist als Heranwachsender fasziniert von Max Reinhardt, dem damaligen Leiter des Deutschen Theaters in Berlin (»the first creative genius I ever met« – in: Shepard 1975, 22). Er entdeckt hier die vielfältigen Aspekte des nonverbalen Ausdrucks und der Körpersprache. Max Reinhardt achtet bei der Ausbildung seiner Schauspieler sehr auf die Kongruenz von verbalem und nonverbalem Ausdruck zur Steigerung der schauspielerischen Leistung. Für Perls wird dies zu einer exzellenten Schulung seiner Wahrnehmung von Inkongruenzen zwischen dem was jemand sagt und wie er es sagt – eine seiner stärksten Fähigkeiten in seiner späteren Arbeit als Therapeut.
Die Schule interessiert ihn nur am Rande; er macht sein Abitur und studiert in Berlin Medizin. Das Studium wird unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg. Perls meldet sich 1916 freiwillig zur Armee, kommt nach Belgien an die Front und entgeht nur knapp dem Tod; bei einem Gasangriff wird er verwundet. Um die Erfahrung der Sinnlosigkeit des Krieges reicher, nimmt Perls 1919 sein Medizinstudium wieder auf, geht für ein Semester nach Freiburg und macht 1920 sein Examen in Berlin. 1921 promoviert er und eröffnet eine Praxis als Psychiater und Neurologe.
Privat hat er Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern der Bauhaus-Gruppe und zur politischen Linken (»Wir Narren glaubten, wir könnten eine neue Welt aufbauen ohne Krieg« – 1981, 55). Er begegnet dem Philosophen Salomo Friedlaender, der 1918 sein Werk »Schöpferische Indifferenz« veröffentlicht hatte. Darin entwickelt dieser – in der Tradition von Hegel und Marx – eine neue Spielart der Dialektik: Alles existiert in Gegensätzen. Das Eine ist nicht ohne sein Anderes zu bestimmen; beide haben einen gemeinsamen Ursprung, aus dem heraus sie sich differenzieren und sich dann als Polaritäten gegenüberstehen. Ihr gemeinsamer Ursprung ist die »Indifferenz«, ein »Nichts an Differenziertheit«. Da sich aus diesem Nullpunkt heraus die Gegensätze entwickeln, dieser also ein kreatives Potential darstellt, nennt Friedlaender ihn »schöpferische Indifferenz« (vgl. Frambach 1993, 41ff., u. 1996).
Die Erkenntnis, daß nichts so viel miteinander zu tun hat wie Gegensätze, daß also Gegensätze eine Einheit bilden, indem sie sich gegenseitig bedingen, voneinander leben, einen inneren funktionalen Zusammenhang bilden, ist für Perls revolutionär. Er hatte im bisherigen Verlauf seines Lebens die verschiedensten philosophischen Ideen und Konzepte in sich aufgenommen und war in einem geistigen Wirrwarr gelandet. Seine Versuche, dieses Durcheinander durch die Auflösung der Widersprüche zu ordnen, war gescheitert. Jetzt lernt er von Friedlaender, die Existenz von Widersprüchen als natürlich gegeben zu akzeptieren und sie sogar als das eigentliche Ordnungsprinzip zu benutzen. Das verhilft ihm zu neuer kognitiver Klarheit und gibt ihm dauerhafte Orientierung in einer Welt voller Widersprüche.
Noch 49 Jahre später würdigt er Friedlaender: »Als Persönlichkeit war er der erste Mann, in dessen Gegenwart ich mich niedrig fühlte und in Bewunderung verneigte. Es gab keinen Raum für meine chronische Arroganz« (1981, 79), und dokumentiert, daß das »Denken in Gegensätzen«, das er von Friedlaender lernte, noch immer sein Denken bestimmt: »Was immer ist, differenziert sich in Gegensätze. Wenn ihr euch von einer der entgegengesetzten Kräfte einfangen laßt, sitzt ihr in der Falle oder verliert zumindest das Gleichgewicht. Wenn ihr im Nichts des Nullpunktes bleibt, bewahrt ihr die Balance und Perspektive. Später wurde mir klar, daß dies das wesentliche Äquivalent zur Lehre Lao-tses ist« (a.a.O., 80).
So ist Friedlaenders Philosophie für Perls auch die »… erste Begegnung mit dem Nichts im philosophischen Bereich« (a.a.O., 73) – das Nichts in der Gestalt des Nullpunkts zwischen zwei Gegensätzen. Dieses neue Verständnis von Nichts als einem kreativen Potential, als der Anfang und das Ende von Gegensätzen, wird für Perls eine wichtige Voraussetzung für seine erst viele Jahre später erfolgende Entdeckung des Engpasses.
Perls wird nämlich später der erste Therapeut sein, der Klientinnen und Klienten auch an dieser Stelle ihres Prozesses ermutigt, bei dem zu bleiben und das wahrzunehmen, was in diesem Moment passiert. Und er kann das später nur tun mit dem Wissen, daß die häufige Aussage von Klienten an diesem Punkt (»Nichts«) deren angemessene Beschreibung für das ist, was sie gerade in sich erleben. Dieses »Nichts« ist also etwas – ein Etwas, das genau den kreativen Punkt in jedem Klienten beschreibt, an dem er beginnt, die inneren Gegensätze seines Konfliktes aufzulösen. Dieses Wissen macht es Perls später möglich, seinen Klienten den Weg aus ihren Konflikten heraus und durch dieses Nichts hindurch zu zeigen und sie dabei zu begleiten.
Perls ist von Friedlaenders Denken in Gegensätzen begeistert. Er erkennt in diesem »differenzierenden (oder differentiellen) Denken« eine neue Möglichkeit, die innerpsychischen Vorgänge des Menschen angemessener zu verstehen, als das mit dem bis dahin üblichen kausalen Denken (Ursache-Wirkung) möglich war. Hegels Dialektik, ein Versuch, das Weltgeschehen umfassend zu verstehen, wurde so, vermittelt durch Friedlaender, von Perls für das Verständnis der inneren Welt des Menschen fruchtbar gemacht (vgl. Stewart 1974, 14).
Perls übt sich in der »Kunst des Polarisierens« (1978, 23) und beginnt mit dem Studium der Schriften von Sigmund Freud. Da Freud im wesentlichen noch dem naturwissenschaftlichen Denken der damaligen Zeit verhaftet war, kommt Perls von Anfang an in eine kritische, spannungsvolle Distanz zu ihm. Trotzdem hat auch Freuds Psychoanalyse (»das erste System einer wirklichen strukturellen Psychologie« – Perls 1978, 17) zunächst einen ordnenden und klärenden Einfluß auf Perls. Nach einem Aufenthalt in New York (Oktober 1923 bis April 1924) kehrt er nach Berlin zurück und beginnt 1926 seine psychoanalytische Ausbildung mit einer Therapie bei Karen Horney.
Karen Horney, später eine der führenden Vertreterinnen der »Neopsychoanalyse« in Amerika, hatte schon damals begonnen, im Rahmen der Psychoanalyse eigene Wege zu gehen (vgl. Horney 1939). Sie hilft Perls aus seiner emotionalen Verwirrung, die aktuell ausgelöst worden ist durch Kontaktprobleme in seiner ersten längeren Beziehung mit einer Frau. Auf Horneys Rat hin trennt sich Perls von dieser Frau, verläßt Berlin, geht 1926 nach Frankfurt und setzt dort seine Analyse bei Clara Happel, einer Schülerin von Karen Horney, fort.
Ein wesentlicher Teil dieser Therapie besteht in der Bearbeitung seiner von den Eltern und der Gesellschaft übernommenen Wertvorstellungen und dem Finden eigener Werte. Für Perls selbst überraschend erklärte ihn Clara Happel nach einem Jahr für »komplexfrei« und empfiehlt ihm, seine analytische Ausbildung jetzt in Form von Kontrollanalysen fortzusetzen.
Beruflich arbeitet Perls in Frankfurt am Institut für hirnverletzte Soldaten. Er ist Assistent von Kurt Goldstein und lernt bei ihm die damals neueste Strömung der Psychologie kennen, die Gestaltpsychologie.
Die Psychologie, damals noch eine junge Wissenschaft, hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Philosophie abgegrenzt und sich zu einer eigenen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Das war jedoch nur möglich durch die Übernahme des damals vorherrschenden naturwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnisses. Vor allem von Wilhelm Wundt – die Gründung seines Psychologischen Instituts an der Universität Leipzig 1879 gilt als offizielle Geburtsstunde der modernen Psychologie – war die Psychologie zu einer naturwissenschaftlich orientierten Disziplin (»physiologische Psychologie«) geformt worden.
Man erforschte nach physikalischem Vorbild die Sinnesphysiologie der Wahrnehmung. Die grundlegende Annahme dieser Forschung war, daß das Seelische aus einzelnen diskreten Elementen besteht, die isoliert voneinander existieren. Um die Jahrhundertwende waren gegen diese Auffassung vom Wesen des Seelischen zunehmend mehr Einwände erhoben worden. In leidenschaftlichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen wurde die »Elementenpsychologie« schließlich korrigiert und durch eine Sichtweise ersetzt, die den Zusammenhang des seelischen Erlebens hervorhob. Mit zwei Begriffen wurde dieser Zusammenhang von den Forschungsgruppen um Felix Krüger bzw. Max Wertheimer beschrieben: »Ganzheit« und »Gestalt«.
Beide Begriffe meinen im wesentlichen das gleiche: Einzelne Elemente bilden zusammen immer ein Ganzes, eine Gestalt. Dieses Ganze ist mehr als die bloße Summe seiner Teile. Es ist wesensbestimmend für die es konstituierenden Elemente und wahrnehmungsmäßig vorrangig: Drei Punkte werden z. B. in der Regel zunächst als Dreieck und erst dann als einzelne Punkte gesehen.
Krüger ging es mehr um die »psychische Ganzheit«, also in Abgrenzung zur Elementenpsychologie darum, daß das Seelische in sich eine Einheit bildet; die Trennung von Seele und Körper wurde nicht in Frage gestellt. Die Gestaltpsychologen zielten dagegen auf eine Einheit der ganzen Person ab, auf den Zusammenhang von Seele, Körper und Geist. Mit dem Begriff des »Organismus« versuchte Kurt Goldstein diesen Zusammenhang zu beschreiben; er kennzeichnete so den Organismus als unteilbare Ganzheit von Körper, Seele und Geist (vgl. Goldstein 1934 u. 1974). Wie wir im einzelnen noch sehen werden, bleibt diese Grundidee, daß der Mensch ein ganzheitlicher Organismus ist, für Perls’ Verständnis von Neurose und Therapie von da an bestimmend.
Bezeichnenderweise wurden viele der Ganzheitspsychologen um Felix Krüger (»Leipziger Schule«) später aktive Nationalsozialisten, die die Ideologie der Nazis wissenschaftlich untermauerten, indem sie den Vorrang des Volksganzen gegenüber dem einzelnen Individuum propagierten. Die Gestaltpsychologen (»Berliner Schule«) kamen dagegen zu ganz anderen politischen Überzeugungen; sie betonten mehr den Wert und die Einzigartigkeit des Individuums, der unteilbaren Person; sie emigrierten 1933 fast ausnahmslos in die Vereinigten Staaten.
Kurt Goldstein, bei dem Perls nun arbeitete, erforschte in Frankfurt Aphasien bei Hirnverletzten auf der neuen wissenschaftlichen Grundlage seiner ganzheitlichen Auffassung der Gehirnvorgänge. Dabei interessierte er sich u. a. für die gehirnphysiologischen Korrelate des Gestaltbildungsprozesses, der sogenannten »Aktualgenese«: Alle Gestalten durchlaufen unter geeigneten Bedingungen eine Entwicklung von diffusen Vorgestalten zu prägnanten, klar gegliederten Endgestalten (vgl. auch Votsmeier 1995).
Perls ist tief beeindruckt von diesen neuen psychologischen Sichtweisen und Erkenntnissen. Parallel zu der persönlichen Neuorientierung im Rahmen seiner Therapie bei Clara Happel lernt er von Goldstein eine neue Art, wissenschaftlich zu denken, die sich für ihn gut mit dem von Friedlaender gelernten differentiellen Denken verbinden läßt. (»Die Absolutheit der Reiz-Reaktions-Theorie wurde von Kurt Goldstein über Bord geworfen.« – Perls 1981, 39) Freud gehört für ihn zu den Elementenpsychologen, genauer zu der alten »Assoziationspsychologie«, die die Seele als eigenständiges Wesen vom Körper abtrennte und sie dann noch in einzelne Instanzen zerteilte. So kommt Perls auch in dieser Hinsicht in kritische Distanz zur klassischen Psychoanalyse.
Ebenfalls um die Jahrhundertwende wurd...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Zur Künstlerin des Covers: Georgia von Schlieffen
- Vorwort zur Neuausgabe
- Einleitung
- 1. Kapitel: Fritz Perls und die Entwicklung der Gestalttherapie
- 2. Kapitel: Das Erbe der klassischen Gestalttherapie – eine kritische Aufarbeitung zentraler Konzepte
- 3. Kapitel: Die Struktur des Veränderungsprozesses
- 4. Kapitel: Ganzheitliche Veränderung als Wandel von Gestaltqualitäten
- 5. Kapitel: Die Aufgabe des Therapeuten
- Quellenverzeichnis
- Edition der Gestalt-Institute Köln & Kassel (GIK) im Hammer Verlag hg. v. Erhard Doubrawa
- Weitere Informationen
- Praxisadressen
- Impressum