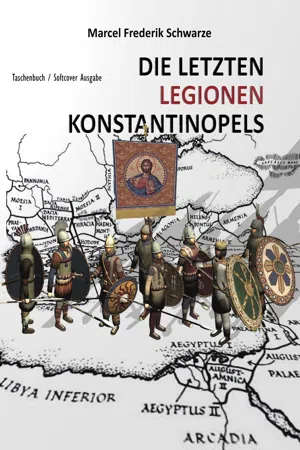![]()
DIE ORGANISATION DES RÖMERHEERES
![]()
Limitanei – das Grenzheer.
Die gesamte Armee der früheren Kaiserzeit, mit Ausnahme der Garde wie den Prätorianern oder den equites singulares, stand an der Grenze des Reiches. Es ist dies der Hauptgrund, weshalb sich der Begriff eines ständigen in Garnisonen festliegenden (Cod. Theod. 8.5.33 §1), nur zu Verteidigungszwecken verwandten Grenzheeres erst entwickeln konnte, als das Feldheer geschaffen wurde. Eine neue Bezeichnung schien also erst in dem Moment sinnvoll, als das Feldheer zahlenmäßig mit dem Grenzheer konkurrieren konnte, doch scheint dies erst unter dem großen Konstantin der Fall gewesen zu sein.
Schon in älterer Zeit hatte man den Garnisonen verschiedentlich Landgüter zugewiesen, zunächst zu Bauzwecken, später als Weide-, Garten- und Ackerland (Tacitus, Annales 13.54). Dieses Land gehörte aber, im Gegensatz zur späteren Zeit, dem Truppenteil, nicht aber einzelnen Personen. Noch um 400 n. Chr. erscheinen die Soldaten der kleinen Kastelle an den Grenzen (burgi) als juristische Personen, die somit Grundeigentum besitzen konnten (Cod. Theod. 12.19.2). Als nun die einzelnen Truppenteile sesshaft wurden und ihre Standorte nicht mehr verließen, wurden offenbar die einzelnen Landparzellen aufgeteilt. Die Entwicklung erscheint aber eher im Westen begonnen zu haben. Von Wehrbauern oder einer klassischen Landwehr kann selbst bis ins 6. Jahrhundert keine Rede sein. Bis ins eben erwähnte Jahrhundert und darüber hinaus erscheinen Grenztruppen regionalbedingt äußerst vital und lebendig. Die Vita des Alexander Severus (58.4) schreibt diese Einführung des neuen Systems einer überholten Grenzverteidigung diesem Kaiser zu, doch stammt sie von einem späteren Zeitpunkt, wie dies schon anhand der Erwähnung der limitanei duces (Frontkommandeure) ersichtlich wird. Ähnliche Anweisung kennen wir von Probus in Isaurien und von den Kaisern des 5. Jahrhunderts (Historia Augusta, Probus 16.6), die uns durch den Codex Iustinianus überliefert wurden (Cod. Iust. 11.60.3). Daher wird man hier eher das 4. Jahrhundert im Blick gehabt haben. Unbestreitbar ist aber, dass diese Entwicklung schon vor dem 4. Jahrhundert begonnen wurde, ein schleichender Prozess der von allen späteren Kaisern folglich stillschweigend fortgeführt wurde. Tatsächlich nennen spätere Verordnungen diese Entwicklung eine »althergebrachte Gewohnheit« (Cod. Theod. 7.15.1 von 409 n. Chr.). Von nun an heißen die Ländereien der Grenzer fundi limitotrophi (Cod. Iust. 11.60, 59) und die Ländereien erhalten sie nur als Entgelt für deren Verteidigung. Unter der Bedingung, dass ihre Kinder im waffenfähigen Alter von achtzehn Jahren ebenfalls dienten, konnten diese Ländereien auch an diese weitergegeben werden (Historia Augusta, Vita Probus 16.6). Diese Ländereien waren steuerfrei (Nov. Theod. 24.4) und standen außerhalb der städtischen Gemeinde. Der Truppenführer, wohl der tribunus (Tribun), vertrat wohl den Gemeindevorstand.
Wir werden später bei der Einführung der Themenordnung feststellen, dass das System im Grunde bis in die spätbyzantinische Zeit grundsätzlich erhalten blieb und nur noch ausgebaut wurde, aber nicht etwas gänzlich Neues darstellte. Die wohl frühesten Bezeichnungen unserer Grenzsoldaten waren ripenses oder riparienses (Cod. Theod. 7.20.4 aus dem Jahr 365). Noch im 4. Jahrhundert kam die Bezeichnung limitanei auf, die sich jedoch erst im späten fünften etablieren sollte und im sechsten durchgehend Gültigkeit besaß (u.a. Cod. Theod. 12.1.56 aus dem Jahr 363). Da ripariensis per Definition eher an den Flussläufen stationiert sein mussten und limitanei auch häufig eher im Innland anzutreffen sind, scheint eine Übersetzung mit Besatzungsheer sinnvoller. Das Stabsquartier war das fossatum, die Soldaten waren in den castra oder castella verteilt (Cod. Iust. 1.27.2 §8), und hießen daher auch castriciani, castellani, castriani oder castresiani. Jeder Lager- bzw. Kastellsoldat war ein Grenzer, aber nicht umgekehrt, da einige Truppenteile in Ortschaften lagen. Nach dem Codex Iustinianus waren die limitanei per castra et loca verteilt. Nicht selten führen sie auch den Beinamen duciani, da diese nicht den magistri militum unterstanden, sondern den duces (Frontkommandeuren) der Grenzregionen (Nov. Theod. 4 §1 aus dem Jahr 438). In den castella (Kleinfestung) und burgii (befestigte Höfe oder Türme) durften offenbar auch die Familien der Besatzung wohnen, nur bei Posten die weit vorgeschoben nahe dem Feind lagen, war dies ausdrücklich verboten (Gorippus, Ioannis 3.326). Nicht zuletzt durch die ständige Veränderung des Heeres und der gelegentlichen Versetzung von Grenztruppen ins mobile Feldheer, erfahren die Grenzer eine langsame, aber stetige Herabsetzung. Allerdings ist auch dies im Kontext der Zeit und nach örtlichen Gegebenheiten zu untersuchen. A priori ist an eine generelle Herabstufung bei den Grenztruppen nicht zu denken – wie dies allein schon anhand der in Ägypten stationierten Truppen des 6. Jahrhunderts sichtbar wird. Eine Verordnung von 372 besagt ausdrücklich, dass bei dem Grenzheere diejenigen Leute eintreten sollen, denen es an Körperkraft und Größe fehle um im Feldheer den Dienst zu verrichten (Cod. Theod. 7.22.8). Allerdings ist dies kein Indiz dafür, dass dies auch in den folgenden zwei Jahrhunderten zu jedem Zeitpunkt galt und auch tatsächlich zum späteren Zeitpunkt Anwendung fand. Unvergessen bleibt hier der große Bedarf an Truppen im Verlaufe des späten vierten und frühen 5. Jahrhundert – ein Umstand den das Ostreich zur Zeit des Anastasius und Justinians nicht in dem Maße zu beklagen hatte. Sicher ist hingegen, dass der Dienst im Feldheer zwanzig Jahre betrug, der des Grenzheeres hingegen immerhin vierundzwanzig Jahre und nur in Ausnahmefällen wurde ein früherer Abschied gewährt (Cod. Theod. 7.20.4 §2 und §3 aus dem Jahr 325). Da die Vorschrift in den Codex Iustinianus eingeflossen ist, galten diese Dienstzeiten noch mindestens bis ins 6. Jahrhundert.
Der Historiker Procopius tadelt Justinian scharf wenn er sagt, der Kaiser sei den Grenztruppen ihren Sold für vier oder fünf Jahre schuldig geblieben und habe ihnen den soldatischen Charakter entzogen (hist. Arc 24.13). Doch sind diese Angaben so allgemein wie schwammig formuliert und bezogen sich möglicherweise nicht auf das gesamte Reich. Demgegenüber steht die lange Fortdauer und Langlebigkeit der limitanei, auch ließ Justinian gleich nach der Eroberung Afrikas selbige wieder sofort aufstellen und hob die Bedeutung dieser Truppe hervor (Cod. Iust. 1.27.2 §8). Die Truppen des Grenzheeres bestanden gemäß der Notitia dignitatum aus Legionen, Auxilien und Kohorten. Hinzu kommen die zahlreichen unbestimmbaren milites. Aus dem Bereich der Kavallerie finden wir hier cunei, equites und alae, sowie verschiedene Flotten. Kommandiert wurden die limitanei von den duces der Grenzabschnitte, in kleineren Verteidigungsbezirken von einem praefectus oderpraepositus. Im späten fünften sowie durch gehend im 6. Jahrhundert werden die limitanei an verschiedenen Orten des Reiches häufig erwähnt.
Das palatinische Feldheer.
Die palatini waren keine Truppengattung, sondern eine bevorzugte Gruppe der comitatenses – also der regulären mobilen Streitkräfte des Feldheeres. Ihre Geschichte beginnt ganz sicher mit der Etablierung des bei Rom stationierten Heeres, im Kern bestehend aus den Prätorianern und der legio II Parthica, aber auch vermehrt aus Abteilungen anderer Einheiten. Hier stellt nicht zuletzt das Jahr 260 n. Chr. eine Zäsur dar, fand zu diesem Zeitpunkt die Abspaltung der lanciarii der II. parthischen Legion statt, dessen einzelne Abteilungen nun Teil der bereits vorhandenen, aber sich verändernden mobilen Feldarmee wurden. Diese Abteilungen sollten fortan die Basis eines neuen numerus der tetrarchischen Zeit bilden (CIL VI 2787). Aus heutiger Sicht wird von vielen Historikern angenommen, dass jede Legion über eine Abteilung dieser lanciarii verfügen konnte, und dies keine Besonderheit der parthischen Legion war. In der Rangordnung finden sich die lanciarii über den regulären Legionen, aber unterhalb der Prätorianer wieder. Später werden Teile dieser lanciarii den Kern weiterer palatinischer Legionen in der Spätantike bilden, insbesondere im Osten des Reiches. Die legio II Parthica blieb während der Herrschaft des Aurelianus noch immer in Albanum stationiert, was ihr auch den Titel Aureliana einbrachte (AE 1975, 171), letzteres eine Titulatur sehr seltener Art und von nur begrenztem Vorkommen, was darauf hinweist, dass diese Legion noch immer vom Kaiser hochgeschätzt und von zentraler Bedeutung der Machterhaltung war. Eine Abteilung der regulären Infanterie der legio II Parthica bildete den comitatus (persönliches Gefolge, Begleitung) Aurelians. Dennoch wurde die legio II Parthica zunehmend von den neuen Legionen aus der Zeit Kaiser Diokletians, den Ioviani und Herculiani, verdrängt. Vielleicht war es auch die parthische Legion, die Abteilungen diesen neuen Einheiten zuführte (Aur. Victor Caes. 39.25).
Der römische Schreiber Ammianus (Res gestae 20.7) liefert einen Anhaltspunkt, der uns dazu veranlasst an ein Kavalleriekontingent innerhalb der Herculiani zu glauben, was auch epigraphisch untermauert werden kann (ILS 2781). Die Einsatzreserve des Gallienus (260 bis 268 alleiniger Herrscher des Reiches), dies waren eben alle kaisernahen Truppen die nicht mit der Verteidigung eines festen Grenzabschnittes vertraut waren, bildete sicherlich die Garnison in Rom. Dazu gehörten unter anderem die Prätorianer und die berittenen Equites Singulares, dazu die parthische Legion und einige weitere kleinere Kontingente. Diese Einheiten stellen einen Teil der Feldarmee dar, die sich in ständiger Bereitschaft befanden um auf barbarische Einfälle oder interne Revolten reagieren zu können. Dennoch war es vor allem Gallienus der noch immer auf die traditionellen Vexillationen zurückgriff. Dies waren die abgezogenen Abteilungen von den an den Grenzen stehenden Ein...