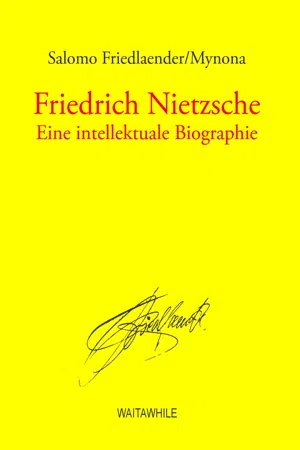![]()
Dieses Buch über Friedrich Nietzsche gibt nur das Werden seines philosophischen Geistes zu verstehen, und zwar aus einem Augenpunkte, den man nicht verlassen kann, ohne die Orientierung zu verwirren, wo nicht gar zu verlieren. Es empfiehlt sich also, damit der Leser ihn einnehmen könne, diesen Punkt von vornherein zu bestimmen. Man pflegt die astronomische Perspektive, die sich uns von der Erde aus darbietet, zu entwirren, indem man das Auge in die Sonne einsetzt; wie wohl auch damit wegen der unübersehbaren Unendlichkeit des Himmelraumes nur eine sehr relative Korrektur gewonnen ist. Inzwischen ist die logische Unendlichkeit, welcher Nietzsche wie jeder wahrhafte Philosoph eine Orientierung abgewinnen will, so viel bedeutsamer und reicher als die räumliche, daß man Unmögliches zu begehren scheint, wenn man dennoch auch in ihr auf keinen präzisen Gesichtspunkt verzichtet. Und um einen solchen zu finden und endlich einzunehmen, wird es erfordert, daß man erstlich diesen Gedanken Unendlich so weit und metaphorisch fasse wie nur irgend möglich; aber daß man sodann diese enorme Expansion bis in das selbsteigene Erlebnis zurückverfolge; ähnlich wie Kant ein verbindendes Pathos zwischen dem gestirnten Himmel und dem moralischen Gesetze obwalten ließ.
Wir werden alle Ringe der Beschränktheit sprengen müssen, wir werden auch den unendlichen Raum, die unaufhörliche Zeit nur als engere Befangenheiten, an der logischen Unendlichkeit gemessen, aufzufassen haben; die gesamte Sternenhimmelwelt wird uns zu einer Geringfügigkeit einschrumpfen sollen, verglichen mit der Gewalt dieses infinitesimalen Erlebnisses, welches das Geheimnis unseres eigensten Wesens unaussprechlich mächtig offenbart. Ohne dieses Erlebnis des über alle Grenzen hinaus bis zum Wahnsinn und zur Unmöglichkeit getriebenen eigenen Wesens, ohne dieses dithyrambische Unermeßlichkeitsgefühl, ohne Freiheit im unendlichen, also der Aufklärung so sehr bedürfenden Verstande haben wir kein Motiv zur Philosophie: als zur Autobiographie der Welt. Jede Abspannung dieser Tendenz wird schließlich die Energie des Lebens erschlaffen lassen. Und selbst, wenn es nie gelänge, das Rätsel dieses enormen Postulates zu lösen, so müßte man es lieber ungelöst bestehen lassen, anstatt daß man sich, aus Verlegenheit frech werdend, mit einem flachen Tageslicht über diese Nacht verblende: Aller Realismus ohne dieses ens realissimum der ureigensten Infinitesimalität ist Selbstbetrug.
Allein der Empiriker dieses Erlebnisses – und vielleicht ist dieses die Definition der Menschheit? – findet sich allenthalben pathologisch gehemmt, beeinträchtigt, ja vernichtet. Es wird die Aspiration, mit der er in die Erfahrung tritt, in dieser dermaßen beschädigt, gekränkt, erstickt, daß er das Trachten seines Lebens oder das Leben aufgeben muß, wenn ihm kein Bund zwischen beidem gelingt. Nun gar der Widerstreit zwischen dem aller Schranken spottenden Selbste, das man innen tief bei sich unertötbar erlebt, und dem winzigen empirischen, ist so tötlich, daß auch das glücklichste Leben sich an ihm verbluten wird. – Aber was ist denn das: Erfahrung? Offenbar erfährt das immense Wesen sich selbst, es erfährt notwendigerweise seinen embarras de richesse – nemo contra deum nisi deus ipse.
Faßt man das eigene Wesen infinitesimal – d. h. philosophisch –, so wird man dessen gesamter Pathologie als solcher des Unendlichen selber inne, die antinomische Resignation des Geistes vor der Unendlichkeit wird zur Antinomie der Unendlichkeit selber. Der Weg, den Kant geht, ist nur ein Umschweif und Ausweg, eine Verschnörkelung und Verblümung, ein logisches Arabeskenwerk zur langsamsten Propädeutik auf diese Idee der Ideen. Diese göttliche, freie, ewige, schöpferische Idee illuminiert bei Kant durchaus die ärmliche Tatsache „Mensch“: formal, heuristisch, regulativ, lediglich postuliert wirksam, verwandelt sie dennoch den Menschen in eine Art sordinierten Gott: sie riß im eigenen Ich das Pathos der Distanz auf; eine wahre Jakobsleiter von logischen Stufenfolgen verband und trennte Gott und Menschen. Wenn man sogleich darauf mit dieser ungemeinen praktischen Ermutigung – trotz aller Proteste Kants – auch wieder theoretisch groß tun wollte, sei es positivistisch, sei es nihilistisch, so hätte man doch nicht, wie es leider geschah, diese unermeßliche Entfernung zwischen der Idee und der Empirie dogmatisch eskamotieren sollen –: hier war ein besonneneres Verfahren einzuleiten. Der unausbleiblich infinitesimale Charakter der Welt verträgt weder eine dilatorische, noch eine endgültig abfertigende Behandlung; obgleich wohl beide Manieren bei aller Fruchtlosigkeit wegen der Echtheit ihrer Keime versprechend scheinen.
Die kritische sowie die vor- und nachkritische dogmatisch-metaphysische Methode werden bei Nietzsche abgelöst durch die historische und zwar ausgezeichneterweise ohne die geringste Rücksicht auf irgendwelche Festgestelltheiten, mit einer vernichtenden Kraft also, die mit der gleichen Energie zur schöpferischen Bereitschaft stand und offenbar naiv aus dem Vollen, aus dem Unendlichen schöpft. Nietzsches historisches Philosophieren ist wie das Heraklits original und exzellent durch den Lebensiktus, der es mit aller Schicksalsschwere durchwuchtet: es ist göttlich; lange nicht mehr im hergebrachten dogmatischen Sinne, den die Kritik nicht etwa beseitigt, sondern bloß behutsamer artikuliert hatte: Nietzsches Gott ist der Gott, welcher sich selber probiert, das Wagnis der Wagnisse, das Abenteuer des Lebens, die Gefahr in Person, ein Blitz, mit dem der Mensch geimpft werden soll. Statt aller intelligibeln Garantien Kants ist nur noch diejenige durch das Experiment übrig geblieben. Folglich mußte der accent grave des Wertes auf alles gesetzt werden, was von Güte boshaft genannt wird, auf den Willen zur Überwältigung, zur Macht; zum Gegenteil der Verneinung des Lebens: wodurch diese nicht abgeschafft, aber „umgewertet“ wurde, das contra des positiven Wortes darstellte –: Nietzsches Umwertung!
Die Muskelgewalt dieser kosmischen Geste ist immer noch innerviert vom alten Wahren; von der unendlichen Idee, welche, durch die skeptischste Kritik der historischen Methode tollkühn gemacht, die Realität wie ein Tiger mit einer noch nie dagewesenen Furchtbarkeit anspringt und verschlingen will. Sie will nicht länger ihren gespenstischen Vampyrismus treiben, nicht mehr mit einer Scheinnahrung abgespeist sein, sie will den Menschen, sie entwickelt einen sublimen Kannibalismus, einen Blutdurst nach Realien.
Durch ein Schirm-, Sperr- und Schleusensystem von kompliziertester Retardation hatte Kant Idee und Realität kritisch besonnen distanziert, welche Distanz bei Schopenhauer in eine Alternative zerbricht. Nietzsche läßt diese Distanz, diese Alternative nicht bloß bestehen, sondern macht sie geradezu exorbitant: aber den Wertakzent verlegt er von der Idee auf die Realität, so daß die gesamte Wertperspektive, wie sie namentlich seit Platon dem Auge eingewöhnt war, sich völlig herumdreht. Es ist der umgekehrte Idealismus in dem Grade, daß das Kantische Noumenon jetzt beschämt, geschändet und verlogen vor dem göttlichen Phänomenon vergeht. Zufälle z. B. erhalten die ganze Würde und Gewalt der divinen Prädestination, so daß auch die Teleologie sich in ihr Gegenteil umkehrt. Geschätzt also wird hier immer noch mit der uralten idealistischen Energie das „nächste“ Ding statt der „letzten“. Die Wertung hat ihr Objekt gewechselt, umgekehrt, nicht aber ihre Intensität eingebüßt – im Gegenteil war diese noch niemals dermaßen angespannt worden. Man erinnert sich, welche sonnenhafte Gewalt des Austrocknens, Ausdörrens, Abbleichens aller Realien bei Platon die Idee vollzieht. Umgekehrt saugt bei Nietzsche auch das geringfügigste Sinnending, das Zittern eines Blumenblattes, das volle Sonnenbrennen der Idee in sich ein, bis von der Idee keine „Idee“ mehr übrig bleibt; wie sehr meint dieses Kant, der Theoretiker – und wie sehr scheut eben dieses der Kant der praktischen Vernunft! Hier eben legt Nietzsche die höhere Moralität der ehrlichen Skepsis auch gegen die Moral an den Tag. Er er- und verlangt von der Moral die Ehrfurcht vor der nackten Wirklichkeit – und sei dieses die Ehrfurcht Gottes vor dem Teufel.
Der Wert aller Werte, die Idee aller Ideen, Gott, wenn man will, ist von Nietzsche nicht entwertet, entgottet, desidealisiert; sondern verweltlicht worden – es ist das Gegenstück zum Pantheismus. Ja, diese Idee dringt nun endlich – als amor nicht mehr dei, sondern fati – in das Leben, in die Physis ein, und nun kommt hierdurch erst unsere Natur zum echten Vorschein, da diese Sonne, keinen weltfremden Thron mehr einnehmend, ihr selbst innewohnt. Sonst war es immer mit der Gefahr der Plattheit verbunden gewesen, profan zu werden. Und so hat auch Kant seine theoretische Profanierung praktisch wieder sakrosankt machen zu müssen geglaubt. Auch Kant hat nicht vermocht, ohne Rückhalt allen Wert auf Erden recht heimisch zu machen. Denn bloß darum kann es sich bei Profanationen handeln! Denn der Wert gehört nun einmal mitten in die Realität hinein.
Ohne Wert wäre die Realität irreal. Und eben wegen dieses Erlebnisses ihres Wertes, gleichviel ob man ihn positiv oder negativ ausschlagen ließ, ist es den Erlebern so schwer geworden, die Realität unphantastisch zu erleben! Alle diese Phantasmen, diese so mächtigen, so verhängnisvollen, so handgreiflich irrealen Mächte sind die Symptome von Werterkrankungen, Wertverzerrungen, -Entstellungen, – Disproportionen der Realität. Man sehe, wie z. B. Schopenhauer den ganzen Schlagschatten dieser Wertsonne als eine wahre Weltennacht über unser Leben wirft: unfähig, sein Werterlebnis, ohne es zu zerreißen, zu antithetisieren, in der Welt unterzubringen – so wertvoll ist das Dasein, daß es vor Weltwonne, welche wie Weltschmerz wehtut, zerspringt! Es ist auch dieses die Phlegmatik oder Brutalität der Positivisten, daß sie diesen Gott des Wertes nicht verweltlichen, ohne ihn am Werte zu beschneiden. Sollte das nicht gelingen: der Welt alle Ehren des Wertes zu geben, ohne in Superstition zu verfallen? Es ist nötig, den Doppelsinn des Wertes, dessen minus und plus, dessen Richtungsunterschied in alle Welt hineinzuverstehen, zu erleben, um in keine Versuchung zu geraten, das Welt- und Werterlebnis zu disproportionieren. Dieses Erleben der Welt, ihre schätzende Veranschlagung als eines Ungeheuers in jeder erlebbaren Hinsicht, muß es endlich vermögen, die Reziprozität der Extreme fungieren zu lassen, ohne daß der Verband zerreißt oder seine Elastizität einbüßt. Aber damit leitet sich eine andere Schätzung des Infinitesimalen ein.
Der Weltweisheit ist es Not, sich auf das zu besinnen, was aller Reflexion, ja aller Intuition vorauszugehen hat: auf das Wesen des Lebens, welches sowohl im „Subjekte“ wie im „Objekt“, a priori und a posteriori unverkennbar Infinitesimalität an den Tag legt. Bereits diese Termen „Subjekt“ und „Objekt“ sind nichts als plumpe Griffe, das Unendliche zu erfassen, das Beides nicht nur „in Einem“, sondern eben sogar überinnig ist: neutralisch. Alles andere sind Verspätungen; dieses Prinzip des Unendlichen sträubt, seiner Natur nach, sich gegen jede dogmatische Feststellung wie gegen jede skeptische Verflüchtigung, es läßt sich nicht definieren, bloß erleben, es ist lebendig, es äquilibriert seine Definitionen, balanciert Extreme, indifferenziert polare Differenzen. Das Unendliche läßt sich weder zu Anfang noch zu Ende bringen – wohl aber läßt sich einsehen, daß es mit dem Sinnenschein dieser Extreme sein pulsierendes Spiel treibt; rhythmisch, periodisch verfährt, ebbt, flutet. Meine Verlegenheit beim Denken des Unendlichen ist die eigene Verlegenheit des Unendlichen. Es gibt keinerlei ontologische Transzendenz, welche dieser ewigen, rastlosen Problematik ein Ende, einen Anfang machen könnte; nichts ist als das Unendliche, wir sind nicht nur in ihm, wir sind es; und dieses Sein ist notwendigerweise polar!
Diese Überfülle, dieser Exzeß, der sich einen Defekt gebiert, diese Distanz, Differenz, diese gesamte Mikromegalie muß – wohl oder übel! – sich in ein Gleichgewicht, in eine concordia discors zu versetzen ringen. Die Verhaltung des exorbitant innigen Wesens, das wir erleben, wenn auch nicht immer reflektierend, muß, da es weder schlechthin eins noch radikal entzwei werden kann, und demnach sogar weit inniger als eins ist, extrem ausfallen, seine Indifferenz wird polarisiert. Unendlichkeit ist ein Paar, ein Wesen, das nur allzu sehr eins ist, um nicht komparativisch, relativ zu sich selber zu sein: aus Überinnigkeit entzweit; beiläufig symbolisiert sich hieran alle Geschlechtlichkeit des Lebens.
Warum sollte man nicht mindestens in Gedanken – logisch – die monstrose Pathologie unseres Lebens ausheilen? Man imaginiere die eigene Göttlichkeit! Man verwandle sich in die Unendlichkeit, in die Unerschöpflichkeit selber, erlebe das Leben über alle Grenzen hinaus, gerate in denjenigen Zustand, welcher doch vorangehen müßte, damit man vom empirischen, worin man sich befindet, zur Philosophie motiviert werde – so wird man, wofern man nicht etwa diese eingenommene Position eingeschüchtert aufgibt, zur obigen Reflexion verpflichtet sein.
Allerdings aber ist, hier nicht eingeschüchtert zu werden, das machtvollste Selbstgefühl erfordert; Weltgefühl. Die maßlose Entfernung unserer winzigen Person von deren Ideal darf uns nicht verleiten, wie es meistens geschieht, entweder auf diese oder auf jenes zu verzichten; weniger noch, träge Akkommodationen mit beiden vorzunehmen. Sondern diese Extreme haben wir so energisch zu steigern, bis wir ihres Diameters und durch diesen des Zentrums mächtig werden, aus dem der Unterschied ihrer Richtung entspringt; unsere Extreme streiten nicht gegeneinander, sondern um Harmonie.
Diese vereinfachende Schematik des reichen Lebens stellt in urphänomenaler Weise dessen Totalität vor Augen als polar. Unser Verfahren ist zwar empirisch; allein wir treiben Empirie des Unendlichen, d. h. Unendlichkeit treibt Empirie mit Unendlichkeit! Was liegt nicht alles in diesem nüchternen Zeichen ∞: vor allem „Seele“, Leben – aber offenbar ein sich selber immerfort übertreffendes, dessen Unterschiede sich antagonistisch ausspannen; ein machtvoller Prozeß, ein ebenso machtvoller Regreß. Zahl, Raum, Zeit, Sprache, Kraft – alles das unsäglich intrikat, ist im Zeichen ∞ bedeutet und zwar polar. Denn hier ist keine Wahrheit, kein Prinzip, das fix und fertig in einem ontologischen Irgendwo residierte; hier tritt auch nicht nach der radikalen Aufgebung eines solchen Prinzips ein skeptischer Positivismus in sein vermeintliches Recht: sondern das Weltprinzip selber ist in der Diskussion mit sich selbst befindlich. Die gesamte Problematik des Denkens ist nur eine Form der eigenen Problematik des „Wesens“ – und doch ist dieses Wesens Problematik, sein sich selber Befehden, sein Ja gegen Nein, seine Polarität zurückführbar und ableitbar aus dem, was niemals problematisch, was allen Wahrheiten und Zweifeln, aller Affirmation und Negation überlegen ist: aus der überinnigen Wesensidentität aller Differenzierung. Man vergaß in seinem Lebensgefühl dieses hyperbolisch Innige, dieses Geheimnis der enormen Zentralität, welche alle Extreme löst und bindet. Besinnen „wir uns“, – besinnt Unendlichkeit sich auf ihr eigenes Wesen zurück: ist unser Lebensgefühl infinitesimal gewillt; so werden wir lernen, die wesentliche Entzweiung unserer Identität zu harmonisieren; denn Identität ist keine idée fixe, sondern Disziplin.
Sonst mag ein Wesen an sich selbst allgenügsam in erhabener Trägheit seiner wilden Erscheinung zusehen, und der Verstand sich seinen Kopf über das gegenseitige Verhältnis zerbrechen, bis Menschen entweder asketisch fromm oder positivistisch frech geworden sind. Jetzt ist das „Wesen“ so ...