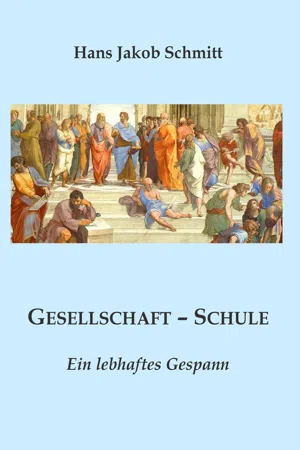![]()
1 EINSTIMMEN
Noch in meiner Jugend galt: „Unsere Kinder sollen es einmal besser haben.“ Schon mein Vater, ein Bauernsohn, erreichte eine qualifizierte Stelle bei der Post. Wie viele aus den meist kinderreichen Familien des kleinen Mittelstandes waren um die Wende zum 20. Jahrhundert „aufgestiegen“? Noch in meiner Jugend hing die öffentliche Meinung an der Stimmung des Zeitalters der Industrialisierung: „Es geht aufwärts! Bewährt euch!“ Und heute? Oft hörte ich schon: „Hoffentlich geht es unseren Kindern nicht einmal schlechter als uns.“
Ihr, meine Enkel, fragt mich: Wie konnte es in unserer Wohlstandsgesellschaft dazu kommen? Wie konnte Hoffnung in Befürchtung und Mißtrauen untereinander umkippen? Laßt mich etwas ausholen!
Wir leben gewiß in einer fortschrittlichen Zeit der Wissenschaften, der Technik, der sozialen Projekte, der neuen Schulorganisationen und des Schulbaus.
Wenn in einem Wingert die Reben wachsen, werden vor dem Auswachsen die stützenden Drähte höhergelegt. In unserer Gegenwart ist durch Umsicht und Engagement Wachstum auf allen Gebieten beachtlich. Aber viele Pflanzen wachsen aus, da die stützenden Drähte nicht höhergelegt, ihrem Wachstum angepaßt werden.
Die Mutter besorgt ihrem Kind einen neuen Anzug, wenn es aus den alten Kleidern herausgewachsen ist.
Zum Schlagwort ist „Vernetzung“ geworden. Die Knoten, die das Netz zusammenhalten, sind fest. So fixieren die dominanten, naturwissenschaftlichen Methoden feste Gegebenheiten innerhalb ihrer Vorgaben, die nicht selbst thematisiert werden. (Darüber schreibe ich ausführlich.) Die Physiker erforschen die Struktur und Wirkung einer Atombombe und bauen sie. Das Zünden ist nicht ihr Thema. Entschuldigt das beängstigende Beispiel! In unserem Alltag erzeugt die naturwissenschaftliche Methode nicht so harsche, aber doch unüberschaubare Wirkungen. Neue Automodelle werden entwickelt – eine Produktion ist eine Sache für sich, davon werden der Verkauf und die Kundenvorlieben streng getrennt. Kann das Ganze auf die Dauer nicht zusammen geordnet werden? Wenn eine „Sache“ nicht erfolgreich, leiden auch die anderen Sachen.
Der Sozialetat ist meist der höchste im kommunalen Haushalt, die soziale Frage wird entschieden in der Bildungspolitik, aber sollte nicht Hilfe auch Hilfe zur Selbsthilfe werden? Der wache Zeitgeist versucht zu korrigieren, der Bedarf wird allein zum Wegweiser. Aber sind Schüler nur Bedarfserfüller für die Wirtschaft? Dort wird doch alles für den Bedarf produziert.
Was ist der eigentliche Grundwert, werdet ihr fragen. In unserer Zeit scheint der Einzelne der erste und letzte Wert zu sein. Da hat Gesellschaft ihren Wert, indem sie den Nutzen aller steigert. Aber, da in unserer Demokratie die Einzelnen sich immer nur befriedigen wollen, was bleibt da außer Verwirrung – und Mißtrauen?
Kein Rebstock wächst aus sich heraus und nur für sich. Jeder Rebstock gedeiht, gestaltet seine Umgebung aus der Geschichte seiner Art heraus und mit den Möglichkeiten seiner Umgebung, „seinem Biotop“. Die Bonität des Bodens, das Klima, die Pflege durch den Winzer verschafft ihm seine jeweils einzigartige Eigenart. Sein Ziel ist es, seine Früchte zu weiterem Leben zu geben. Kurz geschrieben: Er wächst aus seinem Lebensganzen zu seinem Lebensganzen, das ihm seine eigene Art schenkt. Da ist das Ganze nicht lediglich ein Zusammenfügen von Nebeneinander, sondern ist das Ganze, Schöpfungsspannung. Von Schöpfungsspannung spreche ich, die das Ganze zum Anderen erst schafft. Diese Spannung ist so nicht zwischen schon Bestehendem, da sie ja erst Bestehendes erschafft. So kann ich das Ganze nicht feststellend beherrschen, aber mich ihm nähern. Da die gründende schöpferische Spannung unendlich endlich ist, wird das Ganze immer neu gestaltet werden müssen.
Der Beweis – soll mein Buch sein!
Ich spreche von Staat, Gesellschaft, Denkmustern, von der Jugend. Aber diese Bereiche sind nicht nebeneinander, mehr oder minder verbunden, sondern sind erst aus gegenseitiger Hinwendung zu einem Ganzen, aus dem ihr jeweiligen Selbst entsteht.
Helft mir, mein Konzept zu prüfen!
![]()
2 BEREICHE
Im 1. Bereich erinnere ich an die Entwicklungen zu Staat, Gesellschaft, geschichtlichen Spannungen nach der Gründung des 2. Reiches zunächst, dann an die Spannungen, die die Weimarer Republik charakterisieren. Spannungen zu einem ganz neuen Gebilde von Staat und Gesellschaft, dem sogenannten 3. Reich Hitlers, schließlich an die Geschichte nach der Katastrophe 1945 zu unserer Gegenwart.
Im 2. Bereich skizziere ich die Werte und Ziele unserer demokratischen Gesellschaft, die das Ganze unseres Staates und unserer Gesellschaft hervorbringt.
Im 3. Bereich sollen Einflüsse griechischer Philosophen und deutscher Aufklärer auf unsere Jetzt–Zeit zumindest angedeutet werden.
Der 4. Bereich ist Gesellschaft – Jugend gewidmet.
Zu den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft gehört es, das Reifen der Jugend zu fördern, dabei ihre eigene Entwicklung zu achten und so als Gesellschaft sich dann zu rechtfertigen.
Die Jugend wird nicht wie eine Rebe im Glashaus oder als Diener gewöhnlicher Trends zu sich selbst finden, zu ihrem Lebensganzen gedeihen, sondern erst wenn die Hinwendung zum Anderen, zum Ganzen, zu ihrem Selbst werden wird. (Platon sprach von Eros, das Christentum spricht von Agape – Caritas). Mir ist als Nachgeborener so Zuneigung näher als nur Pflichterfüllung.
Wenn Leben anstrengend – was soll‘s? Für den Anderen und das Selbst bedeutet es oft das eigentliche Glück, in einem Lebensganzen aufgehoben zu werden.
Mein Denken hat das Werden selbst, das sogar dem Philosophen Aristoteles in seiner Existenz entging, zum Mittelpunkt werden lassen.
Nicht leicht wird es Euch werden, liebe Enkel, euch meinem neuen Denken hinzuwenden. Mir scheint’s: Nur der Anfang ist schwierig!
Mir bringt mein neues Denken keine Zukunft mehr – euch kann es Zuversicht für eure Zukunft bedeuten.
![]()
3 UNSERE GESELLSCHAFT VON 1871 BIS IN UNSERE GEGENWART
3.1 KAISERREICH VON 1871 – 1918
3.1.1 POLITIK SUCHT SYMBOLE: VERSAILLES
VERSAILLES – SPIEGEL DER MACHT
Versailles wurde zum Machtzentrum Ludwig XIV. König Ludwig XIV. hatte das Jagdschloß von 1661 zur prachtvollsten Schloßanlage Europas erweitert. Die adligen Stände feierten darin die rauschendsten Feste – da konnten sie nicht gegen den König agieren, nicht eigene Politik betreiben. Zugespitzt: Wer feiert, rebelliert nicht.
Der Spiegelsaal des Schlosses von Versailles wurde zur Gründungsstätte des Deutschen Reiches 1871.
Nach dem Sieg des deutschen Koalitions–Heeres über Frankreich unter der Führung Preußens traten bei der Fürstenversammlung im Spiegelsaal zu Versailles Bayern, Württemberg, Baden und Hessen im November 1871 dem Deutschen Bund bei. Am 18. Januar 1871 wurde das Kleindeutsche Reich (ohne Österreich) gegründet. König Wilhelm I. von Preußen wurde von den deutschen Fürsten zum „Deutschen Kaiser“ ausgerufen. (Eine Facette spiegelt die schwierige politische Situation und Atmosphäre im Spiegelsaal wider: „Deutscher Kaiser“ bedeutet, daß der Kaiser Deutscher ist, bezeichnet nicht das Amt.
Auf eine Amtsbezeichnung konnten sich die Fürsten nicht einigen, so stark war der Föderalismus in Deutschland. So gab es kein Reichsheer, lediglich ein Bundesheer, dessen Kontingente jeweils dem Landesherren unterstanden. Eine Reichsmarine wurde allerdings gegründet. Ergebnis: Das Reich bündelte die Macht der Landessouveräne.
DAS NEUE REICH – SEIN AUFSTIEG
In dem neuen deutschen Reich explodierte eine alle Schichten der Gesellschaft mitreißende Zuwendung zum neuen Staat. Vaterländische Vereine wurden gegründet. Meine Mutter erinnerte sich noch an die jährliche Sedans–Brezel und schulfrei am 2. September, dem Tag der Entscheidungsschlacht in Frankreich. Mein Schwiegervater (geboren 1885) hieß – obwohl Schwabe – nach dem preußischen Reichskanzler von Bismarck, dem eigentlichen Gründer des deutschen Reiches, Otto. Das eifersüchtige Gezänk unter den Landesfürsten schien überwunden. Deutschland war durch den Sieg über den „Erzfeind“ Frankreich zu einer Großmacht in Europa geworden, konnte mit Frankreich, England, Rußland, auch dem Bruderland Österreich–Ungarn auf Augenhöhe verhandeln – das Reich war jetzt eine Großmacht mit aufstrebendem Zentrum: Berlin.
BERLIN – REICHSHAUPTSTADT
In Preußen wurden 1870/1871 780 Aktiengesellschaften gegründet, denen später durch Spekulation Depressionen nicht erspart blieben. Der Reichstag residierte in Berlin, dessen imposantes Gebäude von Gillot aus unserer Nachbarstadt Oppenheim erbaut wurde. Die Entwicklung einer bisher ungewohnten Geschäftswelt wurde angeregt. Berlin überschritt als erste Stadt des deutschen Sprachraumes die Millionen–Grenze, seit 1924 Groß–Berlin mit 4 Millionen Einwohnern. Der Willen des Großbürgertums, auch der Banken und manches Fabrikgebäudes und die Architektur, waren dem Historismus zugewandt – unter Wilhelm II. (1888–1918) wilhelminischer Stil genannt. (Mir vertraut aus dem mir fast heimatlichen Wiesbaden, einer preußischen Stadt vom Kaiser eingeweihten Kurhaus in griechischem Stil.) Der Kurfürstendamm von Berlin wurde zur Flaniermeile, mitaufgeblüht war das Bürgertum. Bei den Fabrikarbeitern war insbesondere die Zahl durch die Landflucht aufgeblüht. Sie wohnten zusammengepfercht in engen Mietskasernen am Rande der Stadt mit mehreren Innenhöfen. Bodenspekulation hatten in den Vororten die großen Mietskasernen entstehen lassen mit ihren lichtlosen, zahlreichen Innenhöfen. So mußte Berlin auch zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung werden. Der durch Zölle nicht mehr behinderte Zusammenschluß der Wirtschaft, die Verwaltung des großen Reiches, soweit sie nicht den Landesfürsten überlassen, brauchte ein Steuerungszentrum. Berlin wurde zur Verwaltungshauptstadt mit einer dem Kaiser treuergebenen Beamtenarmee. Das Militär forderte Paradeplätze, um „Preußens Gloria“ zu verkünden, die Jugend für das Reich zu begeistern. Die tüchtigen Truppenkommandeure kamen aus dem Adel, meist aus den Rittergütern aus dem Osten. Preußens Gloria sollte noch gesteigert werden. Aber neue Macht gibt es nur, wenn neue Gegner besiegt werden. Brauchte da das neue Reich Gegner um seines Selbstbewußtseins willen? Die Gesellschaft drängte wohl nach militärischen Erfolgen mit großem Ehrgeiz. Die Suppe der Selbstgefälligkeit kocht auf und noch mancher sollte sich daran die Finger verbrennen. Patriotismus schien bei manchem Politiker in Nationalismus umzuschlagen, sich auf andere Staaten als Gegner zu fixieren.
Das neue Reich erzeugte neues Selbstbewußtsein.
3.1.2 DIE NEUE GESELLSCHAFT
Der politische Einfluß des Militärs wurde beschnitten (bis 1945 durfte kein aktiver Offizier einer Partei angehören). So fehlte den militärischen Führern eine starke Vernetzung zu den politischen Führern. Sie hatte aber auch kaum Kontakte zum Volk. Da aber Militär und Politik verspannt blieben, versuchte die militärische Führung eine eigene Politik. Ihre Isolierung behinderte vermutlich ihren Erfolg.
Das Bürgertum stieg auf in der Gesellschaft. Bei der aufkommenden Industrialisierung hat der Adel weitgehend seinen politischen Einfluß verloren (darüber später). Das Großbürgertum war entstanden, drängte in die Schaltstellen des Reiches. Das selbstbewußte Bürgertum respektierte den Adel auf seine Weise. Zugespitzt: Die Tochter des Großbürgers heiratete einen Adligen, so kamen Geld und Titel zusammen. Das Bürgertum aber dominierte im neuen Reich.
Die steigende Isolierung des Militärs verhinderte Machtmißbrauch, aber auch Einfluß. (Die Widerständler des 20. Juli 1944 kamen weitgehend aus adligen Familien. – Die militärischen Mittel hatten sie, aber nicht das Volk auf ihrer Seite und nicht fortune. Denn! Wenn das Attentat ihnen geglückt, hätte sich das Volk den ihm Unbekannten anvertraut?
Das Musterbild des bürgerlichen Aufsteigers entstand: Aus einer Lehrerfamilie, Mittlerer Reife, die Kinder Gymnasium, Leutnant der Reserve, durfte im Offizierskasino neben den adligen Kameraden sitzen, später bei einer Bundesbehörde tätig sein, wohnte in einer Seitenstraße der Wilhelmstraße (mit „Herrenzimmer“), Sohn an der Humboldt–Universität immatrikuliert, Tochter mit einem Fabrikanten verlobt – eine moderne, glückliche Familie in der Reichshauptstadt Berlin. „Halt!“ ruft da der jüdische Seifenfabrikant. „Nicht so schnell. Unser Aufstieg wurde uns nicht geschenkt. Aus eigener Kraft kamen wir hoch. Allerdings – zugegeben! Mit neuer Chance. Entschuldigen Sie!“ bleibt da noch übrig zu sagen.
Das Bürgertum profilierte das neue Reich, nicht der Adel. Der patriotische Aufschwung, die vaterländische Begeisterung hatte allerdings auch ihre Auswirkungen in meiner Jugend. In unserer Kirchen waren noch während meiner Jugend an der Seite von Bänken zum Mittelgang mit Lederriemen versehen für die Fahnen, ihren Einzug zum Gottesdienst. Noch in der ersten Zeit des Hitlerreiches hatte ich eine Hakenkreuzfahne in der Kirche gesehen, und bis zum Ende des Krieges stand auf unseren Koppelschlössern „Gott mit uns“. Die Parole „Thron und Altar“ sollte im Wilhelminischen Reich das Gefühl nationalen Aufstiegs sättigen. Der Kaiser verstand sein Amt „von Gottes Gnaden“. (Wäre da unter einem Kaiser der Holocaust – die Vernichtung von Millionen – möglich gewesen?) Die Evangelische Kirche bekannte sich zu Luthers Zwei–Reiche–Lehre. (Nach Matthäus 22,21: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“) Unter Müller wurden die „Deutschen Christen“ stark, die Bekennenden zur Minderheit. Die katholische Kirche wurde nach dem Ende des Kulturkampfes staatsfreundlicher. Im Reichskonkordat 1933 zwischen der Hitlerregierung und dem Vatikan war damals Nuntius Parcelli federführend der spätere Papst Pius XII. So erhielt die Kirche zum Beispiel eine Garantie für katholische Schulen. Im Kaiserreich galt zumindest für das Bürgertum die gesellschaftliche Ordnung als gottgewollt. Parole: Jeder Bürger hatte in seiner ihm angemessenen und zugewiesenen Stellung seine Pflicht zu erfüllen. Das erschreckt euch wohl, meine Enkel, nach unseren Erfahrungen im 20. Jahrhundert mit einem bis zur Katastrophe aufgeblähten Pflichtbegriff. Seht einmal die gesellschaftlichen Verhältnisse von den Einzelnen damals aus: Wieviel Begeisterung, Kraft, guten Willen, manchmal Herzblut gaben viele von ihnen für ihren Staat? K...