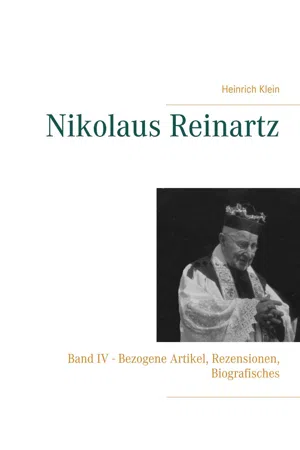
- 216 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Die Sammlung der Schriften von Pfarrer Nikola Reinartz geht auf umfangreiche Archivarbeiten des Verfassers in den Jahren 2001 bis 2013 zurück, als historische Texte der Dorfchronik Kreuzweingarten für Internetzwecke digitalisiert wurden. Diese kamen zunächst unter der Domain woenge.de ins Internet und bildeten den Grundstock zur Heimatforschung und Literatur rund um den kleinen Euskirchener Stadtteil. Mit Zunahme des Umfanges entstanden später die eigenen Internetseiten nikola-reinartz.de und nikolaus-reinartz.de, deren meiste Inhalte sich hier wiederfinden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Nikolaus Reinartz von Heinrich Klein im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Weltgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1922
Ein vorgeschichtlicher Ringwall bei Weingarten in der Eifel.
(ohne Verfasserangabe)
(Veröffentlichung: Eifelvereinsblatt, Nr. 1, Januar 1922, S. 6-7.)
Der indogermanische Volksstamm der Kelten, der im Altertum sich von Süddeutschland her über das ganze westliche Europa ausgebreitet hat, ist es wahrscheinlich gewesen, von dem viele vorgeschichtliche Befestigungen bis auf unsere Zeit sich erhalten haben. Unter ihnen nehmen sog. Ring- oder Steinwälle in unserem Westen die erste Stelle ein. Im Taunus, in der Eifel und besonders im Hunsrück sind bisher viele dieser sog. Fliehburgen festgestellt worden. Cohausen beschreibt deren in seinem Werke über das Befestigungswesen der Urzeit eine ganze Menge. Man denkt sich den Sachverhalt so, daß die Bevölkerung entweder innerhalb dieser Befestigungen selbst oder in nicht zu ferner Umgebung gewohnt hat; im letzteren Falle wären die befestigten Orte nur zeitweilig, in Fällen der Gefahren durch einen Feind, benutzt worden. Die letztere Ansicht dürfte viel für sich haben, weil die Wälle sich wenigstens bei uns in den genannten Gebirgen auf Berggipfeln befinden, wobei dann die Schwierigkeit der Lösung der Wasserfrage wohl einen ständigen Aufenthalt sehr fraglich erscheinen ließe.
Vor etwa zehn Jahren suchte Herr Professor Hürten in Münstereifel, durch die Meßtischblatt-Bezeichnung eines Berges als Burgberg bei Weingarten an der Bahnstrecke Euskirchen-Münstereifel, diesen Berg auf, um nach etwaigen Burgresten zu suchen. Er fand zwar keine Burg, erkannte aber einen deutlich sichtbaren Ringwall auf dem Bergplateau. Eine nähere Erforschung war bis vor kurzem unterblieben, bis jetzt nach Abholzungen sich eine günstige Gelegenheit dazu bot. Auf Anregung des Herrn Pfarrer Reinartz von Weingarten ist nun an verschiedenen Stellen durch Anlegung von Querschnitten durch die Wälle das Befestigungssystem aufgedeckt worden.
Der Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande lud dann seine Mitglieder an einem heitern Herbstsonntag zu einer Besichtigung ein.
In einer Viertelstunde erreicht man vom Bahnhof Weingarten den Burgberg südöstlich des Dorfes. Oben angelangt, hielt Herr Professor Dr. Lehner, nachdem er die Mitteilung vorausgeschickt hatte, daß der Altertumsverein am 1.
Oktober sein 80jähriges Bestehen habe feiern können, an Hand von Kartenmaterial einen erläuternden Vortrag über Ringwälle im allgemeinen und diesen Weingartener im besonderen. Interessant ist, daß bei diesem Werke der Befund sich mit dem System der Befestigung deckt, das Cäsar im 7. Buche des Gallischen Krieges beschreibt. Bei Gelegenheit der Belagerung von Avaricum (Bourges) schildert er das Verteidigungssystem der Gallier wie folgt (VII. 23). Alle gallischen Mauern haben etwa folgende Einrichtung: Auf dem Boden werden grade Balken aus einem Stück der Länge nach nebeneinander und mit zwei Fuß Abstand voneinander gelegt. Die Balken werden inwendig gehörig verklammert und dann alles mit Erde bedeckt; in der Front aber werden die Abstände zwischen den Balken mit großen Steinen völlig ausgefüllt. Ist diese Schicht verlegt und verbunden, so kommt die zweite Lage Balken mit demselben Abstand darauf, aber so, daß nicht Balken auf Balken trifft, jeder von seinem Steinlager genau in demselben Zwischenraum fest zusammengehalten wird. So wird das ganze Werk Lage für Lage zusammengefügt, bis es die verlangte Höhe der Mauer erlangt hat. Der regelmäßige Wechsel der nach geraden Linien geschichteten Balken und Steine gibt dem Werke ein gefälliges und harmonisches Aussehen, ist aber auch von wesentlichem Nutzen für die Stadtverteidigung, weil gegen den Brand der Steinbau, gegen den Widder aber das Holzwerk schützt, welches aus Balken von wenigstens 40 Fuß Länge und inwendig gehörig verklammert, weder durchbrochen, noch auseinandergerissen werden kann.
Den Bau unseres Ringwalles haben wir uns also so zu denken, daß man in gewissen Abständen zwei Reihen Pfähle in den Boden trieb, diese quer mit Balken oder Baumstämmen verband, dann Steine um die Pfähle baute und den Raum in der Mitte durch Erde auffüllte, sodaß die Mauer auf diese Weise einen festen inneren Halt bekam. Im Laufe der Jahrtausende sind aber diese Wälle doch mehr oder minder auseinandergefallen und dadurch sind statt der Steilwände Böschungen entstanden, wie wir sei jetzt bei dem Weingartner Ring sehen, die aber gleichwohl noch die Anlage deutlich erkennen lassen. Auf diese und ähnliche Art mögen die kleineren Ringe entstanden sein, auch derjenige auf dem Altkönig im Taunus, nicht aber das Riesenzyklopengemäuer von 228 000 Kubikmeter bei Otzenhausen im Hunsrück, das der von Züsch kommende Wanderer auf darin angelegten Treppen ersteigt.
Die Eingänge zu solchen Ringwällen, darauf macht Lehner besonders aufmerksam, sind stets so angelegt, daß der Eindringende dem Belagerten seine rechte, unbedeckte Seite bieten muß. Durch Anlage von Vorwällen wird diese Notwendigkeit noch verstärkt insofern, daß der Eindringling durch die Lage des Eingangs des Vorwalles zu derjenigen des Hauptwalles zur Darbietung dieser Blöße gezwungen wird. Das Alter des Weingartner Ringes, der einen Umfang von zirka 300 Meter bei einer Breite von 175 Meter hat, schätzt Professor Lehner auf rund 2000 Jahre; er wäre dann zu Cäsars Zeiten errichtet worden.
Der elliptische Ring auf dem Altkönig hat 1150 Meter, der Otzenhauser 1360 Meter, sein Vorwall 850 Meter Umfang.
Bei dem Rundgang um den Hauptwall, der auch einen Vorring aufweist, sah man die verschiedenen Querschnitte, die nach Abtragung des Humusbodens Steinmassen erkennen ließen, an deren Vorderseiten noch die eingerammten Pfähle festgestellt werden konnten. Es sind nämlich noch die Löcher zu erkennen, in denen diese Pfähle steckten, und zwar an der gegenüber dem gewachsenen Boden verschiedenen Farbe der Erde, die diese Löcher nun füllt. Auch die Querbalken sind hier noch festzustellen, dank des Umstandes, daß sie durch Brand vernichtet worden sind. Holz hätte sich 2000 Jahre wohl nicht erhalten, wohl aber die Holzkohle, und diese ist noch an mehreren Stellen vorhanden. Man wird noch die Holzart feststellen, die diese Kohle geliefert hat. Eine Eigentümlichkeit dieses Walles ist noch, daß ihm ein Graben vorgelagert gewesen ist; dieser ist übrigens auf verständliche Weise dadurch entstanden, daß man die ausgehobene Erde zur Füllung zwischen die auf die oben geschilderte Weise zustande gekommenen Steinmauern verwendete.
Auf dem Ringwall stand schon im Mittelalter das Weingartener Kreuz, das heute durch ein eisernes ersetzt ist; von ihm bietet sich ein sehr schöner Blick auf die Gegend, die zur römischen Zeit ziemlich stark besiedelt gewesen zu sein scheint. Nach Westen erscheint die Kirche von Billig, in dessen Nähe das römische Belgica an der Straße von Trier nach Bonn lag. Durch den Weingartener Wald ging die römische Wasserleitung, von der noch ein Stück zu sehen ist, und in Weingarten selbst ist an der jetzigen Landstraße eine umfangreiche römische Villa festgestellt worden.
1926
Daniel von Wichterich.
Vortrag von Nikolaus Reinartz auf der Versammlung des Historischen Vereins für den Niederrhein am 17. Mai 1926 in Euskirchen.
(Urschrift im Familienarchiv)
Veröffentlichung: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, Heft 109, 1926, S. 162–166.)
Bericht (Auszug)
... An zweiter Stelle behandelte Pfarrer Nikolaus Reinartz (Kreuz-Weingarten, Kreis Euskirchen) das Thema: Daniel von Wichterich, ein rheinischer Prälat aus der Zeit des Avignoneser Exils.
[...]
Im Pfarrarchiv zu Frauenberg bei Euskirchen befinden sich eine Reihe Urkunden aus den Jahren 1374–1384, die fortlaufend Memorienstiftungen für „Bischof Daniels Seele van Virden" enthalten. Wer war dieser Bischof von Verden? Von Heister in seinem Werk „De suffraganeis Coloniensibus" und Hartzheim in seiner „Bibliothea Coloniensis" unter die verdientesten und gelehrtesten Männer seiner Zeit gerechnet, ist er von der Verdener Geschichtsschreibung masslos geschmäht worden; erst durch Sauerlands Vatikanische Regesten hat sein Lebensbild festere Linien und deutliche Gestalt gewonnen.
Daniel, von seinem Geburtsörtchen Ober-Wichterich, in der Pfarrei Frauenberg gelegen, gewöhnlich zubenannt, scheint daselbst um das Jahr 1290 einer nichtadligen Familie entsprossen zu sein; nach einer Notiz in einem alten Kirchenbuche hätte sein Familienname Schwan geheissen; als Daniel Schwan de Wichterich wird er auch unter den Landdechanten des Zülpicher Dekanates genannt, wenngleich diese Angabe noch nicht genügend geklärt ist. Seine Ausbildung erhielt der mit ganz seltener Begabung ausgestattete Dorfjunge bei den Karmelitern in Köln, dem Orden, der im 13.–15. Jahrhundert vor allen andern Orden im Kölnischen die grösste Anzahl gelehrter Theologen hervorgebracht hat, wie er auch die meisten der Kölner Weihbischöfe jener Zeit gestellt hat. In rascher Folge und in noch jugendlichem Alter zum Lehrer der Theologie, zum Definitor und Provinzial der gesamten deutschen Ordensprovinz aufgestiegen, legte er diese Würde jedoch bald nieder, um an der Pariser Universität als erster deutscher Karmelit den Doktorhut zu erwerben.
Im Jahre 1320 finden wir Daniel v. Wichterich unter dem Titel eines Bischofs von Mentone (im damals venezianischen Achaja gelegen) als Weihbischof des einflussreichsten der deutschen Landesfürsten, Balduins v. Luxemburg, in Trier. Die wichtigsten Dienste leistete er diesem in den Jahren 1342/43, wo er als Gesandter des Trierer Erzbischofs am päpstlichen Hofe in Avignon dessen Aussöhnung mit dem Apostolischen Stuhle bewirkte und dadurch die Wahl des Markgrafen Karl von Mähren, des Grossneffen Balduins, der zugleich aber auch zum Papste Klemens VI., seinem Erzieher, in engen Beziehungen stand, zum deutschen Kaiser an Stelle Ludwigs von Bayern anbahnte. Daniel war es, der im August 1343 dem Trierer Kurfürsten den offiziellen Auftrag „de idonea persona in imperatorem eligenda" mit sich zu Rate zu gehen, gleichzeitig aber auch geheime Mitteilungen über die Absichten des Papstes überbrachte, die drei Jahre später in der Absetzung Ludwigs und der Wahl Karl IV. sich verwirklichten.
Die Verdienste Daniels wurden durch seine Erhebung zum Bischof von Verden a. d. Aller am 27. November 1342 gewürdigt. Damit begann die eigentliche Tragik seines Lebens. Daniels Verdener Episkopat ist eines der bezeichnendsten Beispiele dafür, mit welchem Misstrauen und Misslieben manche Massnahmen der Avignoneser Päpste, insbesondere die Besetzung der bischöflichen Stühle unter Uebergehung des herkömmlichen Wahlrechtes der Domkapitel in Deutschland, aufgenommen wurden. Bereits der gleichfalls im Wege päpstlicher Provision zum Bischof von Verden ernannte Vorgänger Daniels, Johann v. Göttingen, hatte es vorgezogen, die Verwaltung seines Bistums dem tüchtigen und beliebten Gottfried v. Werpe zu übertragen und zur schönen Rhonestadt – er war Leibarzt Johannes XXII. gewesen – zurückzukehren. Daniel sah sich genötigt, den Widerstand des zu Gottfried stehenden Domkapitels gegen seine Ernennung mit Waffengewalt niederzuwerfen; als dabei das Süderende eingeäschert wurde, kannte der Hass gegen ihn keine Grenzen mehr. Um sein Leben zu retten, ging er freiwillig 1356 nach Köln in die Verbannung, bis übers Grab hinaus von seinen Gegnern in Wort und Bild geschmäht; bezeichnend ist das ihm gewidmete schaurige Distichon: „Daniel undipes, non curat clerus, ubi stes – Sis ubicumque velis, modo non sis in coelis".
Die Verteidigungsschriften Daniels scheinen leider verloren gegangen. Tatsache ist aber, dass er sowohl in Köln ehrenvolle Aufnahme gefunden hat, wo er wiederholt den Erzbischof Wilhelm v. Lennep vertrat, als auch vom Päpstlichen Stuhle noch kurz vor seinem Tode 1363 mit einem wichtigen Auftrage betraut wurde. Seine Ruhestätte hat der vielgeprüfte Mann, den sein Geschick soweit umhergeworfen hatte, in der rheinischen Heimat, im Dome zu Altenberg, in der Reihe der dort ruhenden Kölner Weihbischöfe gefunden. Der Heimat hat er ja auch zeitlebens ein treues Andenken bewahrt. Möge es denn der Heimatforschung gelingen, das Dunkel, das noch vielfach über den Geschicken Daniels von Verden liegt, zu enthüllen, um dadurch noch klarer herauszustellen, dass sein glänzender Aufstieg seiner persönlichen Tüchtigkeit, sein tragischer Fall wohl zumeist den unglücklichen Zeitumständen zuzuschreiben ist.
Im Anschluss an diese ebenso wie die von Steinbach durch den lauten Beifall der Versammlung belohnten Ausführungen hob der Vorsitzende hervor, dass sie in eine Epoche hineingeleuchtet hätten, die bisher nicht gerade ein Schosskind der rheinischen Geschichtsforschung gewesen sei, und dass sie eine hochinteressante Persönlichkeit aus dem Rheinland einmal vorläufig umrissen hätten, über die bisher nur ganz vage Angaben vorlagen. Um so wärmer sei der Dank an den Herrn Redner, der sich einem solchen Gegenstand, obwohl fern von den Arbeitsstätten gelehrter Forschungen lebend, widme.
[...]
Bei dem gemeinsamen Mittagsmahl des Kerns der Teilnehmer im Hotel Joisten, das sich ihr anschloss, wurde über den guten Gaben aus Küche und Keller des genius Loci und der ideellen Ziele unseres Vereines nicht vergessen. Der Unterzeichnete begründete sein Hoch auf die Stadt Euskirchen mit dem trotz ihrer langen Geschichte und der industriellen Umstellungen und Rückschläge der letzen zwölf Jahre auch heute in ihrer herrschenden Reg- und Strebsamkeit. Dechant Ganser toastete nach warmem Gedenken an die Euskirchener Heimatforscher Gissinger und Simons auf unseren in umfassendem Sinne Heimatforschung treibenden Verein und seine Leitung. Prof. Dr. Ness (Bonn) würdigte in geschickter Anknüpfung an einen ebe...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Übersicht
- Zum IV. Band
- 2. Inhaltsverzeichnis I
- Bezogene Artikel, Rezensionen
- 4. Inhaltsverzeichnis II
- Biografisches
- Wortindex
- Abbildungsindex
- Impressum