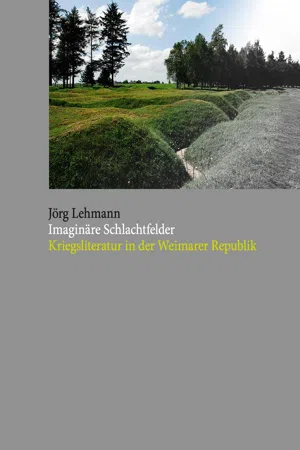
- 304 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
In welchen typischen Erzählmustern verarbeiteten die Zeitgenossen der Weimarer Republik den Ersten Weltkrieg? Über die Bücher von Jünger und Remarque hinaus zeigt diese Querschnittsstudie auf, wie die Erlebnisse in den Schützengräben in einen Kampf um Deutungsmacht überführt wurden. Dabei werden heroisierende Darstellungen ebenso berücksichtigt wie kriegskritische Werke und nationalistische Interpretationen, die die Heraufkunft des "Dritten Reiches" vorbereiteten. Anhand von Textbeispielen aus über 100 Werken bekommt der Leser einen profunden Eindruck von der Struktur der Kriegsliteratur in der Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Imaginäre Schlachtfelder von Jörg Lehmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Sprachwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1
Einführung in die Theorie und die Feldstrukturen
1.1 Einleitung
Am Anfang war die Niederlage. Auf die nationale Niederlage im Ersten Weltkrieg folgte eine Reihe historischer Ereignisse, die für verschiedene gesellschaftliche und politische Fraktionen in Deutschland ebenfalls als Niederlagen wahrgenommen wurden: das Scheitern der Revolution, der Abschluss des Versailler Vertrages, Kapp- und Hitlerputsch, das Verbot der Freikorps, die Ruhrbesetzung.
1929 erschien dann Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Ausgehend von diesem Werk entwickelte sich eine heftige literarische und publizistische Debatte. Es kann als Auslöser einer Reihe nationalistisch-militaristischer Kriegsromane bezeichnet werden, in denen das Kriegserlebnis dezidiert als Verpflichtung auf ein nationalistisches Engagement benannt wird: Der real erlebte Kampf in den Schützengräben und Freikorps war in einen Kampf um gesellschaftliche Sinnstiftung überführt worden.
Mit der literarischen Darstellung des Weltkriegs fand eine doppelte Übertragung statt: Zum einen wurde das Weltkriegserlebnis nunmehr in der Imagination wiederholt und bearbeitet; zum anderen wurde auf diesen imaginierten Schlachtfeldern um die Besetzung von Ästhetiken, Metaphern und Semantiken gekämpft. Mit jeder Publikation wurde Stellung bezogen für den Krieg oder gegen ihn, für die Helden oder die Opfer, für den Triumph oder das Leiden. Da die Niederlage im Ersten Weltkrieg aber gesellschaftlich weithin nicht akzeptiert worden war, wird sie in den Texten zumeist nicht als historischpolitisches Ereignis angesprochen; sie hat keinen konkreten Ort innerhalb der Erzählungen. Dennoch ist sie stets implizit enthalten, sei es in einer Darstellung wie der von Remarque, dessen Buch eine ganze Generation als von Krieg, Tod und Niederlage gezeichnet zeigt, oder in nationalistischen Entwürfen, die der Schmach der Niederlage die Werte Ehre, Kampfeslust und Opferbereitschaft entgegenstellen und in denen die Niederlage als Keim des Aufbruchs eines neuen Deutschland gewertet wurde.
Die vorliegende Studie verfolgt zwei Leitfragen: Zum einen gilt es, das Materialkorpus auf seine narrativen, ästhetischen und semantischen Muster zu untersuchen, diese in Zusammenhang mit politischen und sozialen Indizes zu setzen und so eine Strukturbeschreibung der Kriegsliteratur in der Weimarer Republik zu erstellen. Um die Vielzahl der Texte miteinander vergleichbar zu machen, wird zum anderen einer inhaltlichen Leitfrage nachgegangen, nämlich den Positionierungen hinsichtlich der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Anders als eine Untersuchung etwa der Schauplätze des Krieges (West- und Ostfront, Krieg in den Kolonien, Schilderungen der Geschehnisse in der Heimat oder in Kriegsgefangenenlagern) oder der erzählten Zeitausschnitte und Themen (Gaskrieg, Verhältnis Mensch – Maschine) bietet die Niederlage und ihre Folgen einen Fokus, unter dem die Texte gemeinsam perspektiviert werden können. Dabei wurde der Blick auf erzählende Prosa zum Ersten Weltkrieg gerichtet; im Vordergrund stehen damit Darstellungen, die Schicksale von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen wiedergeben.1 Regimentsgeschichten, historische Romane, Pamphlete und Traktate, Beiträge zur Kriegsschulddebatte oder zu militärtechnischen Fragen wurden nicht beachtet. Kriegsliteratur wird in der vorliegenden Studie in einem weiten Sinn verstanden. So werden nicht nur Darstellungen berücksichtigt, die auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ihren Schauplatz haben, sondern auch solche, die in der Heimat oder im „Nachkrieg“, d.h. den Freikorpskämpfen und Bürgerkriegssituationen angesiedelt sind. Darüber hinaus werden mit Hermann Löns’ „Wehrwolf“ und Wilhelm Lamszus’ „Menschenschlachthaus“ auch zwei Texte in den Blick genommen, die bereits vor dem Weltkrieg publiziert wurden, aber bereits wichtige Darstellungsmodi enthalten.
Eine nicht unbeträchtliche Schwierigkeit für die Untersuchung stellte die schier unüberschaubare Masse an literarischen Werken zum Weltkrieg dar. War zu Beginn der Studie davon ausgegangen worden, dass die Anzahl der zu untersuchenden Bücher den Wert von 200 nicht überschreiten würde,2 so ergab die Konsultation von Bibliographien, die den zeitgenössischen Buchhändlern zur Verfügung gestellt wurden,3 die Auswertung des Zettelkastens der Kriegssammlung in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin sowie Sekundärliteratur aus dem Zeitraum zwischen 1930 und 19344 eine Gesamtzahl von über 670 untersuchungsrelevanten Titeln.
Aus diesem Korpus wurden dann anhand von Bestsellerlisten,5 der „Schwarzen Liste“ verbotener und verbrannter Bücher,6 aufgrund von Sekundärliteratur zu einzelnen Spezialgebieten wie den Darstellungstraditionen nationalsozialistischer Literatur und der Kolonialliteratur7 oder schlicht nach dem Titel rund 170 Werke ausgewählt, deren einleitende und abschließende Abschnitte einer Begutachtung unterzogen wurden, da davon ausgegangen werden konnte, dass dort programmatische, motivationale und/oder politischmoralische, wertende Begriffe und Darstellungsformen verwandt werden, die für den jeweiligen Gesamttext bedeutsam sind. Nach dieser Voruntersuchung wurden die als relevant erscheinenden Titel dann vollständig rezipiert und analysiert.
1.2 Einführung in die Theorie
Methodischer Ansatz dieser Studie ist die von Pierre Bourdieu entwickelte literatursoziologische Theorie.8 Sie ermöglicht es, nicht nur die einzelnen Werke aufeinander zu beziehen, sondern diese auch in Korrelation zur sozialen Position des Autors bzw. zur aktuellen politischen Situation zu setzen. Kunst und Literatur werden hier als soziale Fakten betrachtet. Gegenstand der Analyse ist mit dem „Sozialsystem Literatur“ – als konstitutivem Teilsystem der Gesellschaft – ein sozialer Raum mit relativ autonomen, eigengesetzlich organisierten „Feldern“. Bourdieu fordert ein, sowohl die Werke in ihrer Beziehung zu anderen Werksorten als auch die Produzenten in ihrer Relation zu den anderen Autoren bzw. zu anderen Feldern im Auge zu behalten. Grundlegend ist dabei die „Hypothese von strukturellen und funktionellen Homologien zwischen einzelnen Feldern“;9 diese Homologien sind
le produit de la rencontre quasi miraculeuse entre deux systèmes d’intérêts […] ou, plus exactement, de l’homologie structurale et fonctionelle entre la position d’un écrivain ou d’un artiste déterminé dans le champ de production et la position de son public dans le champ des classes et de fractions de classe. […] C’est la logique des homologies qui fait que les pratiques et les œuvres des agents d’un champ de production spécialisé et relativement autonome sont nécessairement surdétermineés, que les fonctions qu’elles remplissent dans les luttes internes se doublent inévitablement de fonctions externes, celles qu’elles reçoivent dans les luttes symboliques entre les fractions de la classe dominante et, à terme au moins, entre les classes.10
Angesichts des hohen Politisierungsgrades der Kriegsliteratur – gerade in der Endphase der Weimarer Republik ist er evident – wird diese These im vorliegenden Fall besonders plastisch. So ermöglichen diese Homologien auch, über eine Analyse der Struktur des politischen Feldes neue Einsichten zur Struktur des literarischen Feldes zu gewinnen und die ästhetischen Darstellungsmodi in Bezug zu den ideologischen Positionsnahmen des Macht-Feldes zu setzen.
Neben der Homologiethese ist es vor allem das Anliegen einer Beschreibung sozialer Konflikte, das den Bourdieuschen Ansatz vor anderen auszeichnet. Bei Bourdieu werden die Positionen im Feld konfligierend aufeinander bezogen, es liegt das Paradigma des sozialen Kampfes zugrunde und damit jene Orientierung an Werten wie „Ehre“ und Prestige, die für die Kriegsliteraturdebatte besonders relevant ist. Mit dem Begriff des „Kampfes“ ist der Begriff des „Feldes“ eng verbunden: „Dass die Geschichte des Feldes die Geschichte des Kampfes um das Monopol auf Durchsetzung legitimer Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien ist: diese Aussage ist noch unzureichend; es ist vielmehr der Kampf selbst, der die Geschichte des Feldes ausmacht; durch den Kampf tritt es in die Zeit ein.“11 Die Verwendung des Begriffes „Feld“ resultiert aber nicht (nur) aus der Betrachtung der direkten Interaktionen, vielmehr werden damit die Relationen zwischen den Positionen und ein „typisches“ Handeln der Beteiligten, das sich auch ohne wirkliche Interaktionen einstellt, objektiviert.12 So lassen sich die Strukturen im literarischen Feld beschreiben als objektive Relationen zwischen „denjenigen, die Epoche gemacht haben und ums Überdauern kämpfen, und denjenigen, die ihrerseits nur Epoche machen können, wenn sie diejenigen aufs Altenteil schicken, die Interesse daran haben, die Zeit anzuhalten, den gegenwärtigen Zustand zu verewigen“.13 Die Geschichte des Feldes entsteht also durch die Abfolge einer Reihe von Oppositionen, d.h. den Gegensätzen „zwischen den an einer Kapitalart Reicheren und Ärmeren, zwischen den Herrschenden und den Beherrschten, den Arrivierten und ihren Herausforderern, den Alteingesessenen und den Neulingen, realem und angemaßtem Rang, Orthodoxie und Häresie, Arrieregarde und Avantgarde, etablierter Ordnung und Fortschritt“.14
Wie an obigem Zitat ablesbar, können die verschiedenen Bezeichnungen der unterschiedlichen Gruppen von ,Arrivierten‘ und ,Herausforderern‘ usw. variiert werden; da Bourdieu in der Genese seiner Theoriebildung seine Begriffe an der Betrachtung des religiösen Feldes gewonnen hat und sie von dort auf die anderen Felder symbolischer Produktion – wie Kunst, Literatur oder auch Sprache – übertragen hat, sollen in der vorliegenden Studie die Termini ,Orthodoxe‘ und ,Häretiker‘ verwendet werden. Damit lässt sich die Geschichte der Kriegsliteratur in der Weimarer Republik wesentlich als Abfolge zweier Gegensätze beschreiben: Dies ist zum einen der Gegensatz zwischen den Eliten des Kaiserreichs und den kriegskritischen Intellektuellen und Künstlern, wie er sich bereits während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg ausbildet (aufgrund der Zensur durften viele antimilitaristische Texte vor 1918 nur in der neutralen Schweiz erscheinen), zum anderen bildet sich gegen Ende der Weimarer Republik der Gegensatz zwischen antimilitaristischen (hier ist insbesondere an Remarques „Im Westen nichts Neues“ zu denken) bzw. sozialistischen Positionen und den „radikal-nationalistischen“ Texten aus. Die Abfolge dieser Gegensätze in der Zeit bildet die Geschichte des Feldes: „c’est inséparablement faire exister une nouvelle position au-delà des positions occupées, en avant de ces positions, en avant-garde. Introduire la différence, c’est produite de temps.“15
,Orthodoxe‘ und ,häretische‘ Positionen unterscheiden sich voneinander weniger durch inhaltliche Kriterien, sondern bestimmen sich vorwiegend negativ, in Beziehung auf die anderen Positionen; alle konkurrieren miteinander um die legitimen Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien der gesellschaftlichen Welt und definieren sich durch ihren je unterschiedlichen Bezug zur Doxa, „d.h. wenn die Koinzidenz zwischen objektiver Ordnung und den subjektiven Organisationsprinzipien gleichsam vollkommen ist (wie in den archaischen Gesellschaften), erscheint die natürliche und soziale Welt schließlich als selbstverständlich vorgegebene. Diese Erfahrung wollen wir Doxa nennen“.16 Erst wenn dieser Status der sozialen Welt als natürliche Gegebenheit in Frage gestellt wird, „erst dann wird auch die bewußte Systematisierung und explizite Rationalisierung, die beide den Übergang von der Doxa zur Orthodoxie kennzeichnen, eine Frage der Notwendigkeit. […] Orthodoxie bestimmt sich als ein System von Euphemismen, von schicklichen Weisen, die natürliche wie soziale Welt zu denken und in Worte zu fassen“.17 Zu dieser ,Orthodoxie‘ setzen sich die ,häretischen‘ Positionen durch die Markierung eines Bruchs ab:
Der häretische Bruch mit der bestehenden Ordnung und den Dispositionen und Vorstellungen, die sie bei den von ihren Strukturen geprägten sozialen Akteuren erzeugt, setzt jedoch selber voraus, daß ein kritischer Diskurs und eine objektive Krise zusammentreffen, um die unmittelbare Entsprechung zwischen den inkorporierten Strukturen und den objektiven Strukturen, aus denen sie hervorgegangen sind, aufbrechen [sic!] und eine Art praktischer épochè, eine Suspendierung der ursprünglichen Bejahung der bestehenden Ordnung, einleiten zu können.18
Aufgrund dieses Zäsurcharakters tendieren die Stellungnahmen der Herausforderer „zur Kritik an bestehenden Formen, zum Sturz der geltenden Vorbilder und zur Rückkehr zu ursprünglicher Reinheit“.19 Die Proklamation einer ,Rückkehr zu den Quellen‘ kommt häufig einem Angriff auf das ,Heilige‘ gleich und schließt daher die Figur der Überschreitung mit ein:
Mais la contestation des hiérarchies artistiques établies et le déplacement hérétique de la limite socialement admise […] ne peut exercer un effet proprement artistique de subversion que si elle reconnaît tacitement le fait et la légitimité de cette délimitation en faisant du déplacement de cette limite un acte artistique et en revendiquant ainsi pour l’artiste le monopole de la transgression légitime de la limite entre le sacré et le profane, donc des révolutions des systèmes de classement artistiques.20
Der Wandel im Feld ist das Produkt des Kampfes zwischen diesen unterschiedlichen Positionen. Entkoppelt von diesem Wandel ist freilich das Schicksal der neuen, ,häretischen‘ Stellungnahmen. Da die Durchsetzung einer neuen Position von der Stärke der von ihr mobilisierten Gruppe innerhalb des sozialen oder politischen Felds abhängt, d.h. von externen Faktoren, kann es Vorkommen, dass eine ,häretische‘ Position – im vorliegenden Fall die kriegskritische Sicht (im folgenden mit ,Häretiker I‘ bezeichnet) – sich nicht etablieren kann. Gelingt dies aber, kommt es – wie im Fall der „radikalnationalistischen“21 Texte (im folgenden mit ,Häretiker II‘ bezeichnet) – zu einem Umschlag von ,Häresie‘ in eine „neue […] Orthodoxie“.22
Indes wirft die Analyse des gewählten Materialkorpus „Kriegsliteratur in der Weimarer Republik“ eine Reihe von Problemen und neuen Fragen auf. Das erste Problem ergibt sich daraus, dass die Kriegsliteratur in der Weimarer Republik lediglich einen Ausschnitt des gesamten literarischen Feldes darstellt. Bourdieu konzeptionalisiert das literarische Feld als einen Raum, in dem die Produkte durch ihre unterschiedlichen literarischen Qualitäten positioniert sind....
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Theorie und in die Feldstrukturen
- 2. Die Orthodoxen: Krieg als Abenteuer
- 3. Häretiker I: Kriegskritische Texte
- 4. Häretiker II: Radikalnationalistische Texte
- 5. Vom Fortwirken der Niederlage
- Primärliteratur
- Literaturverzeichnis
- Personenregister
- Impressum