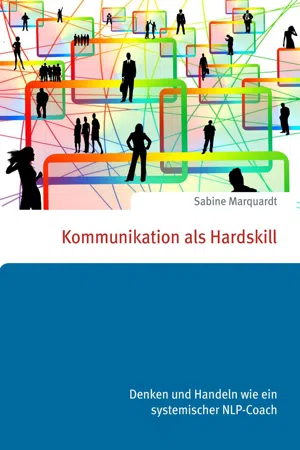![]()
Das Methoden-Spektrum des systemischen NLP-Coachs
Der Coach unterstützt auf dem Weg zum Ziel.
Der systemische NLP-Coach schafft durch bewusste kommunikative Rückkoppelungen einen Raum, in dem Menschen ihr eigenes Fühlen, Denken und Handeln erleben und zielorientiert-ökologisch erweitern. Er führt durch einen Prozess, in dessen Verlauf die Klienten ihre Wahrnehmung verbessern, ihre Denk-, Kommunikations- und Handlungsstrategien aktualisieren und ihre Werte klären können. Auf dem Weg zum Ziel unterstützt der Coach dabei, mentale und emotionale Blockaden aufzulösen sowie Hindernisse anzugehen.
1) Das Methodenverständnis des systemischen NLP-Coachs
Dabei hat er immer die Feedbackschleife im Blick.
Zu diesem Zweck greift der NLP-Coach auf eine große Palette an Methoden zurück. Gerne wird daher die NLP-Methodenbox als ein Werkzeugkoffer beschrieben, aus dem einzelne, hochwirksame Werkzeuge entnommen und präzise nach eigener Zielvorstellung bei anderen eingesetzt werden können.54 Doch das ist eine Vorstellung, die nicht zum Selbstverständnis eines systemischen NLP-Coachs passt. Er denkt in Feedbackschleifen, berücksichtigt Rückkoppelungen und behält die Ökologie seines Handelns im Blick.
Coaching-Tools lassen sich nur bedingt mit Werkzeugen vergleichen.
Eine Methodenbox ist kein Werkzeugkoffer
Denn Coach und Klient können, das zeigt die systemische Perspektive, nicht nicht kommunizieren. Die Wirkung einzelner Methoden lässt sich nicht von den Personen, zwischen denen sie angewandt werden, trennen. Das Ergebnis eines Hammereinsatzes hängt zwar von der Schlagkraft des Handwerkers und der Beschaffenheit des Werkstücks ab. Die Qualität und Größe des Hammers bleibt aber, ungeachtet der Person des Handwerkers und der Eigenschaften des Werkstücks, immer gleich. Ein Hammerschlag wirkt auch, wenn sowohl Handwerker als auch Werkstück nicht von der Leistungskraft des Hammers zu überzeugen sind.
Denn Coaching ist empfängerorientiert.
Die Werkzeug-Metapher entstammt der linearen Denk-Welt. Kommunikative Methoden dagegen spiegeln die systemische Welt. Ihre Wirkungen beruhen auf der Persönlichkeit des Coachs und seiner Verbindung zum Klienten. Der Coach selbst ist sein wichtigstes Werkzeug, das durch die Stimmigkeit bzw. Kongruenz seiner (Körper-)Sprache das Vertrauen erzeugt, welches ein Klient auf dem Weg zur Veränderung braucht. Coaching und der Einsatz von Coaching-Tools ist empfängerorientierte Kommunikation, die sich an wirkungsvollen Feedbackschleifen orientiert.55
Wichtigstes Tool ist die Persönlichkeit des Coachs.
Jede Methode wirkt daher nur so intensiv wie der Coach selbst. Der Erlernen von Coaching-Methoden setzt die Einbettung in einen intensiven Prozess der Persönlichkeitsentwicklung voraus. Denn im Coaching macht nicht das Tool, sondern der Coach den Unterschied. Emotionale Stabilität, gutes Selbstmanagement, eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit sowie eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung charakterisieren den guten Coach.
Erfolg hängt nicht zuletzt von der Eigenverantwortlichkeit des Klienten ab.
Kein Coaching ohne Auftrag
Neben der Persönlichkeit und Methodensicherheit des Coachs geben weitere Faktoren den Ausschlag für Erfolg. Die gute Passung von Coach und Klient ist genauso wichtig wie die Bereitschaft des Klienten, Eigenverantwortung in den Prozess zu investieren. Ausdruck des eigenverantwortlichen Rahmens ist die explizite Auftragserteilung. Zum Klienten werden Menschen im Coaching daher erst, wenn sie ein konkretes Anliegen an den Coach herantragen und ihm den Auftrag erteilen, dieses Anliegen im Rahmen des Coachings gemeinsam zu klären.
Coaching setzt ein Anliegen und einen Auftrag voraus.
Klient sein heißt, Verantwortung zu übernehmen. Klienten unterscheiden sich klar von Besuchern, die von Chefs, wohlmeinenden Familienmitgliedern oder Freunden zum Coaching geschickt worden sind.56 Da sie nicht ihr eigenes Anliegen zum Coach geführt hat, treten sie oft (un-)bewusst mit der Absicht zum Coaching an, dessen Nutzen zu konterkarieren. Die Verantwortung für den Prozess verlagern sie damit auf die Entsender und den Coach. Sind diese Umstände gegeben, gelingt es dem Coach nur unter Mühen, einen Besucher als echten Klienten zu gewinnen.
Es versteht sich als Prozess zur Anregung der Selbstregulation.
Coaching ist ein optimierter Feedbackprozess
Coaching ist lebendiges kommunikatives Handeln im Dienste des Klienten. Auf der Basis seines Methoden-Know-hows regt der Coach ein Wechselspiel an, in dessen Verlauf sich die einschränkenden Wirklichkeitskonstruktionen des Klienten aktualisieren. Der Coach ist Experte für optimale Feedbackschleifen, die Klienten gezielt zur erwünschten Selbstregulation führen.
Auf einen Blick: Das Methodenspektrum des systemischen NLP-Coachs
Die Methodenbox des systemischen NLP-Coachs ist nicht vergleichbar mit einem Werkzeugkoffer, dem Tools für beliebige Zwecke entnommen werden können. Denn die Wirkung kommunikativer Methoden entsteht durch die Feedbackschleife zwischen Coach und Klient. Im Coaching stellt der Coach seine methodisch geschulte Kommunikation in den Dienst des Klienten. Die Feedbackschleife zwischen Coach und Klient hat die Selbstregulation des Klienten zum Ziel.
Das wichtigste Werkzeug im Coaching ist die Persönlichkeit des Coachs selbst. Coaching-Erfolg hängt aber vor allem von der Bereitschaft des Klienten ab, Eigenverantwortung zu übernehmen.
2) Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion
Erfahrung hat eine Struktur. Veränderte Strukturen verändern Erfahrung.
a) Mit den Sinnen Wirklichkeit repräsentieren und filtern
Kommunikation ist subjektive Wirklichkeits- und Sinnkonstruktion. Die Aufmerksamkeit des Coachs beim Zusammentreffen mit dem Klienten kreist daher um die Frage, wie dieser seine (Problem-)Wirklichkeit erzeugt. NLP hat sich auf der Basis seines Selbstverständnisses als Neuro-Linguistisches Programmieren darauf fokussiert, minutiös die Strategie-Muster bzw. Programmierungen herauszuarbeiten, die für die individuelle mentale Landkarte eines Menschen charakteristisch sind. Denn Erfahrung hat eine Struktur, die umstrukturiert werden kann.
Die fünf Sinne erzeugen und filtern Wahrnehmung.
Mentale Landkarten sprechen VAKOG
Diese Struktur bzw. das wiederkehrende, charakteristische Muster unserer Erfahrung bestimmt sich zuallererst durch die Art, wie wir die Welt über unsere Sinneskanäle wahrnehmen, neuronal verarbeiten und in eine mentale Landkarte umsetzen. Seh-, Hör-, Fühl- sowie Geschmacks- und Geruchsinn – im NLP bezeichnet als visuelles, auditives, kinästhetisches, gustatorisches und olfaktorisches Repräsentationssystem (kurz: VAKOG) – erzeugen unsere subjektive Welt und bilden zusammen die Hauptfilter unserer Wahrnehmung.
Alles Erleben, Handeln und Denken beruht auf VAK(OG).
Mit der spezifischen Abfolge einzelner Sinnesaktionen im Gehirn programmieren wir unser Welterleben. Denn alles Erleben, Handeln und Denken beruht auf VAKOG, vor allem auf den drei dem Verstand zugänglichen Sinnen VAK. Ohne (internales) Sehen, Hören und Fühlen sind menschliche Verstandesoperationen nicht vorstellbar. Geruch und Geschmack (OG) dagegen stellen für einige Menschen sehr wirkmächtige Sinnesreize dar, für andere wiederum nicht. Wer seinen Geruchs- und Geschmackssinn verliert, verzichtet zwar auf Genuss, kann sich jedoch ohne Probleme in der modernen Welt orientieren.
Jeder Sinneskanal eröffnet spezifische Möglichkeiten.
Das Sehen ist der Kanal zur Entwicklung kreativer Zukunftsbilder und Visionen. Er gibt räumliche Orientierung sowie Richtungen und Ziele vor. Das Fühlen bewertet emotional und sorgt durch das Streben nach Wohlgefühl für körperlich-emotionales Gleichgewicht. Das Hören ist zum einen über Rhythmus und Musikalität mit dem ganzheitlichen Fühlen verknüpft. Zum anderen ist das Hören der Sinneskanal, der am engsten mit Sprache verbunden ist. Neuro-Linguistisches Programmieren offenbart, welche bedeutende Rolle der Sprache zukommt. Sie erlaubt die linear-kausale Analyse und ermöglicht es, Weltdeutungen zu konstruieren und aus der Metaperspektive zu verändern.57
Themen-Input 16: Den subjektiven Charakter der Wirklich...