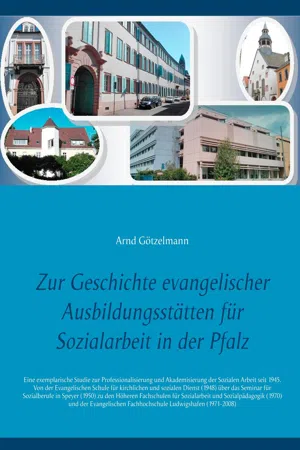
Zur Geschichte evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialarbeit in der Pfalz
Eine exemplarische Studie zur Professionalisierung und Akademisierung der Sozialen Arbeit seit 1945. Von der Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst (1948) über das Seminar für Sozialberufe in Speyer (1950) zu den Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (1970) und der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen (1971-2008)
- 200 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Zur Geschichte evangelischer Ausbildungsstätten für Sozialarbeit in der Pfalz
Eine exemplarische Studie zur Professionalisierung und Akademisierung der Sozialen Arbeit seit 1945. Von der Evangelischen Schule für kirchlichen und sozialen Dienst (1948) über das Seminar für Sozialberufe in Speyer (1950) zu den Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (1970) und der Evangelischen Fachhochschule Ludwigshafen (1971-2008)
Über dieses Buch
Bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in der Pfalz nach einer Möglichkeit gesucht, Fachkräfte für den Neuaufbau des Jugendpflege-, Fürsorge- und Wohlfahrtswesens in einer protestantischen Ausbildungsstätte zu qualifizieren. Vorbilder solcher evangelisch-sozialen Frauen- oder Wohlfahrtsschulen gab es seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch in umliegenden Gebieten. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges hatten es allerdings schwer gemacht, solche Ausbildungsstätten wieder oder neu zu eröffnen. Der Bedarf an Sozialarbeit und dafür gut ausgebildeten Fachkräften war angesichts der Nachkriegsnöte und sozialen Probleme jedoch groß. Die Verantwortlichen in der Pfälzischen Landeskirche gründeten im Jahr 1948 die "Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst" in Speyer und boten dort zunächst zwei Ausbildungsgänge für Gemeindehelferinnen und für Wohlfahrtspflegerinnen an. Damit war die erste protestantische Ausbildungsstätte für Sozialarbeit und Gemeindepädagogik in der Pfalz und für Rheinland-Pfalz eröffnet. Aus ihr ging mit der staatlichen Anerkennung im Jahr 1950 das "Seminar für Sozialberufe", ab 1964 mit dem Zusatz "Höhere Fachschule für Sozialarbeit", hervor, das 1970 nach Ludwigshafen am Rhein in einen Neubau umzog und dort noch für ein gutes Jahr zu den "Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik" umfirmierte bzw. erweitert wurde, bevor diese in der zum Oktober 1971 eröffneten Fachhochschule der Pfälzischen Landeskirche aufgingen.Die vorliegende Untersuchung möchte gleichermaßen einen Beitrag zur Professions-, Disziplin- und Institutionengeschichte der Sozialen Arbeit und kirchlich-diakonischer Berufe wie zur Zeitgeschichte der evangelischen Kirche mit ihrer Diakonie leisten. Sie widmet sich den evangelischen Ausbildungsstätten in der Pfalz im sekundären Bildungsbereich in den Jahren 1948 bis 1971 mit der entsprechenden Vorgeschichte seit 1945. Angefügt ist zudem ein Überblick über die Entwicklungen der sich anschließenden Bildungseinrichtung des tertiären Bereiches, der Evangelischen Fachhochschule in Ludwigshafen, von 1971 bis 2008. Die hier erforschten Entwicklungen zeichnen exemplarisch den Prozess der Professionalisierung des Berufes und den Weg der disziplinären Akademisierung der Sozialen Arbeit und z.T. auch der Gemeinde- bzw. Religionspädagogik nach.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1. Hintergründe zur Entstehung der ersten evangelischen
Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen und
Gemeindehelferinnen in der Pfalz – die Vorgeschichte der
Schulgründung
1.1. Not, Leid und soziale Probleme des Krieges in Deutschland
1.2. Besonderheiten in der französischen Zone und die soziale Situation in der Pfalz
1.3. Kirchlicher Wiederaufbau in Deutschland und der Beginn einer diakonischen Sozialen Arbeit in der Pfalz
Inhaltsverzeichnis
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Einführung
- 1. Hintergründe zur Entstehung der ersten evangelischen Ausbildungsstätte für Wohlfahrtspflegerinnen und Gemeindehelferinnen in der Pfalz – die Vorgeschichte der Schulgründung
- 2. Zum Leben und Wirken der Gründungsbeauftragten und der beiden ersten Schulleitungen
- 3. Die „Evangelische Schule für kirchlichen und sozialen Dienst“ in Speyer (1948-1950)
- 4. Das „Seminar für Sozialberufe“ in Speyer (1950-1964)
- 5. Die haupt- und nebenamtlichen Lehrerinnen und Lehrer und das weitere Personal (1948 bis 1970)
- 6. Das „Seminar für Sozialberufe – Höhere Fachschule für Sozialarbeit“ in Speyer (1964-1970)
- 7. Die „Höheren Fachschulen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik“ in Ludwigshafen am Rhein (1970-1971)
- 9. Vier Entwicklungslinien der Ausbildungsgeschichte Sozialer Arbeit in Speyer und Ludwigshafen
- Quellen
- Impressum