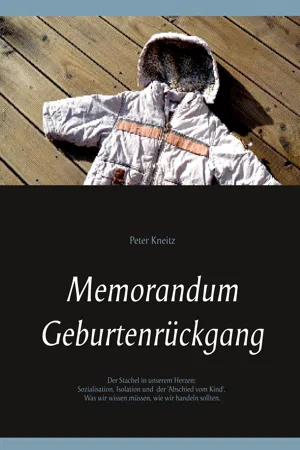![]()
I
Der Abschied vom Kind:
Die Ursachen des Geburten- und Bevölkerungsrückgangs
Die Aufgabe dieses ersten Hauptteils besteht darin, klar benennbare Ursachen des Geburten- und Bevölkerungsrückgangs herauszuarbeiten. Erst auf der Basis eines wirklichen Ursachenverständnisses, einer echten Diagnose, kann auch eine ernsthafte, zukunftsweisende gesellschaftspolitische Diskussion und Auseinandersetzung über mögliche Veränderungen beginnen. Ganz im Gegensatz zur heutigen Situation, in der wir zwischen einem scheinbar rationalen, kühlen und technokratischen Abarbeiten des demographischen Wandels und einem emotionalen Aufbegehren schwanken, ohne zu versuchen, an die wirkliche Wurzel des Problems vorzudringen.
Die Ausgangsfrage ist eindeutig: Was bringt uns Menschen denn immer öfter dazu, weniger oder sogar gar keine Kinder zu bekommen, als Ergebnis einer seit langen Zeit an Fahrt aufnehmenden Entwicklung des Geburtenrückgangs, und trotz einer historisch einmaligen Situation von Wohlstand und Sicherheit? Was nur können die Gründe für diesen einmaligen und seltsamen Vorgang sein?
Die bisherigen Antwortversuche haben zu keinem wirklich befriedigenden Ergebnis geführt. Die genaue Umkehrung des früher üblichen Verhaltens – also die moderne Entscheidung gegen Kinder trotz überragend guter Lebensbedingungen – lässt sich trotz aller Bemühungen bislang nicht in grundlegender Weise verstehen. Weder sind besondere äußere Ursachen erkennbar, wie Hungersnöte oder Krankheiten, noch sind die Hinweise auf die angebliche ‚Logik des Wohlstandes’ ausreichend. Die Behauptung, dass wir heute keine Kinder mehr bekommen, weil wir uns angeblich auf die Sozialversicherungssysteme verlassen können, ist doch in Wahrheit ein Ammenmärchen, erfunden von Wissenschaftlern, die offenbar keine Ahnung von den mannigfachen Herausforderungen der Kindererziehung hatten. Die Gründe, Kinder zu bekommen, lassen sich niemals auf kühle wirtschaftliche Rationalität reduzieren. Denn wenn es so wäre, dann hätten sich unsere Vorfahren im Rahmen ihrer häufig äußerst schwierigen Lebensumständen ‚vernünftigerweise‘ doch schon immer gegen die beträchtlichen Mühen und Gefahren des Kinderbekommens und -erziehens entscheiden müssen – und wir wären nie entstanden. Immer bleibt eine Erklärungslücke, bleiben Widersprüche, versucht man sie auch noch so sehr mit rationalen – aber letztlich nur scheinbar oder vordergründig rationalen – Argumenten ‚zuzukleistern‘.
Eine derartige ‚vertrackte‘ Situation, in der jede logische Erklärung verbaut zu sein scheint, löst man nach aller Erfahrung damit, dass man neue, bislang unbeachtet gebliebene Betrachtungsweisen sucht. Wenn die Sonne nicht um die Erde kreisen kann, wie wäre es dann, wenn man – zumindest versuchsweise – die Erde um die Sonne kreisen lässt?
Das folgende, erste Kapitel ist genau dieser Suche nach einer völlig neuartigen Perspektive gewidmet. Der Beantwortung der oben genannten, alles entscheidenden Frage nach den Gründen für die Abkehr vom Kinde nähert man sich genau dann an, soviel kann bereits verraten werden, wenn man nicht sofort vordergründigen Verdachtsmomenten nachgeht, nicht sofort, aus einem angeblichen Vorwissen heraus, sofort Antworten auf die Frage gibt, warum es denn weniger Kinder gäbe. Sondern wenn man erst einmal in grundsätzlicher und umgekehrter Weise überlegt, was, eigentlich, uns Menschen veranlasst, Kinder zu bekommen. Nicht im Sinne einer rationalen Entscheidung unseres Alltaglebens, sondern überhaupt und in grundsätzlicher Weise. Diese Fragevariante zielt auf unsere Daseinsform als Lebewesen und auf grundlegende Prinzipien von Leben ab.
Einmal gestellt wird diese Frage es erlauben, eine völlig neuartige, zunächst nur theoretische Möglichkeit für den Geburtenrückgang zu formulieren. Eine Möglichkeit, die sich durch überraschende Beobachtungen und Indikatoren mehr und mehr zu einem harten, realen Befund erhärten wird. So wird es gelingen, sich aus den Zwängen herkömmlicher Argumentationen zu befreien und eine völlig neue, ebenso faszinierende wie letztlich einfache Sichtweise zu formulieren.
Die Spurensuche, die sich in den folgenden Kapiteln von dieser Überlegung aus eröffnen wird, führt nach und nach zu dieser, überaus überraschenden Einsicht: Die Abkehr vom Kinde, so kann vorweggenommen werden, erfolgt durchaus gegen unseren Willen. Sie ist das das Resultat einer neuartigen und gravierenden Veränderung tiefliegender Verhaltensanteile, jener Anteile, die die Wurzeln unseres Daseins als Lebewesen ausmachen. Sie ist das Resultat einer neuartigen, allmählich alltäglich gewordenen Entwicklungsbedingung, die unser Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Und dies, so wird zu zeigen sein, über einen eigentlich ganz simplen, banalen und für jedermann sichtbaren Weg: den der Sozialisation.
Das Deutungsmuster, das hier bereits am Horizont sichtbar wird, erlaubt es, den Abschied vom Kind in folgender Weise erklären: Die bereits viele Jahrhunderte andauernde Geschichte des Geburtenrückgangs von einem lokalen zu einem globalen Phänomen lässt sich als Resultat einer immer weiter um sich greifenden, sich selbst verstärkenden historischen und nun global gewordenen Neugestaltung unserer Sozialisationspraxis erklären, als Resultat eines überaus dramatischen Bruchs mit unseren angestammten Entwicklungsbedingungen. Einer überaus gewaltigen Veränderung der Art und Weise, wie wir die Grundlagen unserer Persönlichkeit gestalten – wenn sie auch für den einzelnen Menschen in seinem vergleichsweise kurzen Lebensverlauf kaum erkennbar ist und sie sich deshalb weitgehend stillschweigend durchgesetzt hat. Oder anders, als kurze These formuliert: Es besteht ein scheinbar seltsamer, in Wahrheit überaus logischer Zusammenhang von Sozialisation, Isolation und dem daraus resultierenden ‚Abschied vom Kind‘.
Die historischen Demographen haben den zweiten Teil dieses Zusammenhangs, also die allmähliche, jahrhundertelange Entwicklung des Geburtenrückgangs, in mühsamer Arbeit erkannt und nachvollziehbar gemacht (Coale und Watkins 1986, Dittgen 1996, Jones and Tertilt 2006, Cummins 2009): Wie der Geburtenrückgang ohne besonderen Grund im ausgehenden Mittelalter unter ausgewählten europäischen Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise Adeligen in Süd- und Westeuropa erstmals nachweisbar wurde, wie sich dieser Trend gegen Kinder dann auf Länderebene zuerst in Frankreich ab ca. 1750 manifestierte, wie sich dann, ähnlich einer Epidemie, immer neue Länder ‚anzustecken‘ begannen, wie die ‚Krankheit‘ auf immer neue Kontinente übergriff, bis hin zum heutigen globalen, immer schnelleren Rückgang der Geburtenzahlen in immer mehr Ländern. Im Laufe der Zeit ist so aus einem höchst speziellen Problem einzelner Bevölkerungsgruppen ein französisches, dann westeuropäisches, dann europäisches, fernöstliches und schließlich globales Phänomen geworden – wie gesagt, in 180 von 186 Ländern gehen derzeit die Geburtenzahlen zurück oder verharren bereits seit langer Zeit auf niedrigem Niveau.
Der erste und entscheidende Teil des prognostizierten Zusammenhangs hingegen, die Einsicht in die kausalen Ursachen, verharrt im Dunkeln. Sie offenbart sich nur, wenn man es wagt, über das sichtbare demographische Phänomen hinaus zu fragen, im festen Vertrauen darauf, dass sich hinter dem ‚Naturgesetz‘ einer scheinbar unerbittlich voranschreitenden Entwicklung eine ‚hausgemachte‘, von uns Menschen selbst erzeugte und tief in uns verankerte Problematik verbergen muss. Die Aufgabe des folgenden Hauptteils wird es sein, diesem Verdacht nachzugehen und uns auf eine ungemein spannende Entdeckungsreise hin zu den stillen, gut verborgenen Ursachen des Geburtenrückgangs mitzunehmen.
![]()
Kapitel 1: Das Prinzip ‚Leben‘
Wenn Demographen und Politiker über den Geburtenrückgang reden, dann gehen sie in aller Regelmäßigkeit davon aus, dass hier erwachsene Menschen erwachsene, rationale Entscheidungen treffen. Und so kommen sie dann in der Folge regelmäßig auf den Gedanken, die rationale Entscheidungsfindung zugunsten von Kindern durch Geldgeschenke und strukturelle Maßnahmen wie eine bessere Kinderbetreuung zu fördern. Schon an dem weitgehenden Misserfolg dieser Instrumente sieht man allerdings, dass eine derartige Sichtweise offenbar nicht ausreicht. Dass sie nur scheinbar vernünftig ist – aber die Abkehr vom Kind nicht erklären kann. Dass der Appell an eine vernünftige Erwachsenenlogik mit aller Regelmäßigkeit auf taube Ohren fällt, da, so muss wohl vermutet werden, das Verhalten letztlich auf anderen Ursachen basiert. Vielleicht weniger leicht erkennbar, aber weit mächtiger. Wie nur könnte eine derartige Logik, ein derartig ‚geheimer‘ Ursachenzusammenhang beschaffen sein?
Gibt man einem derartigen kritischen Denken für einen Moment Raum, sucht man jenseits der vorhandenen Antworten nach einer Lösung, so drängen sich andere, grundsätzliche Fragen auf: Was ist eigentlich Fertilität, woher kommt sie und wie genau ist sie in uns verankert? Und lassen sich auf dieser fundamentalen Ebene unseres Seins vielleicht Antworten auf die gravierende Verhaltensänderung in Bezug auf eigene Kinder, in Bezug auf den Umgang mit unserer eigenen Fruchtbarkeit finden?
Folgt man diesen Fragen, so ergibt sich recht unschwer die folgende Erkenntnis: Unsere Möglichkeit für Kinder ist doch keineswegs eine beliebige, eine banale Option. Sie unterscheidet sich grundsätzlich von unseren rationalen Entscheidungen im Alltag, von unserem Tagesplan, von all den wirtschaftlichen oder emotionalen Abwägungen, die unser Leben begleiten, über den Nutzen eines Autokaufs beispielsweise oder der Entscheidung über diese oder jene Reise. Die Fähigkeit Nachwuchs zu bekommen gehört vielmehr als ein substantieller, existentieller Bestandteil unseres Lebens zu uns. Es ist eine Kategorie, die im Grundsatz eher mit unseren elementaren Ansprüchen an Atmen, Essen und Trinken vergleichbar ist. Sie ist uns ‚einfach‘ mitgegeben, sie ist gegebener Teil unserer Existenz, unseres Wesens und damit nicht in freier Weise verhandelbar.
Wir werden in aller Regel als Mann oder Frau geboren (Sonderfälle einmal abgesehen). Wir sind in ganz selbstverständlicher Weise sexuelle Wesen, wir sind unweigerlich darauf angelegt, Kinder zu bekommen, ob wir wollen oder nicht. Und es kann ja auch gar nicht anders sein: Denn wir sind Lebewesen, wir sind Organismen. Die Fähigkeit zur Reproduktion ist eine der wesentlichen Kennzeichen für das Prinzip ‚Leben‘ und ist auch uns unzweifelhaft von Geburt an, genauer: vom Zeitpunkt unserer Zeugung, als wesentlicher Bestandteil unseres Daseins, mitgegeben. Leben will unweigerlich Leben hervorbringen, denn sonst geht es zugrunde.
Damit soll übrigens keineswegs bestritten werden, dass wir Menschen aufgrund einer angeblich ‚natürlichen Notwendigkeit‘ etwa nicht in der Lage wären, zum Thema Nachwuchs bewusste Entscheidungen zu treffen. Natürlich und sehr erfreulicherweise können wir dies. Wir sind sogar ganz offenkundig in der Lage, uns gezielt und bewusst auch gegen eigenen Nachwuchs zu entscheiden – vermutlich ein ziemlich einmaliges Sonderverhalten unter allen Lebewesen. Selbstverständlich können wir auch das. Aber es muss doch sehr wohl stutzig machen, auf dem Hintergrund unserer derartig fundamentalen, auf eigenen Nachwuchs angelegten Konstitution, wenn immer mehr Menschen nicht nur weniger, sondern sogar häufig gar keine Kinder mehr bekommen. Wenn Kinder zu bekommen für viele Menschen geradezu ein schwieriges Problem geworden ist, ein komplexes Vorhaben. Auch im Namen einer angeblichen ‚Freiheit menschlichen Verhaltens‘ bleibt eine derartige Entwicklung unverständlich. Es kommt ja auch niemand auf den Gedanken, Essen, Trinken oder Atem holen vollständig einzustellen.
Wie, so muss daher gefragt werden, kann ein derartig und auf tiefster Ebene angelegter ‚Drang‘ oder ‚Trieb‘, um einmal diese vermutlich heute altertümlichen und nicht mehr besonders korrekten Begriffe zu benutzen, einfach so ad acta gelegt werden? Wie lässt sich das Paradox erklären, dass wir menschlichen Lebewesen uns ohne besonderen äußeren Zwang und unter hervorragenden Rahmenbedingungen gegen das Prinzip ‚Leben‘ entscheiden? Wollen wir, so kann zugespitzt gefragt werden, etwa gar nicht mehr – leben?
Dabei lässt aufhorchen, dass sich die allermeisten Menschen in Wahrheit keineswegs gezielt gegen eigene Kinder entscheiden. Fast alle Personen äußern sich, zumindest in manchen Lebensphasen, sehr wohl positiv zum Gedanken, eigene Kinder zu haben. Sie scheinen damit durchaus im Einklang mit der oben skizzierten Feststellung von Fertilität als elementarer Bestandteil menschlichen Lebens. In den meisten Fällen passiert es vielmehr ‚einfach‘: Mal ist nicht der richtige Partner da, mal steht die berufliche Ausbildung oder die Karriere im Vordergrund, mal sind die finanziellen Möglichkeiten nicht so, wie man es sich vorstellt – und irgendwann ist es einfach zu spät. Aber derartige Beobachtungen reichen nicht, denn sie führen doch unvermeidlich wieder zur schon gestellten Frage: Warum ist das heute, unter historisch einmalig günstigen, sicheren, wohlhabenden Zeiten so? Woher kommt diese plötzliche Gleichgültigkeit?
Ich weiß, man erklärt das heute in der Regel mit den komplexen Anforderungen des modernen Lebens, der längeren Ausbildung, dem späteren Heiratsalter. Aber auch das ist keine wirkliche Antwort, weil sich wiederum sofort die mehrfach genannte, quälende Gegenfrage aufdrängt: Warum haben umgekehrt in früheren Epochen, die in der Regel doch sehr viel schwierigere Lebensumstände bereithielten, Menschen – gleichsam gegen alle Vernunft – überhaupt Kinder bekommen? Die heutigen subjektiv als ‚schwierig‘ empfundenen Lebensumstände sind in Wahrheit doch Luxus pur, was Stabilität und Wohlstand anbelangt. Eigentlich hätten sich Menschen vernünftigerweise früher gegen Kinder entscheiden müssen, nicht erst heute. Schon unsere Vorfahren hätten so denken müssen – und wir, wir wären dann nie entstanden. Rationale Überlegungen und erwachsene Entscheidungen reichen nicht aus, es zeigt sich wieder und wieder, um die Widersprüche der modernen ‚Abkehr vom Kind‘ zu erklären.
Geht man jedoch erneut auf die genannte grundsätzliche Ebene unserer Fruchtbarkeit zurück, so ergibt sich eine neue, zunächst völlig abstrakte und theoretische Möglichkeit der Erklärung: Ist vielleicht die Abkehr vom Kinde gar kein bewusstes, kein rational-erwachsenes Verhalten? Lassen sich die Widersprüchlichkeiten dieses neuartigen und plötzlich ‚wie wild‘ um sich greifenden Geburtenrückgangs nicht besser damit erklären, dass sich auf einer sehr tiefen Ebene unseres Verhaltens, unserer Entwicklung, Veränderungen ergeben haben – eben auf der grundsätzlichen Ebene unserer mitgegebenen Fertilität, von Fruchtbarkeit als Teil unseres Daseins? Veränderungen, die unser ‚Prinzip Leben‘ beeinträchtigen, uns gleichsam gegen unseren Willen, unfreiwillig, dazu drängen, dass wir uns lieber mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen, aber eigene Kinder als nachrangig betrachten? Existiert vielleicht eine neuartige Bedingung, die uns gleichsam neu ausrichtet? Kann es sein, dass unsere scheinbar rationale Entscheidung gegen Kinder, oder vermutlich besser: unsere seltsame Gleichgültigkeit gegenüber der Möglichkeit eigener Kinder, aus einer viel tieferen Wurzel unserer Konstitution heraus entsteht, dass sie uns unbemerkt, durchaus gegen unseren Willen, auferlegt wird, als Folge einer neuartigen Entwicklung, einer neuartigen Ausrichtung unserer Persönlichkeit?
Diese Idee, dieser Gedankenanstoß, mag auf dem Hintergrund unserer dominanten Tendenz, uns als ein rein rationales, alleine von bewussten Gedanken und vernünftigen Entscheidungen geleitetes Wesen zu begreifen, auf dem ersten Blick als höchst seltsam anmuten. Dabei ist in den letzten Jahrzehnten der Entwicklungsforschung doch längst klargeworden, dass das intellektuelle Entscheidungsverhalten nur einen Teil unsers Verhaltens erklären kann. Dass es bei genauerer Betrachtung sogar höchst naiv wäre, uns nur so zu verstehen.
Wir verfügen vielmehr über eine Vielzahl von Verhaltens- und Reaktionsebenen, wobei die jeweilige, von den gegebenen Umständen abhängige physische Entwicklung unseres Gehirns, unserer Nerven und aller zugehörigen Strukturen die Basis für unsere Persönlichkeit, für unser Denken und auch und gerade für unsere Gefühle darstellen. Der Entwicklungsprozess, insbesondere in unseren ersten Lebensmonaten und -jahren, so hat sich doch mittlerweile gezeigt, formt die tiefsten, elementaren Strukturen unseres Körpers, er formt unser Gehirn, unser Nervensystem, unsere Hormonregulation und vieles anderes mehr. Zugleich, und auf diesen speziellen, einmaligen physischen Elementen aufbauend, entsteht unsere einzigartige Persönlichkeit, unsere Emotionen und unser Denken, also alles, was wir fühlen, was wir denken, was wir begreifen können – und was nicht. Insoweit ist die Möglichkeit einer Störung grundsätzlicher Aspekte unserer Entwicklung nur folgerichtig.
Ein einzigartiges, bereits mehrere Jahrzehnte altes Experiment unterstützt nun genau die oben angedachte Theorie oder Hypothese. Das folgende Kapitel wird es ausgehend von diesem Experiment erlauben, erste genauere Vorstellungen von den Ursachen des Geburtenrückgangs zu bekommen. Und mehr: Es offeriert ein grundsätzliches, anschauliches Modell zum Verständnis unseres befremdlichen Abschieds vom Prinzip ‚Leben‘.
![]()
Kapitel 2: Harry Harlow und sein Isolationsexperiment
Vor rund sechzig Jahren haben der amerikanische Verhaltensforscher Harry Harlow und sein Team eine Reihe aufsehenerregender Experimente durchgeführt. Sie isolierten in den 1950er Jahren kleine Rhesusaffen unmittelbar nach ihrer Geburt und ließen sie dann alleine aufwachsen. Den kleinen Tieren ging es äußerlich gesehen gut: Sie wurden ausreichend versorgt, sie bekamen genügend zu Essen und zu Trinken, sie waren vor Unwettern gut geschützt – sie mussten ‚nur‘ aufwachsen, allerdings ganz alleine, ohne soziale Kontakte. Nach mehreren Monaten hat man sie dann aus ihrer Isolation erlöst und i...