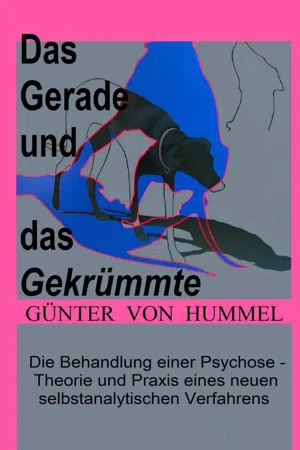
eBook - ePub
Das Gerade und das Gekrümmte
Die Behandlung einer 'Psychose' - Theorie und Praxis eines neuen selbstanalytischen Verfahrens
- 200 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Das Gerade und das Gekrümmte
Die Behandlung einer 'Psychose' - Theorie und Praxis eines neuen selbstanalytischen Verfahrens
Über dieses Buch
In diesem Buch geht es um eine Psychoanalyse "!andersherum", mittels der auch komplexere psychische Erkrankungen und psychosomatische Störungen behandelbar sind. Anhand einer Fallgeschichte zeigt der Autor nicht nur den Erfolg der Behandlung auf, sondern erklärt auch Theorie und Praxis dieses etwas anders gearteten analytischen Verfahrens.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das Gerade und das Gekrümmte von Günter von Hummel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychology & History & Theory in Psychology. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
I. DIE PSYCHOANALYSE VON STEFAN R.
I. 1 Erste Stellungnahmen zur Fallgeschichte.
Stefan R. kam zwei- bis dreimal die Woche zu mir. Oft redete er so wie in seinen Tagebüchern, oft schrie er herum, meist aber konnte man mit ihm ganz normal über alles reden. Sehr schnell bezog er eine Bemerkung persönlich auf sich, es war klar, dass ich mich behutsam ausdrücken musste, aber manchmal gelang dies nicht so perfekt. Nach den ersten Klinikaufenthalten verließ ihn seine Freundin, die also auch die Mutter seines Kindes war. Einige Male hatte er Beziehung zu anderen Frauen, oft aus gar nicht akademischem Kreisen, die also auch äußerst wenig mit seinen Ideen anfangen konnten. Doch er war eine sportliche und gut aussehende Erscheinung und hatte es nicht schwer jemand kennen zu lernen. Meistens kreisten seine Erzählungen um die Kinmdheit.
„Und die langen Sommer, die Sommerfrischensommer, die Heuwagensommer-sommer, wo es noch Faszinationen des Geschmacks und der Gerüche gab und Mit-Tiere und Mit-Dinge und Mit-Mirs. Warum reden wir immer nur vom Mit-Menschen, wo es doch auch so wichtige Mit-Dinge gibt, Mit-Dirs, ‚Mits‘ ganz einfach? Tautropfen-Gras und Wölbe-Wolken, Perl-Wasser-Betten im nahen Bach, ein Schnitzmesser, ein Baumstumpf! Meine Mit-Dinge, die mit in meine Träume gingen, die zu mir sprachen, die zu mir gehörten. Meine Mit-Tiere, die Mit-Katzen, die Langbein-Spinnen, die Gefieder-Vögel und die mit-metallenen Käfer! Alles Mits, Blatt-Mits, Fuß-Mits, Mit-Mits. Meine Mits-Menschen dagegen, Mit-Mäschigen, Mittel-Mässigen, -essigen, Lästig-Lässigen, Mätschigen, wer waren sie? Wo waren sie Mit? Sie oder Es? Ich hatte sie nicht.“
„Sommertaghungrig, wir fuhren durch die Welt, oder auch blickverloren und nachtblaß. Baumvergessen in den Zweigen dem Wispern des Windes lauschend. Meine Mutter war eine Domina, eine im domus nie da, und mein Vater war ihr Feind. Er hatte die Hände des Arbeiters, rauhe, schartige Hände und war schwach aber lüstern. Er beobachtete die Mutter durchs Schlüsselloch im Badezimmer, anders ging nichts. Windsauge, sieh es doch . . der arme Teufel. Er hat den Sex seiner eigenen Frau nur in seinem Auge. Meine Mutter war anordnend, befehlend, dirigierend, kommandierend. Sie war nie ein Körper-Warmes, eine Fühl-Heit, eine Nackthaut, gestreichelt, geliebkost auf dass der Geruch nach Wohligem, ein Prickeln oder Liebesstaunen hätte aufkeimen können.“
„Manchmal sperrte sich meine Mutter nach Streit mit dem Vater tagelang im Speicher ein und drohte sich umzubringen. Wir Kinder weinten und bettelten, Angsttage verlorener Kindheit, verratener Unschuld, entsetzlicher Verlorenheit, schrecklicher Abgründe. So gab es nur die leeren Augen am Grunde der Mondnächte, der Schneewächten . . . . Andere Kinder hatten eine Mama, ein Kosewortwesen, eine Wärmehand, eine Schmeichelbrust, eine Märchenstimme, Nachttraum – und Einschlafaugen – ich hatte nur eine Muatta.“
So gehen die Aufzeichnungen Stefan R.s weiter. Und wirklich: sind nicht schon diese ersten Worte Stefan R.s weniger gerade als gekrümmt? Geartet, geh artig, Ar- Tick? Sommer-Sommer, Mit-Mits, Sie- oder Es-Mits?“ Und plötzlich der Einbruch von Vatta und Muatta und ein Wortklangspiel: Domina- im domus nie da und Nächten und Wächten? Und woher kommen die Meeresaugen? Hört man psychoanalytisch verstanden nicht eine Dissoziation heraus, eine Spaltung, Realitätsferne?28 Durchbrechen, eine Kluft tritt auf, ein erster Rand bildet sich. Eine Struktur des von innen nach außen und von außen nach innen? Eine Schlinge, deren hungriger Lust-Vektor zu sich selbst zurückkehrt und so eine Kluft offen lässt? Der Rand des Mundes, der eine Schleife der Lust zur Brust der Mutter und zurück zieht, der Mund-, der Oral-Trieb? Ein Trieb, der eigentlich ein Sprechen ist, weil er die Brust der Mutter dermaßen für sich beansprucht, dass das Kind glaubt, sie gehöre zu ihm.29 Tatsächlich also eine ganz primitive Triade von Trieb (an dem noch das Bedürfnis des Hungers hängt), Struktur (Mutter) und Hemmung, Verdrängung, Spaltung, wie ich sie im Vorwort erwähnt habe. Vielleicht klingt dies alles zu abstrakt, theoretisch, zu distanziert und nüchtern. Dennoch glaube ich, zeigt uns Stefan R. besser als viele „Normale“, um was und wie es geht.
„Auch das Schreien muss man salonfähig machen! Wir brauchen einen Schreikult, ein Ausschreien, Anschreien, Hinaus-, Heraus- und Davonschreien. Und ein Dagegenschreien gegen die Mutlosigkeit und Lethargie der Welt. Schreien und Speien, ja Wurf- und Schießschreie, Fels-Tonnen-Danieder-Schreie, Bomben-Krach- und Dynamitschreie, damit endlich alle es hören: hört auf mit eurer Spießigkeit und Kälte! Schreit und schreitet davon . . .“
Das Kind sieht beim Stillen die Mutter an. Der Rand der Pupille, der die ersten Beziehungen zu den Objekten der Welt reguliert, zu Farben, Konturen einerseits, spielt genau so eine Rolle wie der Anspruch, Anruf an die Mutter andererseits? Auch diese Triebe beinhalten also die gleiche signifikante Operation, jenes „von innen nach außen“, wie ich im Vorwort sagte, aber gleichzeitig auch die Abwehr des anderen Triebs, jenes „von außen nach innen“?30 So kommt also auch aus dem Auge der Mutter ein Ver-Sprechen, ein Halb-Sprechen, aber keine konkrete und dauerhafte wirkliche Ant-Wort. Und so entsteht das Orale. Das erste „Mitding“, „Mittendrin-Ding, dingdrin.“
Wie J. Lacan es ausdrückte, „verwerfen“ die „Psychotiker“ eine zentrale Metapher aus ihrem Seelenleben, die Lacan weniger mit dem Wesen der Mutter als mit dem Wesen des Vaters, der schöpferischen ‚Benamung‘, dem „phallischen Signifikanten“ in Zusammenhang brachte.31 Selbst wenn um die Mutter geht, taucht die Frage auf, wie sie den Vater kommuniziert, wie sie symbolisch den Erzeuger vermittelt, wie sie im Bedeutungsdiskurs als das auftaucht, was die Sprache ihr im Namen dessen auferlegt, was vom ‚Namensgeber‘ her stammt. Die „Psychotiker“ nehmen irgendwie die Sprache nicht ernst, nicht im Rahmen der Bedeutungen, der Nominierungen eines Mangels, des Kastrativen innerhalb des Sexuellen, und so fehlt zwischen ihnen und den anderen ein Band der Verständigung, die auch die anderen nicht zustande bringen.
Dass man das Genießen nur reduziert haben und nicht unerschöpflich von einer Lust zur nächsten taumeln kann, sehen sie zu wenig. Ihre Selbst-Verdeutlichung mischt sich nicht konstruktiv mit der Anders-Verdeutlichung und führt daher nicht zu einer generellen Verdeutlichungsmöglichkeit. Mit seinen Deutungs-Konstruktionen, die er dem Unbewussten entnimmt, muss der Analytiker dazu verhelfen, dass er das Erleben des „Psychotikers“ kennt, aber man es in eine gute Sprache, in eine generell umsetzbare Vermittlung bringen muss. „Salonfähig!“
„So [weil eben nicht paternal ‚benamt‘] bleibt die Bedeutung, die durch den Signifikanten des Begehrens der Mutter geschaffen worden wäre, rätselhaft, und auf die Frage, was die Mutter begehrt, gibt es keine Antwort.“32 Die Mutter hätte im Namen des Vaters sprechen müssen (damit ist nicht unbedingt der konkrete Vater gemeint, sondern ein prinzipieller), damit „die Scham als affektive Grundtönung den Substituierungsprozeß des mütterlichen Begehrens begleitet, was im Falle der „Psychose“ das Subjekt in höchste Bestürzung treibt, sobald es sich einem Objekt gegenüber sieht, das eine Metaphorisierung innerhalb des phallischen Bedeutungsrahmens erfordert oder erzwingt.“32 So ausgedrückt ist es für den Laien wahrscheinlich nicht leicht zu verstehen, lassen wir es daher Stefan R. selber sagen:
„Ich denke in Bildern der Körper, in Metamorphosen des Schleims, der Milch, des Wachsens und des Samens, die alle unendlich fließen, aufquellen und wieder wildwuchern, hoch-, auf-, empor-, und über- überwachsen. Großwachsen, prallwachsen, wachwachsen. Zerwachsen, zerplatzen, zerfetzen. Schließlich zerlusten sie sich . . und fangen wieder von vorne an.“
Die Lust findet keinen Halt, sie braucht eine Metapher, aber wer gibt sie uns? Sie bleibt unbewusst. Freud spricht davon, dass auch Denkvorgänge unbewusst sind,33 dass es Gedanken gibt, die nicht das Ich denkt sondern die das Unbewusste verkörpern.34 Aber was soll das sein, ein unbewusstes Denken? Schließlich sind wir gewohnt, dass wir das Denken mit sprachlich und bewusst verbinden. Zwar ist jedem von uns bekannt, dass wir manchmal im Traum ganze Tiraden oder auch Sätze denken, doch sind diese Gedanken oft nicht ganz logisch, folgerichtig und sprachlich klar. Wir sprechen daher auch vom „assoziativen“ Denken, das flüchtig und sprunghaft ist und das mehr den Trieben, dem Es gehorcht. Dennoch ist gerade dieses Denken oft in der Lage, unbewusst ein „schwieriges intellektuelles Problem“ zu lösen, wie Freud sagte. Freud spricht ebenfalls von dem „Denken in Bildern“, für das dann bezüglich der „Relationen, die den Gedanken `üblicherweise] besonders kennzeichnen, ein visueller Ausdruck nicht gegeben werden kann. Das Denken in Bildern ist also ein nur sehr unvollkommenes Bewusstwerden. Es steht irgendwie den unbewussten Vorgängen näher als das Denken in Worten . .“35 Exakt für dieses „irgendwie“, das also auch Stefan R. plagt, werden wir eine Lösung in unserem Vorgehen finden, weil sich darin auch das fremde Denken mit dem eigenen und das „normale“ mit dem psychotischen in klarere Zusammenhänge bringen lässt.
Ich will also von einem dialogischen, gerade / gekrümmten oder konjekturalem Denken sprechen, das die Menschen auszeichnen sollte?36 Ein flexibles Denken, ein Zusammen-Denken. Ein Denken im wissenschaftlichen Sinne, aber äußerst anschaulich, gekrümmt-geometrisch, konstruktiv. Im gleichen Sinne sind die Philosophen – gerade in der Moderne, etwa M. Foucault oder J. Derrida – davon ausgegangen, sich die Dinge, die Welt, so zu denken, wie sie eigentlich nicht ist, wie sie aber, von da aus konstituiert, viel eigentlicher und wirklicher zu sein hätte. Wie konnte man – ironisch gesagt – nur so blöd sein, sich die Welt so zu denken wie sie ist, kann doch schon das Denken allein das Sein erheblich stören, wie man an jedem Grübler sehen kann.37 Wir sind – sagt Lacan in einem gewissen Gegensatz zu Descartes – wo wir nicht denken zu sein. Da, wo wir wirklich sind, existiert ein so unbewusstes Denken, dass das Wort „denken“ schon fast nicht mehr passt und man daher unmöglich direkt davon etwas sagen kann. Und genau aus diesem Grund denkt es sich der „Psychotiker“ und der uns Fremde nicht so wie wir, sondern er lebt es. Er ist es. Er krümmt es, er krümmt sich mit ihm, um es gerade hinzubringen und so taumelt er nach vorne, anders als wir.
Das ‚psychotische“ Ich ist zerstückelt und erscheint daher als ein Anderes, aber gleichzeitig lernen wir „Genormte“ dadurch, dass es eine Andersheit in jedem von uns gibt. Das antike Ich ist klein und unbedeutend und es lebt ganz in seinem gespaltenen Anderen, das beispielsweise seine Götter sind, seine „Spiritualität“, seine mystische Hoffnung, seine Lust- und Schattenwelt. Wir dagegen leben im Ich samt seinen Struktur / Trieben, die wir vom Anderen, von unserer Andersheit als solcher her konstitutiv denken müssen oder müssten. Es hätte wenig Sinn, wieder ganz zum antiken Mythos oder Gott zurückzukehren oder unser Ich abzuschaffen, wie es manche Esoteriker lehren. Wir müssen das konjekturale Denken erlernen, auch wenn dies nur ein anderer Ausdruck für Psychoanalyse ist. Gerade in dieser Feinheit der Begrifflichkeiten liegt dann doch ein großer Unterschied zur mystischen Psychophysik Fechners und Freuds. Und zur Mystik überhaupt.
Schon Nietzsche sagte, man muss sich den Menschen so denken, als ob er „ein Knoten wäre in einem Seil, das sich vom Tier zum Übermenschen spannt“. Leider ist er mit dem Übermenschen ins Stolpern geraten, indem er sich diesen als biologisch gezüchtet und durch Erziehung geistig geschult und herangezogen vorgestellt hat. Schließlich hat er das Tier ganz vergessen und an sich selbst als den bereits fertigen Übermenschen geglaubt.38 Hätte er sich den Menschen doch weiterhin als Knoten vorgestellt, wie er sagte, er hätte das Wesen des ‚Psychotikers‘ genau so wie des Normalen, des antiken Menschen genau so wie des modernen Europäers, erfasst und die Psycholinguistik unserer Tage, so wie sie etwa Lacan formuliert, schon vorausgenommen. Denn für Lacan ist der Mensch (egal ob in Ost oder West) und der Beginn von allem (wie ich schon eingangs erwähnte) tatsächlich ein Knoten (ein Fortschritt gegenüber dem Hegelschen Knochen). Ein Trieb-Struktur-Trieb-Knoten. Ein Borromäischer Knoten.39 Man denkt dadurch, dass eine Struktur – die der Sprache nämlich – den Körper zerschneidet“,40 man denkt wie Ödipus mit dem eigenen S...
Inhaltsverzeichnis
- Hinweise
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Die Psychoanalyse von Stefan R.
- II. Der Andere unser Selbst
- III. Der Diskurs als solcher
- Nachwort
- Literaturverzeichnis
- Weitere Informationen
- Impressum