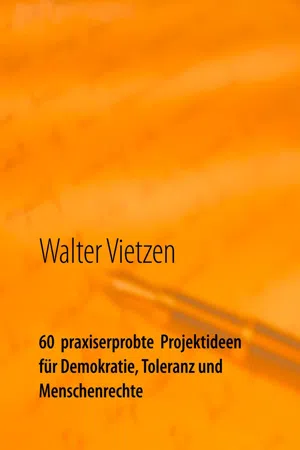![]()
1. Gesellschafts-politische Rahmenbedingungen
I. Die Grundrechte
Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Artikel 2
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Artikel 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
Soweit unser Grundgesetz. Aber ist das unsere gesellschaftliche Realität?
In unserer pluralistischen Gesellschaft sind Einstellungen, die davon ausgehen, dass manche Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion, Hautfarbe, ihrer körperlichen Fähigkeiten und geistigen Verfasstheit oder aufgrund der sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder sozialen Status mehr wert seien als andere, weit verbreitet. Ideologien der Ungleichwertigkeit wie Rassismus, Homophobie, Antisemitismus oder Frauenfeindlichkeit dienen der Legitimation von Diskriminierung und Unterdrückung.
Auch vor den Toren der Schulen macht die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie Ideologien der Ungleichwertigkeit in der wissenschaftlichen Diskussion unter anderem genannt werden, nicht halt.
Eines der obersten Ziele schulischer Bildung überhaupt ist es, junge Menschen zu befähigen, sich in der modernen Gesellschaft zu orientieren und politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme kompetent zu beurteilen. Dabei sollen sie ermuntert werden, für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gerechtigkeit, wirtschaftliche Sicherheit und Frieden einzutreten. Diesem übergeordneten Ziel sind grundsätzlich alle Unterrichtsfächer verpflichtet, insbesondere aber die des gesellschaftswissenschaftlichen Bereichs (siehe Zielsetzung und Aktivitäten der Kultusministerkonferenz).
In der Schule und in der Gesellschaft werden Lebenseinstellungen geprägt. Die Schule ist ein hervorragend geeigneter Ort, um demokratische Werte, soziale Verantwortung und Zivilcourage zu fördern und Ideologien der Ungleichwertigkeit präventiv und dauerhaft wirksam entgegenzuwirken.
Leider wird aber diese Möglichkeit, über die Schule die Gesellschaft positiv zu beeinflussen, viel zu wenig genutzt.
Soziales Lernen wird häufig nicht als vorrangiges Anliegen der Schule betrachtet und damit abgewertet. Gleiches gilt für präventive Maßnahmen gegen menschenverachtende Ideologien. Selten sind z. B. Projekttage gegen Diskriminierung und für Menschenrechte und Toleranz ein fester Bestandteil des Regelunterrichts oder es wird für diese Tage ein Zeitfenster kurz vor den Sommerferien bereitgestellt und damit die Ernsthaftigkeit untergraben.
Die Kultusministerkonferenz betont:
„Die Menschenrechte werden nicht nur durch staatliches Handeln verwirklicht, sondern maßgeblich durch die Haltung und das Engagement jedes Einzelnen. Hierzu muss die Schule durch eine entsprechende Persönlichkeitsbildung einen maßgeblichen Beitrag leisten.“
Eine Schule, die eine diskriminierungsfreie Schulkultur will, muss mehr leisten, als ein medienwirksames Strohfeuer zu entfachen:
Sie will Dauerhaftigkeit im Engagement, sie will den Klimawechsel an der Schule. Dieses Idealbild können Schulen nur schrittweise mit nachhaltigen Konzepten und in ausreichenden Zeiträumen erreichen.
Kinder und Jugendliche wollen und sollen am gesellschaftspolitischen Leben teilhaben, sie wollen ihr Umfeld mit ihren Ideen, Projekten und Aktionen mitgestalten und mitbestimmen.
Partizipation wäre in diesem Verständnis ein kontinuierlicher, verbindlicher Prozess.
Es geht also nicht um das Gewähren von Mitsprache nach Belieben, sondern um verbriefte Rechte. In „Kinder haben ein Recht auf Partizipation“ schreibt das Deutsche Institut für Menschenrechte:
„Schule und außerschulische Lernorte sind zentrale Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist die Verwirklichung des Rechts von Kindern und Jugendlichen auf Partizipation gerade hier so wichtig. Im Bildungskontext wird Partizipation häufig als Mittel zum Zweck, etwa zur Einübung demokratischer Entscheidungsprozesse, verstanden. Aus menschenrechtlicher Perspektive ist ein solches Verständnis jedoch ungenügend: Partizipation ist ein eigenständiges Recht von Kindern und Jugendlichen, das in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist und als Grundprinzip bei der Umsetzung aller Kinderrechte berücksichtigt werden muss.“
Und weiter:
„Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich
Speziell im Bildungskontext scheint die Forderung nach mehr Partizipation von Kindern und Jugendlichen einerseits längst angekommen zu sein: Es gibt viele Programme im Rahmen der Demokratie-Erziehung sowie entsprechende Verankerungen in Schulgesetzen und Bildungsplänen. Andererseits sind es gerade nach wie vor Bildungsinstitutionen, die der Partizipation auch deutliche Grenzen setzen, zum Teil auch unbewusst. Lernziele und -inhalte sind in der Regel vorgegeben. Alle Anwesenden wissen, wer gegebenenfalls Schulnoten vergibt, wer die Steuerung wieder an sich reißen kann, wer für die Anwesenheit bezahlt wird.“1
Rahmenbedingungen sind vorgegeben, Gestaltungsmöglichkeiten dadurch eingeschränkt und die Kommunikation automatisch eine andere als außerhalb von Bildungskontexten. Dieses Hierarchiegefüge sollte zumindest reflektiert und thematisiert werden, wenn Partizipation nachhaltig gelingen soll. Ebenso gilt es kritisch zu beobachten, wer sich an partizipativen Prozessen beteiligt und wer nicht – in anderen Worten: wie inklusiv Partizipation gelingt. Eine vereinfachte Übersetzung des Wortes Partizipation in Teilhabe sowie des Wortes Inklusion in Teil-Sein verdeutlicht den engen Zusammenhang.
Hier geht es um ein breites Inklusionsverständnis: Es geht nicht ausschließlich um Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern um das allgemeine menschenrechtliche Prinzip der Inklusion, das eng verbunden mit dem Diskriminierungsverbot ist. Dementsprechend bezieht sich Inklusion hier auch auf Menschen in Armut, auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auf Lesben, Schwule, Intersexuelle oder Transsexuelle und so weiter.
Gleichzeitig soll der Anwendungsbereich von Partizipation gerade auch in Bildungsinstitutionen möglichst ausgeweitet werden. Relevant ist nicht zuletzt auch das Verständnis und die Intention der Partizipation: Eine grundlegende Unterscheidung findet sich sowohl in der allgemeinen Diskussion um Partizipation in der Bildung als auch in der Umfrage, die das Deutsche Institut für Menschenrechte 2014 unter den für Bildung zuständigen Ministerien der Bundesländer durchführte: einerseits Partizipation als Wert an sich oder als Recht im Sinne einer rechtebasierten Partizipation, andererseits als Mittel zum Zweck. Auch wenn die Grenzen in der praktischen Umsetzung konkreter Maßnahmen nicht immer deutlich sind, weil einzelne Maßnahmen zugleich funktionale und rechtebasierte Partizipation zum Ziel haben können, überwiegt doch meist eine der beiden Intentionen.
Partizipation als Mittel zum Zweck
In pädagogischen Kontexten wird Partizipation häufig funktional oder instrumentell verstanden, als Mittel für einen anderen Zweck. Überspitzt formuliert wird Partizipation unter anderem verstanden als „Heilmittel gegen Demokratieunlust und Gewalt“. Häufig geht es in erster Linie darum, (vermeintlicher) Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, demokratische Entscheidungsprozesse einzuüben oder auch um eine höhere Effektivität und eine größere Akzeptanz einzelner Entscheidungen, etwa die Auswahl des Ausflugsziels einer Lerngruppe oder die Gestaltung des Lernraums.
Oft wird der Grad der Partizipation dadurch eingeschränkt, dass aus einer Vorauswahl, beispielsweise von Ausflugszielen, gewählt werden kann. Meist werden in Bildungskontexten die Themen eingeschränkt, bei denen Partizipation überhaupt möglich ist. Aus funktionaler Sicht ist dies verständlich, denn Aushandlungsprozesse sind voraussetzungsreich und beanspruchen viel Zeit und Raum. Wenn es also darum geht, demokratische Entscheidungsprozesse einzuüben, ist es sinnvoll, dies auf einzelne Themen zu beschränken. Zudem ist es leichter, solche Themen zu wählen, die bei Elternschaft und Lehrpersonal keinen Widerstand hervorrufen, etwa, wenn es um Themen geht, bei denen die Entscheidungen normalerweise anderen Personen vorbehalten sind wie Lerninhalte, finanzielle Entscheidungen oder disziplinarische Maßnahmen.
Rechtebasierte Partizipation
Auch wenn ein funktionales Verständnis von Partizipation seine Berechtigung hat, muss es doch ergänzt werden um eine rechtebasierte Perspektive. Dies unterstützt zudem die Funktionen, die mit Partizipation in der Regel erreicht werden sollen: Ohne kritische Reflexion der Rahmenbedingungen, ohne Ausweitungsbemühungen in die thematische Breite und hierarchische Tiefe werden die Maßnahmen schnell als Scheinpartizipation oder Mogelpackung erkannt. Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche ihre Mitsprachemöglichkeiten insbesondere in der Schule und am Wohnort als gering einschätzen.
Die Beteiligten können frustriert und lustlos werden, sodass gar kein Interesse mehr an demokratischen Prozessen besteht und gemeinsam getroffene Entscheidungen keineswegs von allen Personen unterstützt werden.
Aus menschenrechtlicher Sicht ist Partizipation kein Mittel zum Zweck, sondern ein eigenständiges Recht von Kindern und Jugendlichen wie es auch in der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) verankert ist. Die KRK gilt für alle Menschen bis 18 Jahre und wurde 1992 von Deutschland ratifiziert. Sie kann insofern als revolutionär bezeichnet werden, als sie einen Perspektivwechsel vollzieht: von der Objekt- zur Subjektorientierung, von ausschließlichen Schutzpflichten hin zu Schutz- und Partizipationsrechten. Zentral für Partizipation ist Artikel 12 der KRK, der besagt, dass jedes Kind das Recht hat, seine Meinung in allen es selbst berührenden Angelegenheiten frei zu äußern. Die Meinung des Kindes muss angemessen und entsprechend des Alters und der Reife des Kindes berücksichtigt werden. Partizipation muss als ein Grundprinzip bei der Umsetzung aller Kinderrechte berücksichtigt werden.
Der UN-Kinderrechtsausschuss – das Expertengremium, das die Umsetzung der KRK überwacht – hat bewusst vermieden, ein bestimmtes Alter festzulegen, ab dem Kinder in der Lage sind, sich zu beteiligen. Stattdessen wird betont, dass sich mit den entwickelnden Fähigkeiten und der Reife eines Kindes das Verhalten von Erwachsenen ändern muss, von Anleitung über Rat und Ermahnung hin zu einem Umgang auf Augenhöhe. Erwachsene haben dabei eine unverzichtbare, unterstützende Rolle, die eine ständige Selbstreflexion verlangt, damit Unterstützung nicht ungewollt in Bevormundung umschlägt.
Der UN-Kinderrechtsausschuss entwickelte die folgenden Kriterien, wie die Beteiligung von Kindern gestaltet sein soll:
- transparent und informativ, damit Kinder sie verstehen;
- freiwillig – Kinder sind nicht verpflichtet, ihre Meinung zu äußern. Auch ein Kind, das sich nicht beteiligen will, übt sein Recht auf Beteiligung aus;
- respektvoll – die Meinungen von Kindern müssen geachtet werden;
- bedeutsam für die Bedürfnisse und den Erfahrungsschatz von Kindern;
- kinderfreundlich, das heißt so gestaltet, dass sie für Kinder zugänglich sind und Kinder ermutigen;
- inklusiv, damit alle Kinder ihr Recht auf Partizipation ohne Diskriminierung ausüben können. Auch benachteiligte Kinder müssen sich beteiligen können, entsprechende Barrieren müssen abgebaut werden;
- unterstützt durch Bildungsmaßnahmen für beteiligte Erwachsene, um die Rechte des Kindes zu schützen;
- schützend und feinfühlig in Bezug auf das Risiko, das mit Meinungsäußerungen einhergehen kann;
- rechenschaftspflichtig mittels Rückmeldung, Monitoring und Evaluation;
So verstanden wird Partizipation zu einem kontinuierlichen, verbindlichen Prozess und bleibt kein einmaliges Ereignis.“2
Der kontinuierlich steigende Konkurrenz- und Prüfungsdruck im Bildungssystem, der legitimiert wird durch einen konstruierten Scheinwidersprach zwischen der Vermittlung kognitiver Inhalte und sozialer Kompetenzen, hat segregierende Wirkungen, fördert nicht die Fähigkeiten zur Inklusion und ist ein wesentliches Hindernis auf dem Wege zu einer inklusiven Schulkultur. Der Stellenwert sozialen Lernens und politischer Bildung tritt in den Hintergrund. Nur wenn die Erwachsenen, bei aller Eigeninitiative und allem Engagement der Kinder und Jugendlichen, die notwendigen finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen und gute Rahmenbedingungen schaffen, können SchülerInnen im Alltag vielfältige Handlungsstrategien und Kompetenzen praktisch einüben und in allen Lebensbereichen für die Achtung der Menschenrechte eintreten. Wird obendrein die Schulzeit immer weiter verkürzt, reicht die Unterrichtszeit gerade noch für die Pflichtfächer.
Je mehr Differenzen zwischen den Eigenschaften und Eigenarten der schulischen Akteursgruppen hinzukommen, wie Alter, Geschlecht oder Religion, umso größer ist das Konfliktpotential an einer Schule. In einem Schulkollegium sind nur Erwachsene, AkademikerInnen mit gutem Einkommen aus der Mehrheitsgesellschaft, in der Schülerschaft zum Teil Kinder und Jugendliche nichtdeutscher Erstsprache aus Familien mit Migrationshintergrund oder Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien. PädagogInnen wissen z. T. sehr wenig über den Alltag, die Probleme und die außerschulischen Einflüsse auf das Denken ihrer SchülerInnen. Ihre in vielerl...