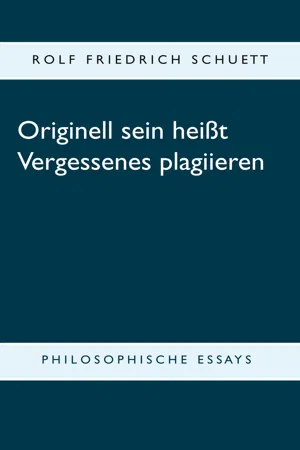![]()
Witz an der Sache : Weisheit nach dem Wissen
Der Witz an der Sache ist eine ganz besondere Art, zu verwirren oder sich verwirren zu lassen, und die verlorene Fassung dann auf angemessenener Ebene wiederzugewinnen. Verblüfft sein heißt, widerstrebend etwas zugeben zu müssen, was Gewohnheit und Sitte bisher anders sehen ließen. Wer widerwillig einräumen muß, was der Philosoph behauptet, obwohl es aller Tradition und Konvention widerstreitet, fühlt sich überrumpelt und durch die witzige Einkleidung dieses Hand- und Kopfstreichs gleichwohl bestochen. Der Philosoph will meine falschen Klarheiten verwirren, um begründetere Klarheit zu gewinnen. Er ist bedeutend, wenn er nur dadurch deutbar ist, daß er undeutlich macht, was eindeutig schien, indem er etwas mehrdeutig macht, damit es nicht zweideutig bleibt. Für den Bruchteil einer Sekunde wenigstens raubt er, wenn er etwas kann, dem Leser die Fassung, überrascht ihn mit einer Abweichung vom Geltenden, die sich so schnell nicht abweisen läßt, macht ihn schwankend, ob das Rätsel zu lösen sei, und der Coup gelingt, wenn die Irritation permanent und ein Pfahl im Fleisch des Lesers bleibt, der nur noch Gründe für die Unlösbarkeit des Rätsels suchen kann. Diese »Unstimmigkeiten« sind nicht nur subjektive, sondern auch objektive.
Jeder ist eine einzige Person und gleichzeitig Inbegriff vieler verschiedener potentieller Vorstellungen und Regungen, die alle in ihm Platz finden und die seinen sind und doch miteinander ganz unverträglich sein können. Eine Person zerfällt nicht in ihre Einzelakte, und diese fallen nicht in die Einheit der Person zusammen. Kein Bewußtsein zerfällt in einen Behälter einerseits und dessen verschiedene Bewußtseinsinhalte andererseits, sondern bleibt ein und dasselbe Bewußtsein, ohne aufzuhören, Bewußtsein so vieler vorbewußter Möglichkeiten zu sein, wie es Bewußtsein vieler potentieller Unterschiede ist, ohne deshalb aufzuhören, Bewußtsein ein und derselben Person zu sein.
Nach Franz Mautner besteht der Aphorismus aus »Einfall und Klärung«, also zweistufig aus intuitiver Eingebung und späterer intellektueller Verarbeitung. Freud sprach einige Jahrzehnte früher von vorbewußtem Material, das für einen Augenblick der Überarbeitung durch das Unbewußte überlassen werde, bevor das Resultat sich in eine Form bringe, die der Realitätsprüfung wie der Gewissenszensur genügt. Die pointierte Fassade solle dem unbewußten Tabubruch das Anstößige nehmen, ohne ihn rückgängig zu machen, und uns mit ihm versöhnen. Das sei keine hinter unserem Rücken ablaufende Kompromißbildung zwischen Es und Über-Ich wie im Traum, sondern eine elegante und soziale Befriedigung beider divergenten Ansprüche zugleich. Wenn diese »Witzlust« nicht gleich »abgelacht« wird, bleibt sie als Lust zum philosophischen Weiterdenken noch verfügbar. So etwas wie eine Psychoanalyse des philosophischen Aphorismus wäre dort anzusiedeln, wo Freud zwischen dem leichtverständlichen Witz und kopfzerbrechenden Rätsel unterscheidet. Der Aphorismus, der die vorbewußte Sprachpointe und unbewußte Sachpointe sinnig verknüpft, verschafft Lust und fordert dennoch zum Nachdenken heraus, weil er Denkarbeit verlangt und trotzdem Vergnügen macht an der Düpierung der Zensurinstanz, die über die Einhaltung der Denk- und Sittenschablonen, der Gefühlsstereotype und Vorurteile wacht. Der Aphorismus unterscheidet sich vom Witz durch den größeren Denkaufwand, den er dem Leser zumutet, und vom Rätsel durch die Auflösung, die er versteckt mitliefert und die sich dann doch regelmäßig als ganz ungenügend erweist. Hermann Schmitz hat die Struktur des Unbewußten als zahlunfähig »chaotische Mannigfaltigkeit«, die Struktur des Bewußtseins aber als »instabile« zwischen mehrdeutig chaotischer und numerisch eindeutiger Mannigfaltigkeit analysiert. Darauf läßt sich zurückgreifen, um das im „Metaphorismus“ geistreich werdende Verhältnis zwischen >unbewußt< und >vorbewußt< begrifflich strenger zu fassen. Wenn der Traum ein (für andere witzloser) Witz im Schlaf ist, dann der Witz ein weitererzählbarer Wachtraum. Er entbindet nicht nur den Sinn im Unsinn der frühkindlichen Wortlust, sondern auch Lust an infantilen erotischen wie aggressiven Affekten, die sich Luft verschaffen und doch das soziale Gewissen zufriedenstellen oder elegant austricksen.
Adorno verteidigt im schneidenden Aphorismus ein Kastrationsmesser und kein Beschneidungsmesser. Der Spruch wird zum Ein-Spruch gegen Hegels postödipale Ver-söhnung von Vater und Sohn, die die fruchtbare eheliche Vereinigung von männlichem Begriff und weiblichem Liebesobjekt ermöglicht. Adornos >schneidender< Aphorismus will die Väter kastrieren, um zu den Müttern heimzukehren.
Er kündigt die Kumpanei des Geistes mit dem vermeintlichen »Machtwillen« der Väter auf und bekämpft geistreich den patriarchalischen Zeitgeist, den es gar nicht gibt. Vielleicht ist es kein Zufall, daß er sich lieber nach seiner korsischen Mutter Adorno als nach seinem askenasischen Vater Wiesengrund benannte. Seine Affirmation der »bestimmten Negation« bewaffnet das Bündnis des Einzelkindes mit seiner Mutter (Natur) gegen das Prinzip Vater, aber bekämpft den vermeintlich väterlichen Machtwillen nicht durch Willenlosigkeit, sondern durch mächtigen spätpubertären Unwillen.
Den Machtwillen der Zwangssysteme bekämpft ein aphoristischer Unwille, der geistreiche Ohnmachthaber attackiert die Macht der Dummheit. Der Aphoristiker akzeptiert, was jeder an seiner Stelle ebenso gut sagen könnte, aber er leugnet, daß es wichtiger als das ist, was nur er sagen kann. Jeder ist dazu bestimmt, sich selbst zu bestimmen, und bestimmt sich dann meist nur dazu, über sich selbst bestimmen zu lassen. Die Gesellschaft bewegt mich zur Selbstverantwortung, und dann bin ich so frei, mich zum Produkt der Gesellschaft zu machen. Jeder Aphorismus registriert auf engstem Raum den plötzlichen Zusammenprall zwischen der Einbildungskraft und Urteilskraft, zwischen dem Geschöpf und seiner Selbstschöpfung, zwischen dem, was ich selber gebe, und dem, was sich daraus anderes ergibt, zwischen dem, was ich wohl will, und dem, was die Welt aus dem macht, was ich aus mir selber mache. Den Aphoristiker trennen vom Existenzialisten die objektiven Befunde und vom Positivisten die subjektiven Selbsterfindungen. Kants dritte kosmologische Antinomie über die »dynamische Causalität der Natur und aus Freiheit« wird bei Fichte zum sukzessiven Wechsel von Abhängigkeit und Unabhängigkeit des Ich, von Endlichkeit und approximativer Unendlichkeit, von aktiver Tathandlung und passiver Leidenschaft. Jedes frühromantische Fragment ist ein zündender Witz aus der auf jeder Ebene sich erneuernden Ambivalenz von Bestimmtheit und Selbstbestimmung, ein Potenzgrad der Reflexion. Durch die Art ihrer Aussage gibt die Ironie immer das Gegenteil zu verstehen, jeder Satz meint seinen Gegensatz mit und parodiert ihn zugleich. Fichtes endlose Reflexion zerbricht an ihrem ewigen Widerspruch von Ich und Nicht-Ich in unendlich viele Fragmente. Das Ich ist ein synthetisches Vorurteil a priori, das sich zu beweisen sucht und dabei nur reproduziert. Jeder Spruch ist eschatologischer Einspruch gegen den abschließenden Schiedsspruch des Jüngsten Gerichts.
Hegels »übergreifendes Allgemeines«, die Idee als dialektische Identität von Begriff und Realität, ist die Einheit von romantischer Ironie und naturwissenschaftlicher Empirie, also die (transzendentale) Subjektivität als Einheit von (empirischem) Subjekt und (empirischem) Objekt. Dadurch ist der aphoristische Teufel von der List der Vernunft in göttlichen Dienst genommen und die destruktive Ironie der Romantiker in der List der Vernunft gut aufgehoben, d. h. dekonstruiert, funktionalisiert und sublimiert zugleich.
In der »Phänomenologie des Geistes« werden die Frühromantiker moralisch schon so verdächtigt wie später im § 140 der Rechtsphilosophie, aber ihr »reines Gewissen der schönen Seele« bei aller vermeintlichen »Heuchelei« doch als epochale Schwelle zum »absoluten Wissen« gewürdigt. Der »verrückte« Novalis und der böse Tatmensch Napoleon verzeihen einander gut christlich, und die Romantik hebt sich auf in der griechischen Kunst, die dann ihrerseits über den gemeinen Menschen hinter den erhabenen Theaterrollen überleite zum Menschen Jesus hinter dem göttlichen Christus, also zu Religion und Philosophie. Daß die romantischen Gnomiker alles frech verlachen, was ihm und seiner Zeit heilig ist, erregt Hegels lebenslangen Zorn, und er sucht die geistreichen Spötter mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, doch dabei treibt er seine eigene moralische Heuchelei so weit, sie moralische Heuchler zu schimpfen. Fr. Schlegels ironisch selbstentfremdete Subjektivität soll ihre Einseitigkeit verlieren, indem sie mit der positivistisch entfremdeten Objektivität in einer dialektisch »übergreifenden« Subjektivität versöhnt wird, durch beide Extreme hindurch. Beide sind sie Idealisten, aber Hegels Subjekt weiß sein Objekt in sich, Schlegel aber ewig unerschöpflich außer sich als Ideal. Hegel reserviert für sich die Einheit der Vernunft und weist Schlegel die »bloßen Reflexionsbestimmungen« des Verstandes zu, die dieser stolz annimmt. Adorno und nach ihm Manfred Frank haben darauf hingewiesen, daß das romantische Fragment durch die reflexive »Unerschöpflichkeit des Gegenstandes« das »antiidealistische Motiv inmitten des Idealismus« vertrete und nicht die davon selbstironisch »entfremdete Subjektivität«, wie ein H. Schmitz behauptet. Gegen Schlegels vermeintlich egoistisch frivolen Narzißmus setzte Hegel erst die sinnliche Gattenliebe und später den sittlichen Rechtsstaat.
Um die philosophische Vernunft nicht in beliebige einzelne Witze zerfallen zu lassen, ist Hegels Systematik als Universalwitz von Witzen ein Prinzip, aphoristisch zündende Witze methodisch aufzuheben, d.h. weiterzuerzählen, ihren ernsten Kern aus der witzigen Verkleidung zu schälen und auf die witzlose Moral von der Geschichte abzuheben. Mit jeder Gnome wird etwas gesetzt und damit von anderen Gnomen abgesetzt. Jedes Fragment kann immer auch ganz anders wie Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und ist über seine eigenen Festlegungen auch immer wieder ganz leicht und flexibel hinaus. Die »Stellung des Menschen im Kosmos« (Max Scheler) ist ihm objektiv zugewiesen und zugleich subjektiv von ihm selber gewählt : Die unauflösliche Spannung dazwischen entlädt sich in immer neuen witzigen Einfällen. Der Aphorismus ist die paradoxe Einheit von produktiver Setzung und distanzierender Absetzung, bis hin zu Schlegels identifizierender »Selbstschöpfung«, die Hegel zum Außersichsein des Geistes macht, und Schlegels »Selbstvernichtung«, die Hegel zur Rückkehr der einseitigen Subjektivität in substantielle Allgemeinheit veredeln will. Schlegels »Selbstschöpfung und Selbstvernichtung« lebt wieder auf in Sartres Wesensbestimmung der Existenz, die sich durch Selbstüberschreitung selber erschafft und durch Selbsterfindung hinter sich läßt. »Ich bin nicht, was ich bin, und bin, was ich nicht bin« : Das wäre eine Definition des Witzes und ist doch ganz witzlos gemeint, obgleich Sartre den Geist der Seriosität haßt und den Menschen für das Wesen hält, das einen Menschen einfach nur spiele. Sartre ist so witzlos pedantisch wie die postmodernen Differenzialphilosophen, die heteronome, heterologische und heterogene Abweichungen von allem Homophilosophischen ganz homophilosophisch kultivieren.
Gnomische Sprüche sind »jemeinige« Meinungen, ohne allgemeingültige Ansprüche deshalb preiszugeben, und umgekehrt platonische Ideen, ohne deshalb die widersprüchlichen Doxai aufzugeben. Der Adressat darf und muß selbst entscheiden, wieweit er sich getroffen fühlen will und wie unverbindlich die unverbundenen Ur-teile über ihn sind. Zukunftsträchtig an dieser unmethodischen Denkmethode könnte die subjektive Artikulation objektiver und zugleich objektive Explikation subjektiver Sachverhalte sein. Subjektivität wird vom Hindernis zum Mittel der Objektivität und umgekehrt. Aphorismen, Fragmente und Essays sind subjektive Investitionen für objektive Amortisationen; sie sind nicht zu subjektiv, sondern gerade subjektiv genug, Subjektives recht objektiv zu erfassen. Ein >Mehr vom Gleichen< bringt oft nicht die Lösung, die das Weniger von einem >ganz Anderen< brächte, und die Gnome leistet potentiell den Quantensprung von Quantität in höhere Qualität.
Jürgen Habermas wehrt in der »Theorie des kommunikativen Handelns« seinen dissidenten Lehrer Adorno als »überprägnant« ab, dabei zerredet sein eigener linksliberaler >Konsens< sich stets nur allzu unterprägnant. Mein »lebensweltlicher Fundamentalismus« vollzieht sich klassenanalytisch, psychoanalytisch und spra(u)chanalytisch im Licht eines leitenden Monotheismus als proletarische Arbeitslebenswelt, unbewußte Liebeslebenswelt und aphoristische Geisteslebenswelt. Aphorismen und Essays verteidigen nicht immer nur die alltägliche Lebensweltanschauung gegen abstrahierte Wissen(schaft)ssysteme, sondern verwahren sich, wo es nur nötig scheint, gegen dominante Alltagsklischees nicht anders als gegen die „abgekapselten Expertenkulturen“. Schließlich gibt es nicht nur lebensweltfremde Fachidioten, sondern auch genug bornierte Laien, manipulierte Normalverbraucher und Halbbildungsphilister. Essays spielen sie nicht gegeneinander aus, sondern ihnen ihre Melodien vor, und sind Alternativen der Wahl zu diesen falschen Alternativen. Der Umgangssprache geben sie die Ehre, indem sie die wissenschaftlichen Kunstsprachen gegen sich selbst wenden. Erst verteidigen Fragmente demokratische Mehrheiten gegen Experten-Oligarchien und dann selbstdenkende Individuen gegen die demokratischen >Massen<, während der Konsensualist Habermas gegen Systemtheoretiker seine Lebensweltmeister aufbietet. Statt interessenleitender Erkenntnisse forciert Habermas >erkenntnisleitende Emanzipationsinteressen<, die die Erkenntnis dazu verleiten, Objektivität als Intersubjektivität von Interessengruppen mißzuverstehen. Seine psychoanalytische »Tiefenhermeneutik« wäre viel brauchbarer gewesen, wenn sie auf Freuds Triebtheorie und nicht auf Alfred Lorenzers Sprachtheorie basiert hätte. Richard Hönigswald, der letzte Neukantianer vor dem zweiten Weltkrieg, hat die normative Geltung der Begriffe ergänzt durch eine Genetik des faktischen Be-greifens, aber auch sein Erbe Hans Wagner hat diese >monadologische Denkpsychologie<, als anthropologisches Korrelat der transzendentalen Subjektivität, nicht in Freuds Psychoanalyse des Erkenntnisvermögens erkennen können.
»Lebenswelt« ist erst einmal das, was der bürgerliche Phänomenologe so denkt und treibt, wenn er seinen Brotberuf gerade einmal nicht ausübt, oder was er von den Freizeitbeschäftigungen anderer Bürger vom Hörensagen so weiß. Auch er lebt nicht primär im Weltall, sondern in abgekapselten Umwelten des Gelehrtenlebens. Phänomenologen sind inzwischen auch nur noch Experten für Nichtexpertenfragen und ergänzen den Dilettantismus der Spezialisten. Sie normieren den Otto Normalverbraucher und sehen nicht die manipulierte Befangenheit gerade ihrer »unbefangenen Lebenserfahrung«. Das »Erstgegebene und Letztbegründende« (Waldenfels) der heutigen Phänomenologie ist weder die Gottesidee noch die proletarische Hundelebenswelt und das physikalische Weltall, sondern der bürgerliche Alltag der Klassengesellschaft. Der heute fundierende »Weltglaube« ist ideologisch durch und durch und kein Boden für ein Wahrheitskriterium. Die unmittelbare Lebenserfahrung des phänomenologischen Lebensweltbürgertums ist gesellschaftlich vermittelter, als sie wahrhaben will. »In den Netzen der Lebenswelt«, die heute alternative Netzwerke heißen, hängen die kleinen Fische, und bürgerliche Phänomenologie-Beamte reflektieren nur noch auf ihre eigenen Alltagssorgen.
Bei Hippokrates wird die Medizin zum Aphorismus, bei Kant der Witz zur Medizin. Lachen trage zum körperlichen Wohlbefinden bei und findet auch Platz in Wittgensteins Idee eines »therapeutischen Philosophierens«. Sind Aphorismen nach dem pragmatistischen Kriterium von William James „sinnvolle Sätze“, bei denen es »für das konkrete Leben nützlich ist, sie zu glauben«, und einen Unterschied macht, ob sie wahr sind oder nicht? Hans Blumenberg sagt in seinen »Höhlenausgängen« : »Die Weisheit von Sprüchen entwöhnt schnell vom Umgang mit Kontexten« − der Konsenskonformisten.
Jede witzig paradoxe »Vereinigung des Unvereinbaren« als Kehrseite von Adornos Selbstverschiedenheit des Identifizierten hebt Hegels schlußdialektische »Identität von Identität und Nichtidentität« wieder auf. Das Ich kommt bei Novalis nicht ins Schweben, sondern ist nichts als dieses Schweben zwischen Selbstbindung und Selbstauflösung. Fichtes Ich-Substanz brauchte noch einen äußeren Anstoß, den sie dann nie wieder ganz in sich aufheben konnte; die Einbildungskraft des Novalis dagegen hat das Prinzip des Selbstgegensatzes in sich und ist aphoristisch witzige Identität von Homogenität und Heterogenität zwischen Individuen und ihren Begriffen.
Kurzum : Das multivalente Ich des Frühromantikers zwischen zählbar eindeutigen und chaotisch verschwommenen Bestimmungen ist der geborene Aphoristiker. Bei ihm erhält die von objektiven Tatsachen »entfremdete Subjektivität« (H. Schmitz) der unendlichen Reflexion gleich eine aphoristische Binnenstruktur. Und Hegel holte nicht Schellings Objektivismus, sondern Friedrich Schlegels Subjektivismus dialektisch zurück in seinen eigenen objektiven Geist.
»Progressive Universalpoesie« als Universalphilosophie war der unendliche Progressus von Fichtes transzendentalem Zirkel, die Schraube endloser Reflexionen der investierenden und dann distanzierenden Einbildungskraft. Jede Schraubendrehung der potenzierten Reflexion war ein eigenes Fragment. Die bei Novalis ambivalent »geraffte Ironie« (H. Schmitz) ist eben aphoristisch gerafft zu einer schwebenden Irritation in Permanenz, einer objektiven Unstimmigkeit, die sich nicht auflösen läßt wie bei einem Witz oder einer optischen Täuschung. (Husserl nannte die Schaufensterpuppe, die für einen Moment wie ein Mensch aussieht.) »Witzverhalte könnten auch Tatsachen sein, und die Welt könnte von unauflöslichen Unstimmigkeiten nach Art der Husserl'schen Puppe durchzogen werden ... Wenn das Flackern des Charakterwechsels ... zur simultanen, nicht weichenden gegenseitigen Überschiebung zusammenrückte, müßte die Husserlsche Puppe auch als Ding an sich, als nicht auflösbarer Weltbestand ernst genommen werden ...« (Schmitz: Neue Grundlagen der Erkenntnistheorie, Bonn 1994, S. 142 ff.) Diese Dinge an sich mit instabilen Wesenszügen sind bevorzugte Objekte des Aphorismus, der paradox klingt, weil er Objekte beschreibt, die von sich selbst verschieden sind, ohne sich zu vernichten oder in mehrere Objekte zu zerfallen.
Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Bloch, Adorno, Habermas, Foucault, Derrida ... haben wenigstens eins gemeinsam, außer daß sie die international renommiertesten Philosophen der Neuzeit darstellen : Es sind Denker, für die Gott so tot ist, daß sie ihn längst nicht mehr vermissen oder bekämpfen. So revolutionär sie sich auch sonst gerieren, darin sind sie unkritische Nachbeter des Zeitgeistes, der nun schon zwei Jahrhunderte lang unangefochten herrscht. Der »Herr der Geschichte« läßt sie machen und überlebt den »Gott der Philosophen« ganz mühelos. Er macht sich rar nicht in der Wirklichkeit, aber im geistigen Überbau, und seine lange Abwesenheit nährt die Gegenkräfte, die ihn zurückerwarten.
Gott ist Naturgesetzgeber und milder Anwalt von Naturgesetzbrechern nur nebenbei. Christen brechen Gottes Gesetz und plädieren für mildernde Umstände und auf Unzurechnungsfähigkeit, aber kein Christ sollte die Absurdität »glauben«, daß Gott ihm zuliebe dauernd seine Spielregeln suspendiert. Für Gott ist das Absolute der Begriff, der das All umfaßt und deshalb in allen Details aus sich entlassen kann. Nichts anderes sprengt diesen Begriff von allem als das »Nichtige«, das Hegel »faule Existenz« nannte, und das »absolut Böse« der »wahnsinnig gewordenen Subjektivität«, die er in den Frühromantikern sah. Die göttliche Idee, wie Hegel sie kannte, läßt auch unzählige Aphorismen frei, die sie allerdings nicht wieder in sich selbst zurücknehmen kann. Das Absolute sei immer schon bei uns Menschen, aber nicht beim Aphoristiker vom Schlage eines Novalis oder Schlegel. Aphorismen sind Individuen, die gleichsam keinen übergeordneten Allgemeinbegriff kennen und dulden, sondern ihren systematischen göttlichen Inbegriff permanent sprengend erfüllen. Frege und Husserl verbannten die Psychologie aus der Philosophie, aber die Psychoanalyse war da noch nicht mitgemeint, und Freud psychoanalysiert die Motive dieser philosophischen Psychologismuskritik. Hegel ließ die philosophische Eule der Minerva erst in der Dämmerung ihren Flug beginnen, sobald ein...