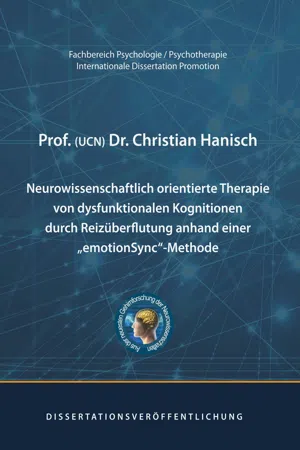![]()
1. Einleitung
1.1 Überblick
In diesem Kapitel werden zunächst (Abschnitt 1.2) die zentralen Begriffe dieser Arbeit, wie sie im Titel erwähnt werden, definiert und kurz erläutert. Ausgehend von dieser Basis wird der Handlungsbedarf, der zu dieser Arbeit geführt hat, abgeleitet und beschrieben. Anschließend werden die Ziele dieser Arbeit dargestellt (Abschnitt 1.3) und der Aufbau der Arbeit skizziert (Abschnitt 1.4).
1.2 Problemstellung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und empirischen Prüfung eines (psycho-)therapeutischen Ansatzes. Für Psychotherapie gibt es viele verschiedene Definitionen, da es eine große Vielfalt an Psychotherapiemethoden gibt (einen guten Überblick bietet Pritz, 2008), was eine exakte Definition von Psychotherapie erschwert (Van Deurzen-Smith & Smith, 1996). Die vermutlich älteste Definition stammt von Anna O., einer der „klassischen“ Klientinnen der frühen Psychoanalyse, die ihre von Breuer geleitete Therapie als „talking cure“ bezeichnete (Breuer und Freud, 1895). Corsini und Wedding (2000) vertraten die pessimistische Ansicht, dass Psychotherapie nicht mit Präzision definiert werden kann (interessanterweise fehlt dies in der neueren Version Corsini und Wedding (2011)). In ähnlicher Weise befand Raimy (1950) Psychotherapie als eine undefinierte Methode, die mit unvorhersagbaren Ergebnissen auf unspezifische Probleme angewandt wird. Es dürfte Einigkeit darüber herrschen, dass die Psychotherapie sich darüber hinaus entwickelt hat.
Hier sollen einige Kennzeichen von Psychotherapie aufgelistet werden, was nicht heißt, dass sie immer auf alle Therapieformen zutreffen (vgl. Corsini und Wedding, 2000). In Anlehnung an Strotzka (1978), Baumann, Hecht und Mackinger (1984), Wittchen, Hoyer, Fehm, Jacobi und Junge-Hoffmeister (2011), Hautzinger und Pauli (2009) und Kanfer und Schmelzer (2005) werden die folgenden Charakteristika für seriöse Psychotherapie vorgeschlagen:
- Ein zielgerichteter Veränderungsprozess, der
- bewusst geplant und systematisch ist
- mit psychologischen Mitteln durchgeführt wird
- an psychischen bzw. belastenden Problemen ansetzt
- aktuelle, wissenschaftlich begründete Erkenntnisse in Theorie und Praxis zugrunde legt
- Methoden verwendet, deren prinzipielle Wirksamkeit für den relevanten Zweck belegt sind
- auf eine Leidensreduktion bzw. Reduktion der Symptomatik zielt
- in seinen Zielen je nach der jeweiligen Problemkonstellation variabel ist
Wichtig ist auch, dass es sich um eine Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen handelt und der therapeutischen Beziehung eine große Bedeutung zugemessen wird.
Psychotherapie wird im täglichen Sprachgebrauch häufig mit Psychologie gleichgesetzt (Van Deurzen-Smith & Smith, 1996). Unter Psychologie wird die wissenschaftliche Beschäftigung mit Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Verhalten verstanden und sie wird definiert als
„die Wissenschaft vom Verhalten (alles, was ein Organismus macht) und von den mentalen Prozessen (subjektive Erfahrungen, die wir aus dem Verhalten erschließen). Das Schlüsselwort dieser Definition ist Wissenschaft.“ (Myers, 2008, S. 8).
Der Schwerpunkt von Psychologie liegt heute auf empirischer Forschung, die sehr stark theoriegeleitet ist (vgl. Myers, 2008; Gerrig und Zimbardo, 2008). Psychologen betreiben zunächst Grundlagenforschung (vgl. Myers, 2008). In der klassischen Psychologie sind Grundlagenforschung und angewandte Psychologie getrennt (vgl. Myers, 2008).
Zu den Feldern der angewandten Psychologie gehört die Klinische Psychologie, die innerhalb der Psychologie mit der Psychotherapie am engsten verknüpft ist, da sie sich mit dem Forschungsgegenstand psychischer Störungen und psychischen Aspekten somatischer Störungen befasst (Wittchen und Hoyer, 2011a, 2011b, 2011c; Baumann und Perrez, 1998).
Dazu gehören Erforschung, Diagnostik, Ätiologie, Bedingungsanalyse, Klassifikation, Epidemiologie und Therapie/Intervention (Wittchen und Hoyer, 2011a; Baumann und Perrez, 1998). Charakteristisch ist, dass sie enge Beziehungen zu anderen Wissenschaftsdisziplinen aufweist. Genannt werden Psychiatrie, Soziologie, neurobiologische Fächer (inklusive Genetik und Pharmakologie), Neurologie und Medizin (Wittchen und Hoyer, 2011a), aber auch genauer Verhaltensmedizin, Medizinische Psychologie, Klinische Neuropsychologie, Tiefenpsychologie, Sozialpädagogik, Gesundheitspsychologie und Public Health (Baumann und Perrez, 1998; Schraml, 1970).
Wie stellt sich die Klinische Psychologie zur Psychotherapie? Nach Wittchen und Hoyer (2011a) stellt Psychotherapie nur einen Teil des Interventionskatalogs der Klinischen Psychologie dar. Baumann und Perrez (1998) sehen aus der klassischen Sicht Psychotherapie als Teilgebiet der Klinischen Psychologie bzw. sie fordern zwischen Psychologie und Psychotherapie ein besonders enges Verhältnis, da eine Trennung der beiden Disziplinen eine Weiterentwicklung der Psychotherapie und der Qualitätssicherung schaden würde (Baumann, 1995). Diese Sicht wird allerdings heftig diskutiert (Pritz, 1996), was im Folgenden dargestellt wird.
Psychologen verweisen darauf, dass psychologische Mittel ein Charakteristikum von Psychotherapie seien und dass durch psychologische Mittel verursachte Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur Gegenstand der Psychologie seien (Grawe, Donati und Bernauer, 1994; Strotzka, 1978). Ferner seien viele bedeutsame Therapieansätze von Psychologen entwickelt worden (für eine Gegenposition siehe im Folgenden) und ein Großteil der Psychotherapieforschung wurde und werde von Psychologen betrieben (Grawe et al., 1994; Datler und Felt, 1996).
Demgegenüber verweisen Mediziner darauf, dass Psychotherapie zu den Heilberufen zählt und alle Heilbehandlungen ihrem Aufgabengebiet zufallen (Datler und Felt, 1996; für kritische Darstellungen siehe Wagner, 1996; Sonneck, 1996). Auch Mediziner können darauf verweisen, dass entscheidende Methoden von Ärzten entwickelt worden sind (z. B. die Psychoanalyse). Zudem ist eine nicht unerhebliche Anzahl von Medizinern als Psychotherapeuten tätig (Datler und Felt, 1996). Mit der Psychiatrie gibt es innerhalb der Medizin ein inhaltlich verwandtes Gebiet analog zu der mit der Psychotherapie verwandten Klinischen Psychologie in der Psychologie (vgl. oben und siehe Filz, 1996). Genau wie klinische Psychologen, die Psychotherapie als Teilgebiet ihres Fachs betrachten, sehen Psychiater die Psychotherapie als Teilgebiet ihrer Disziplin an (Möller, Laux & Deister, 2009).
Nicht zuletzt melden auch die Pädagogen einen Anspruch an der Psychotherapie an. Förderung von Persönlichkeitsentwicklung sei ein pädagogischer Gegenstandsbereich, Heilpädagogik eine explizite Teildisziplin der Pädagogik und viele Pioniere der Psychotherapie – z. B. Anna Freud, August Aichhorn oder Oskar Spiel – seien aus der Pädagogik gekommen (Datler und Felt, 1996).
Die Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Psychotherapeutische Methoden werden von Vertretern der jeweiligen Fachrichtungen angewendet.
- Die Fachrichtung hat zur Entwicklung der Psychotherapie beigetragen.
- Innerhalb der Fachrichtung gibt es ein Spezialgebiet, das Überschneidungen mit der Psychotherapie aufweist.
Eine Alternative wird insbesondere in Österreich verfolgt. Sie zielt auf die Anerkennung der Psychotherapie als eigenständige Wissenschaft, was detailliert diskutiert wird (Pritz und Teufelhart, 1996; van Deurzen-Smith und Smith, 1996; Datler und Felt, 1996; Buchmann, Schlegel und Vetter, 1996). Problematisch ist hierbei, dass zunächst Konsens herrschen muss, was „eigenständige Wissenschaft“ bedeutet und wie sich die Psychotherapie innerhalb des Kanons aus geistes- bis naturwissenschaftlichen Wissenschaften positionieren sollte (Steinlechner, 1996; Hutterer, 1996; Reiter und Steiner, 1996; Schiepek, 1996). Erschwert wird dies durch unterschiedliche Forschungsstrategien und -interessen zwischen eher theoretisch orientierten, quantitativ arbeitenden Forschern und eher qualitativ orientierten Praktikern (z. B. Jandl-Jager, Presslich-Titscher, Springer-Kremser und Maritsch, 1997). Entlang einer ähnlichen Linie diskutiert Dumont (2011), ob es sich bei Psychotherapie um eine „science” oder eine „art” handelt. Dies stellt das Spannungsfeld dar, in dem sich die Psychotherapie bewegt. In dieser Arbeit wird die Psychotherapie aus pragmatischen Gründen unter engem Einbezug der Nachbardisziplinen als eigenständige Disziplin betrachtet, ohne dabei der Frage nachzugehen, ob dies den Rang einer eigenständigen Wissenschaft bedeutet. Die Interdisziplinarität, die der Psychotherapie zu eigen ist und die in dieser Debatte zum Ausdruck kommt, sowie die Frage nach der geeigneten wissenschaftlichen Herangehensweise werden berücksichtigt. Psychotherapie ist durch eine Methodenvielfalt gekennzeichnet. Aussagen über die Wirksamkeit können nicht generell getroffen werden, sondern sind immer spezifisch für eine Problemstellung und eine Therapiemethode (siehe oben und Myers, 2008).
Für diese Arbeit ist die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) von Bedeutung, die maßgeblich von Beck (z. B. Beck et al., 2010) und Ellis („rational-emotive Therapie“ (z. B. Ellis, 1978; später umbenannt in „rational-emotive Verhaltenstherapie“ (Ellis, 1993)), begründet wurde. Die KVT kombiniert zwei Therapieformen:
- Die Verhaltenstherapie (VT), die unerwünschtes Verhalten löscht und modifiziert
(Myers, 2008, S. 802; eine ausführliche Definition in Margraf und Schneider, 2009)
und
- die kognitiven Therapien, die den „Klienten neue, besser an die Realität angepasste Denk- und Handlungsweisen“ lehren (Myers, 2008, S. 807; eine ausführliche Definition in Beck, 2011).
Allerdings sind „Kognitive Therapie“ und „KVT“ heute de facto identisch in der Bedeutung (Beck und Dozois, 2011), da praktisch immer verhaltenstherapeutische Elemente einfließen (vgl. Schöttke, 2010). Im Folgenden wird nur der Begriff KVT verwendet und in Anlehnung an die bereits genannten Grundgedanken definiert als eine
„weit verbreitete integrative Therapie, bei der die Techniken der kognitiven Therapie (Veränderung der selbstabwertenden Gedankenmuster) mit den Techniken der Verhaltenstherapie (Verhaltensänderung) kombiniert werden“ (Myers, 2008, S. 809).
Auf diese Therapieformen und ihre Stellung innerhalb der Gesamtheit der Methoden der Psychotherapie wird in Kapitel 2 näher eingegangen.
Eine zentrale Annahme der KVT ist die zentrale Stellung des Gedanken, dass zwischen „Ereignissen und emotionalen Reaktionen Gedanken vermittelnd Einfluss nehmen“ (Myers, 2008, S. 807). Sind diese Gedanken (Kognitionen) dysfunktional, triggern sie aus der Perspektive der KVT psychische Störungen und halten sie aufrecht. Solche Kognitionen werden als „dysfunktionale Wahrnehmungs-, Denk- und Einstellungsmuster („kognitive Schemata“, „kognitive Fehler“, „Glaubenssysteme“)“ (Mühlig und Poldrack, 2011) oder auch „Grundüberzeugungen“ (Schöttke, 2010) bezeichnet. Was bedeutet dysfunktional? Schöttke (2010) kritisiert, dass eine fehlende Verständigung über die Kriterien der Dysfunktionalität die Forschung erschwert (Schöttke, 2010). Für diese Arbeit wird die Definition von Ellis aufgenommen, wonach Dysfunktionalität das Wohlbefinden des Individuums beeinträchtigt und genau gesagt das Folgende darstellt (zitiert nach Schöttke, 2010):
„jeder Gedanke, jedes Gefühl oder jedes Verhalten, das zu selbstvernichtenden oder selbstzerstörenden Konsequenzen führt und das Überleben oder das Glück des Einzelnen erheblich beeinträchtigt“ (Schöttke, 2010, S. 345).
Dazu gehört (nach Schöttke, 2010):
- Es wird von den betreffenden Personen angenommen, dass die Dysfunktionalität realistisch ist, obwohl das in mindestens einer entscheidenden Weise nicht der Fall ist.
- Die betreffenden Personen machen sich selbst schlecht und können ihre Person nicht anerkennen,
- dies führt zu Problemen mit ihrer sozialen Umgebung,
- dies blockiert ernsthaft zufriedenstellende soziale Beziehungen und Interaktionen,
- behindert Freude und Erfolg bei produktiver Arbeit,
- stört die eigenen wichtigen Interessen in bedeutender Hinsicht.
Im individuellen Fall kann eine beliebige Anzahl dieser Kriterien zutreffen. Fokussiert lässt sich nach Walen, DiGiuseppe und Wessler (1982) sagen, dass dysfunktionale Bewertungen unwahr und absolut sind und nicht hilfreich zur Erreichung von individuellen Zielen. Klinisch bewirkt dies (nach Schöttke, 2010):
- Katastrophendenken (immer nur das Schlimmste annehmen)
- Globale Bewertungen von sich selbst
- Globale Bewertungen von anderen
- Negative Zukunftsperspektiven
Welche dysfunktionalen Muster (kognitiven Fehler) können entstehen? Charakteristisch sind (nach Beck, 1967; Ellis und Dryden, 1997; Mehl, 1991; Mühlig und Poldrack, 2011, Pössel und Hautzinger, 2009, und Wilken, 2010):
- „Übergeneralisierung“ (aus einer Situation wird auf alle ähnlichen Situationen geschlossen). Als „Etikettierung“ wird ein ähnlicher Prozess bezeichnet, wenn z. B. aus einer Situation oder Handlung eine generalisierte Einschätzung entsteht (z. B. man betrachtet sich als absoluter Versager, weil man einmal etwas nicht geschafft hat)
- „Annehmen einer zeitlichen Kausalität, Vorhersage ohne zeitliche Evidenz“ (etwas ist einmal zut...