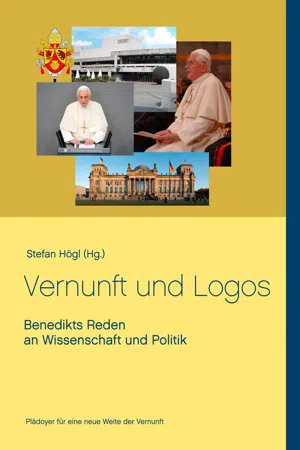![]()
III. Anmerkungen zur Regensburger Rede
Obwohl sich die Regensburger Rede zunächst an ein akademisches Publikum mit philosophischem und theologischem Hintergrund gewendet hat, sind viele ihrer Fragestellungen auch für Zuhörer anderer Fakultäten sowie für interessierte Zeitgenossen von Bedeutung.
I. Begrüßung und Rückblick:
Vernunft im universitären Diskurs: Die Aufgabe der Theologie
In den einleitenden Worten wird zuallererst die Verbundenheit des Pontifex mit der Universität deutlich. Hier zeigt sich, dass schon der junge Josef Ratzinger neben seiner geistlichen Berufung immer den wissenschaftlichen Diskurs gesucht hat. Es war ihm offenbar nicht genug, den Glauben nur als ein Geschenk anzunehmen und dieses mit großer Dankbarkeit vor sich her zu tragen. Vielmehr hat er mit den Fragen seiner Religion, auch seiner Kirche stets gerungen, auf der Suche nach Antworten und Wegen, die in einem weiten Sinne als „vernünftig“ erscheinen konnten. Biographen werden seinen Einfluss auf das II. Vatikanische Konzil nennen oder seine Rolle als Präfekt der Glaubenskongregation in Rom. Augenscheinlich ist jedenfalls seine Verwurzelung im Diskurs der Universität.
Benedikt erinnert dann an die früher selbstverständliche Zugehörigkeit der Theologie zur Universität, weil so im Rahmen der christlichen Tradition Fragen thematisiert wurden, die über den Horizont der einzelnen Fachbereiche hinausgingen – etwa die nach Gott. Es ist spürbar, dass hier ein besonderes Anliegen des Heiligen Vaters liegt, auf das er später noch zurückkommen wird.
II. Glaube versus Vernunft: Gewalt widerspricht dem Wesen Gottes
Im zweiten Abschnitt geht es um das Verhältnis von Religion und Gewalt, genauer: um Gewalt als Mittel zur Durchsetzung oder Verbreitung religiöser Ideen. In diesem Zusammenhang taucht auch das Papstzitat von Regensburg auf, in welchem Benedikt die Worte des byzantinischen Kaisers Manuel II. referiert, ohne sie sich dabei zu eigen zu machen, wie noch kurz aufgezeigt werden wird.
Die Unterhaltung des byzantinischen Kaisers mit seinem persischen Gesprächspartner bildet jedoch nur einen historischen Rahmen. Genauso gut hätte ein aktuelles Beispiel der Gewalt aus dem Nahen Osten bemüht werden können. Wenn allerdings seit der seinerzeitigen Unterredung über sechshundert Jahre vergangen sind und heute innerhalb des Islams wie auch zwischen islamischen Strömungen und dem Westen gewaltsame Konflikte herrschen, dann liegt es nahe, dem Islam als Religion die Frage nach der Legitimität von Gewalt zu stellen und für dieses grundsätzliche Thema weit hinter die aktuellen Ereignisse zu treten.
Benedikt geht es allerdings im engeren Sinne nicht um eine konkrete Religion und deren Verhältnis zur Gewalt, sondern um die Abgrenzung des christlichen Glaubens von eben dieser, wie es Manuel beispielhaft formuliert hat: „Gott hat kein Gefallen am Blut”, „und nicht vernunftgemäß, nicht „σὺν λόγω” zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Der Glaube ist Frucht der Seele, nicht des Körpers. Wer also jemanden zum Glauben führen will, braucht die Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken, nicht aber Gewalt und Drohung… Um eine vernünftige Seele zu überzeugen, braucht man nicht seinen Arm, nicht Schlagwerkzeuge noch sonst eines der Mittel, durch die man jemanden mit dem Tod bedrohen kann..." (II,12b-15a).
Manuels Ausführungen, denen Benedikt sich anschließt, erscheinen aufgeklärten Zeitgenossen als geradezu selbstverständlich, bedeutet doch „Überzeugung“ durch gewaltsame Mittel keine innere Überzeugung, sondern eine Einschüchterung.
So verbindet sich die Art der Verbreitung und Vermittlung des Glaubens mit dem darin sich entfaltenden Gottes- und Menschenbild. Gerade hier hat der biblische Glaube die Vorstellung eines Gottes entwickelt, der dem Menschen nicht völlig wesensfremd („absolut transzendent“; II, 20b) gegenübersteht, sondern sich mit Hilfe der Vernunft erkennen lässt. Für Theologen ist diese Diskussion nichts Neues, für fachliche Laien – für religionskritische zumal – geht es freilich um eine Grundfrage, die nicht einfach abgehakt werden kann: Wie soll man sich vorstellen, eine Erkenntnis über Gott zu gewinnen? Die Regensburger Rede kann diesbezüglich nur Andeutungen machen, weil sonst der zeitliche Rahmen gesprengt würde.
Festzuhalten bleibt aber die hier schon angedeutete, geradezu revolutionäre Sicht auf die Frage der richtigen Glaubensvermittlung:
Der göttliche Logos kann dem Menschen nicht von außen aufgezwungen werden, er muss sich in ihm selbst entfalten. Andere können diesen Prozess von außen fördern, wenn sie „die Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken“ (II, 14) haben. Doch es ist der Mensch selbst, der den Logos für sich entfaltet.
Gerade, weil Benedikt später an Sokrates erinnert (vgl. VIII,18-21), scheint der Vergleich mit der sokratischen Methode des philosophischen Diskurses, bekannt als Mäeutik („Hebammenkunst“), berechtigt: Der Schüler bekommt dabei sein Wissen nicht vom Lehrer vermittelt, sondern gelangt in eingehenden Gesprächen von selbst zur Erkenntnis der Wahrheit. Der Philosoph überträgt also nicht einfach sein eigenes Wissen, sondern steht dem Wahrheitssuchenden wie ein Geburtshelfer zur Seite.
Die Regensburger Rede hätte kaum den Weg in die internationale Berichterstattung gefunden, wenn sie nicht in den Verdacht geraten wäre, sich abfällig über den Islam geäußert zu haben. Dabei ist allerdings übersehen worden, dass das fragliche Zitat:
„Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du – so sagt er – nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, daß er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten“ (II, 9b)
vom byzantinischen Kaiser Manuel II. stammt und von Benedikt ausdrücklich nicht übernommen wurde. Tatsächlich finden sich mehrere Schichten der Distanzierung, die in ihrer Gesamtheit überaus deutlich sind:
Zweimal betont Benedikt, dass er an dieser Stelle ein Zitat wiedergibt (vgl. II, 9a und 9c). Ebenfalls zweimal kennzeichnet er das vorgetragene Zitat als unausgewogen drastisch: Zuerst bezeichnet er es als „erstaunlich schroffe[], uns überraschend schroffe[] Form“, letzteres in der offiziellen Nachbearbeitung des Manuskripts noch deutlicher als „für uns unannehmbar schroffe[] Form“. Gleich im Anschluss merkt er noch an, dass der Kaiser doch „so zugeschlagen“ (II, 10) habe. Abgesehen davon hat der Papst bereits im Vorfeld davon gesprochen, dass ihm der Gesprächsausschnitt „nur als Ausgangspunkt für [s]eine Überlegungen“ (II, 4) diene, weil es sich um einen „eher marginalen“ (II, 4) Aspekt handle. Die Bedeutung des kritisierten Zitats ist so bereits im Vorfeld relativiert worden.
III. Glaube begegnet Vernunft: Die biblische Tradition
Im dritten Abschnitt macht Benedikt deutlich, dass die Verankerung des Wesens Gottes – soweit mit der menschlichen Vernunft erkennbar – in einem ungleich größeren Vernunft-Logos nicht bloß eine besondere Variante von Religiosität ist, die mehr oder weniger zufällig mit dem Christentum aufgetreten ist. Die abstrakte Rede vom Logos als göttlichem Welt- und Handlungsprinzip setzt eine Abgrenzung von anthropomorphen, d.h. dem Menschen nachempfundenen Gottesvorstellungen voraus, wie sie in vielen religiösen Traditionen vorkommen.
Auf diesem Weg zu einem abstrakten und am Ende universellen Gott sieht Benedikt bereits die Tradition des Alten Testaments, wo er auf die Dornbuscherzählung verweist, in der sich Gott Mose mit den Worten vorstellt: „Ich bin“ (oder: „Ich bin, der ich bin“ – Exodus 3,14). Statt eines sonst üblichen Götternamens steht die reine Existenz im Zentrum der Selbstoffenbarung und damit „eine Art von Aufklärung“ (III,17), wie sie auch im griec...