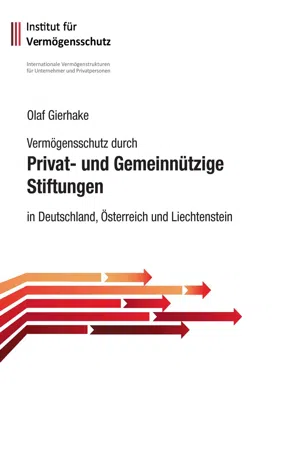![]()
1 Einleitung
1.1 Ausgangssituation des Unternehmers und vermögender Privatpersonen
Unternehmer1 und vermögende Privatpersonen in Deutschland stehen heute vor der Aufgabe, ihr vorhandenes Familienvermögen bestmöglich generationsübergreifend zu erhalten und vor verschiedenartigen Risiken zu schützen. Die Beantwortung der Frage, wie dies gelingen kann, hat nicht nur aus der Perspektive der betroffenen Persönlichkeiten und deren Familienmitgliedern, sondern auch gesamtgesellschaftlich eine hohe Bedeutung2, da mit dem Erfolg und dem Misserfolg3 der Gestaltung einer mittelständischen Unternehmensnachfolge auch unmittelbar volkswirtschaftliche Wohlfahrtsfolgen in Deutschland, z. B. im Bereich von Arbeitsplätzen oder im Bereich des Steueraufkommens, verbunden sind.
Bei einem typischen deutsche Familienunternehmen4 sind Familienmitglieder, häufig noch ein das Unternehmen prägender Firmengründer, substantiell, meist sogar mehrheitlich an einem oder mehreren mittelständischen Unternehmen im In- und Ausland beteiligt und in der Geschäftsführung vertreten. Neben den Unternehmensbeteilungen sind zumeist noch substanzielle Vermögenswerte in Form von Immobilien und liquidem Bankvermögen vorhanden. Die naheliegende Form der Vermögensnachfolge des Unternehmers ist die Suche und der Aufbau eines geeigneten Unternehmer- und Vermögensnachfolgers innerhalb der Familie. Es sind aber heute nur noch in einer Minderzahl der Fälle geeignete familieninterne Unternehmernachfolger vorhanden,5 welche aus Sicht des Unternehmers die erforderlichen Persönlichkeitsmerkmale, Interessen und Bildungsvoraussetzungen erfüllen, die für eine erfolgreiche familieninterne Unternehmensnachfolgelösung erforderlich wären.6 In einigen Fällen besteht auch ein Unwillen oder eine Unfähigkeit seitens des Unternehmers, aus den Familienmitgliedern einen Nachfolger auszuwählen.7
Aus diesen Gründen gewinnen seit Jahren familienexterne Vermögensnachfolgeszenarien für Unternehmer und vermögende Privatpersonen an Bedeutung.8 Bei diesen Szenarien geht das Eigentum am Unternehmen oder an den unternehmerischen Beteiligungen nicht auf die Abkömmlinge des Unternehmers über, sondern wird von Dritten weitergeführt.
In diesem Buch steht das familienexterne Nachfolgemodell einer in- oder ausländischen Stiftung, also eines verselbständigten, privatrechtlich organisierten Zweckvermögens mit Rechtspersönlichkeit, aber ohne Mitglieder oder Eigentümer,9 im Mittelpunkt. Die Stiftung übernimmt bei dieser Form der Vermögensnachfolge wesentliche Beteiligungen10 an in Deutschland ansässigen Kapitalgesellschaften, Mitunternehmerschaften an gewerblich tätigen deutschen Personengesellschaften und gegebenenfalls weitere Vermögenswerte mit der Zielsetzung, diese in Form einer Beteiligungsträgerstiftung11, einer Unternehmensträgerstiftung12 oder auch einer einfachen Familienstiftung mit Bankanlagen und Immobilien nach dem Tod des Unternehmers/Stifters fortzuführen.
Das Nachfolgemodell der Stiftung kann gegenüber anderen alternativen familienexternen Unternehmensnachfolgeszenarien, wie einem ganzen oder teilweisen Unternehmensverkauf, einer Liquidation, einer Verpachtung oder dem Einsatz eines Fremdmanagements13 für den handelnden Unternehmer eine Reihe von Vorteilen bieten.14 Nach einer empirischen Untersuchung von Fleschutz15 auf der Basis einer Befragung von 43 Stiftern deutscher unternehmensverbundener Stiftungen zeigten sich aus deren Perspektive folgende Motive zur Errichtung einer Stiftung:
- „Unternehmenskontinuität“ (durchschnittlicher Zustimmungsgrad der befragten Stifter von 4.7 auf einer Skala von 1-5)16
Das unternehmerische Lebenswerk wird in Form einer juristischen Person „institutionalisiert“17 und kann damit auch über die Schaffensperiode des heutigen Unternehmers hinweg verstetigt werden;18 der Unternehmer kann als Stifter formale und verbindliche Regeln in Form des Stiftungszwecks und der Stiftungsreglemente definieren, wie Unternehmen und Vermögen in seinem Sinne weitergeführt werden sollen.
- „Vorbeugung der Zersplitterung“ (Zustimmungsgrad 4.3)19
Bei familieninternen Vermögensnachfolgeszenarien verteilen sich die beim heutigen Eigentümer gebündelten Unternehmensanteile in der nächsten Generation typischerweise auf mehrere Personen mit potentiell unterschiedlichen Interessen und unternehmerischen Fähigkeiten. Die einheitliche unternehmerische Willensbildung über das Schicksal des Unternehmens einschließlich der damit verbundenen Arbeitsplätze droht bei einer herkömmlichen Vermögensnachfolge über Erbgänge verloren zu gehen.20 Bei einer Stiftung als verselbständigtem Zweckvermögen mit langfristig gebündelten Eigentümerrechten über das Unternehmen oder die Unternehmensbeteiligungen besteht diese Gefahr nicht.
- „Abwendung von Unsicherheiten bezüglich der Nachfolge“ (Zustimmungsgrad 4.1)21
Verschiedene Interessenslagen von Familienmitgliedern können zu wirtschaftlich bedingten Streitigkeiten über das vorhandene Familienvermögen führen, die im Extremfall zur Notwendigkeit der Veräußerung von Unternehmensanteilen, z. B. zur Bedienung von Pflichtteilsansprüchen oder zur Abfindung von güterrechtlichen Zugewinnausgleichsforderungen bei einer künftigen Scheidung der Ehe des Unternehmers, führen können.22 Durch die frühzeitige Errichtung einer Stiftung kann zudem verhindert werden, dass mögliche künftige Gläubiger des Stifters oder der Begünstigten in Haftungssituationen auf die in einer Stiftung gebundene Substanz des vorhandenen Familienvermögens zurückgreifen können.
- „Ideelle Gründe“ (Zustimmungsgrad 4.0)23
Die Institutionalisierung der Wünsche des Stifters / Unternehmers betrifft auch die zweckgebundene Verwendung der durch das Unternehmen oder das weitere Familienvermögen erwirtschafteten Erträge. Es kommen hier sowohl gemeinnützige als auch privatnützige, stets aber vom Stifter privatautonom festgelegte Zwecke in Betracht. Die Stiftungsorgane entscheiden anhand des seitens des Stifters vorgegebenen Stiftungszweckes und der Begünstigungsregelungen über Leistungszahlungen, die gemeinnützigen Zwecken, Familienmitgliedern und weiteren Angehörigen des Stifters oder auch anderweitigen, aus der Sicht des Stifters verfolgungswürdigen Zwecken zu Gute kommen sollen.
Weitere von Fleschutz identifizierte Stiftermotive, die sich zum Teil mit oben beschriebenen Hauptmotiven inhaltlich überlappen, sind „Führungskontinuität“ (Zustimmungsgrad 3,4), „Fortbestand des Namens“ (3,3) und „Mitarbeiter betreffende Gründe“ (3,2).24 Nach Schiffer ist dem Stifter durch eine spezifische Stiftungsgestaltung „damit im Idealfall die Möglichkeit gegeben, das Familienvermögen zu erhalten, die Zerschlagung des Unternehmens durch die Erben zu vermeiden sowie die Fortführung des Unternehmens der Familie zu sichern, der Unternehmerfamilie als solcher weiterhin Sinn zu geben und damit die Grundlage der Familie zu sichern.“ 25
In aller Regel besteht bei den Stiftern eine komplexe Kombination verschiedener der oben genannten Einzelmotive, wenn sie darüber nachdenken, eine unternehmensverbundene Stiftung zu errichten.26 Es ist allerdings ebenfalls festzustellen, dass Unternehmern trotz dieser starken Motive erfahrungsgemäß die lebzeitige Übertragung des Eigentums an ihren Unternehmensbeteiligungen an eine Stiftung aufgrund des damit einhergehenden unwiderruflichen unternehmerischen Kontrollverlustes schwerfällt. Wesentliche, an das Eigentum geknüpfte Dispositionsrechte, von denen sich Unternehmer erfahrungsgemäß nur schwer trennen können, sind etwa die Freiheit, die Unternehmensstrategie maßgeblich festzulegen, das Management zu besetzen oder auch die Anteile am Unternehmen jederzeit an Dritte veräußern zu können. Nach der bereits oben zitierten Untersuchung von Fleschutz zu unternehmensverbundenen Stiftungen geben wohl deswegen Stifter in Deutschland die operative Führung „ihres“ Unternehmens erst vergleichsweise spät ab, nämlich je zu einem Drittel vor dem 65. Lebensjahr, danach bis zum 75. Lebensjahr und ab dem 75. Lebensjahr bis zum Tode.27 Immerhin erfolgt die Gründung unternehmensverbundener Stiftungen aber in knapp 90% der Fälle noch zu Lebzeiten des Stifters. In mittlerweile mehr als der Hälfte (54%) der Fälle werden unternehmensverbundene Stiftungslösungen in Deutschland erst von den dem Unternehmensgründer nachfolgenden Generationen initiiert.28
Für deutsche Unternehmer liegt in diesem Zusammenhang zunächst die Prüfung der Möglichkeiten des deutschen Stiftungsrechts bei der Ausgestaltung einer privat- und/oder gemeinnützigen unternehmensverbundenen Stiftung nahe. Auf der Grundlage mehrerer multilateraler Staatsverträge erfolgte in den letzten Jahren allerdings eine zunehmende europaweite Harmonisierung von stiftungs-, gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, die für Unternehmer und Vermögensinhaber aus Deutschland auch die Prüfung der grenzüberschreitenden Errichtung einer Stiftung im Ausland als Alternative sinnvoll erscheinen lässt. Primär bietet sich hier aufgrund der sprachlichen, kulturellen und rechtlichen29 Nähe zu Deutschland das deutschsprachige EU-/EWR-Ausland an, also die Republik Österreich oder auch das Fürstentum Liechtenstein. Die Schweiz als weitere deutschsprachige potentiell relevante Stiftungsjurisdiktion30 ist als Nicht-EU-/EWR-Mitglied von den genannten Harmonisierungen nur in wesentlich geringerem Umfang betroffen, so dass nach wie vor rechtliche31 und steuerliche32 Hemmnisse die Errichtung einer schweizerischen Stiftung im Kontext der Unternehmensnachfolge eines deutschen Unternehmers stark erschweren.
Auch in Deutschland sind in den Bereichen der erbschaftsteuerlichen Behandlung der Übertragung von Betriebsvermögen oder auch im Bereich der Umsetzung von gegen die Diskriminierung von Auslandssachverhalten gerichteten EuGH- und EFTA-GH-Urteilen33 in nationale Steuervorschriften in den letzten Jahren bedeutsame Änderungen erfolgt, die die europarechtskonforme Neubegründung von österreichischen oder liechtensteinischen Stiftungsstrukturen durch deutsche Stifter erleichtern bzw. zum Teil überhaupt erst ermöglichen.
Es stellt sich für deutsche Unternehmer und vermögende Privatpersonen deshalb die Frage, ob die mittlerweile erfolgten Rechtsharmonisierungen innerhalb der EU bzw. innerhalb des EWR heute bereits so weit entwi...