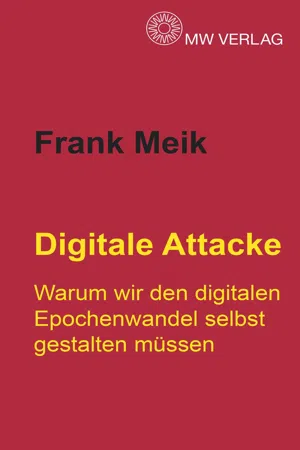![]()
Wir bereiten den Weg
Was nun tun wir denn so Schlimmes, werden Sie nach dem Gelesenen vielleicht fragen. Letzten Endes verhalten wir uns alle wie Menschen sich eben verhalten: Wir sind beeinflussbar durch die Gedanken Dritter. Wir hören zu und wägen ab, lassen uns Rat geben. Aber manchmal tun wir dies gerade nicht: auf andere hören, wenn doch dies der richtige Weg wäre. Wir folgen dem Weg des geringsten Widerstands, wir denken an uns, wir wollen manches Mal mehr, als uns guttut. Vor allem wollen wir es dann sofort. Oft fehlt uns auch der Weitblick. Genau dieser ist jedoch im Umgang mit der Digitalisierung entscheidend.
Wir brauchen ein Bewusstsein, was da auf uns zukommt. Dann allein wird sich in unserem Verhalten schon einiges ändern. Erst wenn wir direkt mit einigen Auswirkungen konfrontiert werden, stellt sich ein Unwohlsein ein. Als Microsoft im Herbst 2013 die neue Konsole Xbox One für Spiele am Fernsehen vorgestellt hat, waren nicht die neusten Blockbuster oder die ungeheuren Unterhaltungsmöglichkeiten der Daddelkiste Thema. Die Leute haben sich dafür interessiert, wieso dieses Teufelsgerät einmal an den Fernseher angeschlossen, ständig einen Blick auf das heimische Sofa wirft. Dort erkennt die Xbox die unterschiedlichen Familienmitglieder, bis zu sechs Stück – also genau die im Szenario kurz beschriebene Familie Müller.
Die Xbox erkennt die Familienmitglieder, ordnet ihnen einmal gelernte Namen zu – und weiß jederzeit, was jeder tut: ob er schläft, lacht, traurig ist. Ein ungeheuerlicher Eingriff in die Privatsphäre. Nicht umsonst sind solche Funktionen zunächst nur in den Vereinigten Staaten gestattet.
Denn noch haben wir ein ausgeprägteres Bewusstsein für die Privatsphäre und den Datenschutz als unsere amerikanischen Freunde. Dank Facebook, Google und nun auch Microsoft allerdings verwischen diese Grenzen mehr und mehr.
Dagegen müssen wir angehen.
Wenn wir solche Zusammenhänge erkennen, dann ist das meiner Ansicht nach ein erster wichtiger Schritt. Werfen Sie mit mir einen Blick auf das, was ich als die fünf Todsünden brandmarke. Wenn wir hier ansetzen, einen Ordnungsrahmen der Politik schaffen und selbst wachsam bleiben, dann haben wir schon einiges an Terrain gewonnen.
Unsere erste Sünde: Naivität
Unsere erste Todsünde im Umgang mit der Digitalisierung ist unsere Naivität. Ohne kritisch zu reflektieren, feiern wir die meisten Veränderungen ausschließlich als Chance und vergessen Herausforderungen, die sie ebenfalls mit sich bringen können. Dabei vergessen wir nicht selten zu fragen, was wir dafür tun müssen, dass wir von einer Veränderung profitieren können. Wie wichtig diese Überlegungen wären, zeigt jedoch ein Beispiel.
Sollten die Web-Kraken in Kürze in das Bankgeschäft einsteigen, sie hätten ein leichtes Spiel. Das zeigt eine Studie am Beispiel Apple. Der Konzern war lange Zeit reiner Lieferant von Computern. Steve Jobs, der 2013 gestorbene Mitgründer des Unternehmens, langjähriger Chef und Visionär der Informationstechnik, hat den kalifornischen Konzern umgebaut – selbstverständlich in Richtung eines Kraken.
Er hat richtig und vor vielen anderen erkannt, dass Daten und Software zur Währung für Unternehmen geworden sind – und dass die Gewinnspannen in diesem Feld astronomisch sind. Er hat deshalb nicht nur den Musikspieler iPod auf den Markt gebracht, zusammen mit dem kleinen digitalen MP3-Gerät hat er ein ganzes Ökosystem aufgebaut. Jeder, der Lust auf die moderne Variante eines Walkman hatte, musste sich und seine Daten, samt sensiblen Informationen wie der Kreditkartennummer, in die Hand von Apple begeben. Im Gegenzug bekam der Kunde dann nicht nur das Gerät, sondern auch einen einfach zugänglichen, virtuellen Musikladen, iTunes genannt. Darüber lassen sich inzwischen nicht mehr nur Musiktitel kaufen, sondern Filme, Fernsehserien, Zeitungen, Bücher oder kleine Programme für die Apple-Geräte. Ein Milliardengeschäft – aus dem es für die Klientel aber kein Entrinnen gibt.
Experten sprechen von einem goldenen Käfig: Die Kunden fühlen sich wohl bei Apple, bekommen schicke Geräte, die zu ihrem Lebensstil gehören, diesen sogar prägen. Alles funktioniert einfach, reibungslos. An den Gitterstäben allerdings gibt es nichts zu rütteln.
Längst gibt es nicht mehr nur Computer oder Musikspieler von Apple, sondern auch Mobiltelefone und Tabletcomputer mit berührungsempfindlichem Bildschirm. Wer sich einmal eines dieser Geräte zugelegt hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einem anderen Produkt der Marke mit dem angebissenen Apfel greifen. Die Kenner sprechen da von einem Halo-Effekt: Die positiven Erfahrungen mit einem Gerät strahlen aus und ermuntern die Kunden, alles aus der Hand von Apple zu kaufen. Alles so schön einfach.
Auf diese Weise laufen sie genau in jene Falle, die Jobs und seine Manager ausgelegt haben. Ein Handy mit dem Microsoft-System? Ein Tablet von Google? Ein Musikspieler von Sony? Alles zusammen geht nicht oder zumindest mit einem derart immensen technischen Aufwand, dass der Otto-Normal-Nutzer schon von vornherein lieber von solchen Gedanken Abstand nimmt.
Mehr als hundert Milliarden Dollar hat Apple auf der hohen Kante. Immer wieder taucht die Frage auf, für welche Zwecke das Unternehmen diese immense Summe einsetzen will. Zwar werden die Aktionäre nun seit geraumer Zeit am Unternehmenserfolg beteiligt, doch noch immer ist der Konzern eine Gelddruckmaschine. Wieso also nicht die Mittel nutzen, um gleich eine Bank zu eröffnen?
KAE, eine kleine südamerikanische Unternehmensberatung, hat in den Vereinigten Staaten und Großbritannien insgesamt 5.000 potenzielle Kunden gefragt, was sie von einer Apple-Bank halten würden. Das Ergebnis: Zehn Prozent der Befragten würden aus dem Stand heraus Apple ihr Geld anvertrauen. Ohne weiter nachzudenken, so groß ist ihr Vertrauen in das Unternehmen.
Die Marktforscher haben gezielt auch jene Leute befragt, die bereits ein iGerät ihr eigen nennen, sei es nun iPad, iPod, iPhone oder einen der Computer des Konzerns. Die Zustimmung in dieser Gruppe der Apple-Kunden war schlicht überwältigend.
43 Prozent der Apple-Nutzer würden am liebsten nicht nur ihre Daten und sensiblen Informationen in der Hand des Technikkonzerns wissen. Sie möchten dem Unternehmen auch noch ihr Geld anvertrauen.
Ist das nicht erstaunlich?
Völlig abstrus wird es in meinen Augen, wenn wir noch tiefer in die Studienergebnisse eintauchen. Zwei Drittel der Teilnehmer gaben, befragt nach ihrer Begeisterung für Apple, an, sie vertrauten eben dem Unternehmen. Einem Konzern mit Sitz in den USA, der ebenso wie Amazon Mitarbeiter zu Billiglöhnen beschäftigt. Von den Angestellten in den Flagship-Stores etwa ist bekannt, dass sie neben der schlechten Entlohnung über Lärm und Dauerstress klagen.
Diesem Unternehmen schenkt das Gros, insbesondere junger Menschen, also mehr Vertrauen als der Bankfiliale um die Ecke. In der jene Menschen arbeiten, denen wir abends beim Stammtisch begegnen. Aber welche Rolle spielt das schon gegen die Erfolgsgeschichte des Web-Giganten? Kaufen wir nicht Emotionen und wollen Teil des Ganzen sein? Wunderbar – hoffnungslos.
Fast die Hälfte der Studienteilnehmer gibt zudem an, für Apple spreche die Einfachheit, mit der das Unternehmen Probleme löse. Ein Zugang zu einem Konto bei einer iBank sei also wahrscheinlich wohl einfacher zu nutzen als das herkömmliche Bankkonto. Das wirft zum einen ein schlechtes Licht auf die uralten Geschäftspraktiken traditioneller Kreditinstitute. Zum anderen verkennen die möglichen iBank-Kontoinhaber, dass nicht nur sie leichteren Zugang zu ihrem Geld haben, sondern auch Apple.
Ich gehe nicht davon aus, dass Apple die Konten der Klientel plündern wird. Apple ist nicht kriminell. Apple ist klug und gerissen, wenn Sie so wollen. Denn die Daten, wer wie viel Geld besitzt, von wem es kommt, wohin es geht, das ist doch einiges mehr wert als der pure Betrag, der auf dem Konto liegt.
Wir erinnern uns an Deutsche-Bank-Chef Fitschen: Gewinnen wird auch im Bankgeschäft künftig der, der die meisten Informationen über die Klientel besitzt, und zwar möglichst in jeder Lebenslage. Wer gerade eine App, ein kleines Programm, auf sein Handy lädt, um einen Immobilienkredit zu berechnen – dem kann man in einem nächsten Schritt das Angebot für den Kredit auch gleich schicken.
Umgerechnet auf die Bevölkerung würde eine iBank von Apple laut KAE auf einen Schlag über ein Potenzial von 37 Millionen Kunden verfügen. Und das nur in zwei Ländern, in den USA und in Großbritannien. Zum Vergleich: Die Bank of America zählte im Jahr 2010 gerade 57 Millionen Kundenkontakte – aufgebaut seit dem Jahr 1784.
Die Ergebnisse sprechen für sich. Wir sind naiv, wenn wir nicht davon ausgehen, dass unsere Daten, die wir Unternehmen freiwillig überlassen, systematisch genutzt werden. Oder vielleicht ist es auch den Digital Natives bekannt und sie nehme es in Kauf, weil sie sich dadurch perfekte Dienste erhoffen? Dem Begriff des Vertrauens scheint jedenfalls eine erstaunliche Entwicklung bevorzustehen.
Amazon, Google & Co. denken in viel längeren Zeiträumen.
Schon bei Gründung Ende der 90er Jahre haben sich Larry Page und Sergej Brin vorgenommen, alle Informationen dieser Welt zu digitalisieren und für Google aufzubereiten. An diese Mission halten sie sich noch heute. Wer im Weg steht, wird weggeräumt, sei es durch geschicktes Lobbying, viel Geld oder eben Aussitzen. Das Ende der aktuellen Wahlperiode kommt bestimmt – und mit ihm ein Politiker, der sich höchstwahrscheinlich den Ideen von Google gegenüber aufgeschlossener zeigt. Die Web-Giganten tasten sich immer wieder an Grenzen und verschieben diese nach und nach.
Die Zermürbungstaktik der Unternehmen, unsere Privatsphäre Stück für Stück aufzuweichen, zahlt sich aus.
Allerdings kann ich nicht allein die Politiker für die Todsünde der Naivität schelten. Zum einen ist ihr Verhalten mehr als menschlich: Wir halten am einmal eingeschlagenen Weg fest, auch wenn er sichtbar in unser Verderben führt; zum anderen sind wir – als Gesellschaft – keinen Deut besser.
So war ich sehr erstaunt angesichts einer Umfrage des deutschen Hightech-Lobby-Verbandes Bitkom. Fast jeder hat schon einmal von Google Glasses gehört, einer Hightech-Brille der Suchmaschine. Viele Politiker haben sich im Sillicon Valley stolz mit dieser „Brille“ ablichten lassen. Im Prinzip handelt es sich um einen kleinen tragbaren Computer, in den Rahmen einer Brille integriert. Kombiniert mit einer Digitalkamera und der Möglichkeit, Informationen auf das Brillenglas zu projizieren, geht es um nicht weniger als die Digitalisierung des Sichtfeldes – oder anders gesagt: um die Möglichkeit, Google das Sehen beizubringen. Alles, was der Google-Glass-Nutzer anschaut, sieht auch Google; alle Informationen werden auf den Netzrechnern der Suchmaschine verarbeitet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass geistig klar denkende Menschen so etwas nutzen. Es bedeutet die völlige, kampflose Aufgabe der Privatsphäre. Mehr: Jeder Google-Glasses-Träger präsentiert seine Intimsphäre auf dem Silbertablet.
Und wofür? Um die angesagteste Technik zu nutzen, das allein reicht vielen ja schon als Motivation. Dass irgendwelche Informationen, die mir Google ungefragt auf das Brillenglas schickt, auch nur kurzfristig von einem größeren Mehrwert sein könnten, halte ich für ausgeschlossen. Zwar ist der Verkauf der Brille gestoppt – aber doch wohl nur, um sie zu verbessern und mit größerer Qualität erneut auf den Markt zu bringen.
Aber offenbar bin ich nicht nur ein Digital Immigrant, sondern ein Dinosaurier des digitalen Zeitalters, Angehöriger einer aussterbenden Art von Zeitgenossen, die über das reine Gadget hinausdenken. Anders kann ich mir das Ergebnis einer Beobachtung im Frühjahr 2013 des besagten Hightech-Lobby-Verbandes nicht erklären.
In einer repräsentativen Umfrage hat der Bitkom herausgefunden, dass fast 14 Millionen Deutsche sich vorstellen könnten, eine Datenbrille wie Google Glass zu nutzen. Das entspricht beinahe jedem fünften Deutschen. Und damit nicht genug: Augmented Reality und Virtual Reality (siehe Brille von Oculus Rift u.a.) könnten die neuen Trends der nächsten beiden Jahre sein. Warum soll nicht auch die Wirklichkeit durch die Virtualität noch mehr in der Wahrnehmung angereichert werden? Es gibt aber auch andere Einschätzungen. Immerhin: 35 Prozent der Befragten sind skeptisch, weitere 37 Prozent – zu denen auch ich mich zählen würde – geben an, um die neuen Geräte einen großen Bogen zu machen. Es gibt sie also noch, die Denker, die sich der Konsequenzen ihres Handels bewusst sind, ein Glück. Aber welche Naivität treibt die anderen? Ich kann es nicht verstehen. Der Verlust der Privatsphäre liegt auf der Hand. Die Vorteile auf der anderen Seite sind begrenzt. Und trotzdem gieren so viele Technikjünger nach den neuesten Gadgets, koste es, was es wolle – und sei es die eigene Intimität.
Irgendwann kommt auch die Barbie, die mit dem Kind spricht, es ausfragt und alle Informationen überträgt. Und übrigens: Welche Daten senden die Rauchmelder und Thermostate an die Cloud, die doch angeblich nur die Sicherheit und unseren Geldbeutel im Sinn haben? Die Technikkonzerne wissen natürlich um diese Technikgläubigkeit. Apple schafft es auf diese Weise Jahr für Jahr, neue Geräte vorzustellen, die beinahe wie ein Ei dem anderen gleichen, und trotzdem bei Millionen Konsumenten immer wieder aufs Neue einen Kaufreflex auslösen.
In unserer technikgläubigen Gesellschaft ist das Neue inzwischen schon ein Wert – egal, ob es einen Nutzen bringt, egal sogar, wenn es nachweislich zu unserem Schaden ist. Wer sich dem Neuen versagt, gar kritisch hinterfragt, der hält den Fortschritt der Gesellschaft auf, der gilt nichts mehr.
In allen Zeiten hat es Kritiker der Moderne gegeben, jene, die an der Kutsche festgehalten haben, bis sie im Straßenverkehr alleine unter Kraftfahrzeugen waren. Darum geht es mir nicht. Ich will nicht am Vergangenen festhalten; im Gegenteil. Stets habe ich auch neue Technik sehr früh genutzt. Der Nutzen muss allerdings im Vordergrund stehen. So nutze ich ein Smartphone, weil es mir das Koordinieren meiner Termine vereinfacht und die Kommunikation mit Geschäftspartnern.
Allerdings habe ich mit dem Kauf des modernen Telefons nicht auch mein Hirn an der Kasse abgegeben.
Ausdrücklich plädiere ich für den Gebrauch moderner Werkzeuge. Aber bitte mit Verstand. Jeder Nutzer sollte sich hinterfragen, was er preisgibt und was er dafür erhält und ob der Vergleich von geben und nehmen für ihn langfristig positiv ist. Ich gehe noch weiter: Wir machen es den Weg-Giganten meiner Überzeugung vielfach so einfach, Teile unseres Lebens zu übernehmen, indem wir zu lange an den Methoden der Vergangenheit festhalten.
Werfen wir einen weiteren Blick auf die Finanzbranche: In Europa florierte das Finanzwesen im Mittelalter. Es nahm seinen Ursprung im 13. Jahrhundert in Florenz. Die Medici bauten später ihre Bank mit Filialen in allen europäischen Städten auf. Es ging um die Gewährung von Krediten und die Anlage von überschüssigen Geldern, zumeist von Händlern.
Und was tun die Banken heute? Im Grundsatz fußt unser Bankensystem auf dem, was die Medici vor nunmehr fast s...