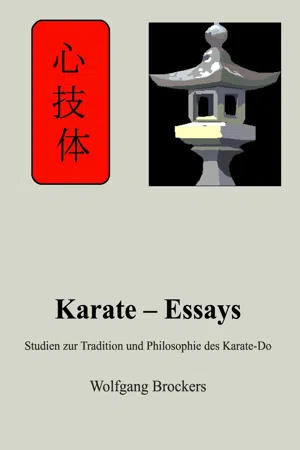![]()
Der Sensei - Meister, Lehrer, Trainer
Über die Rolle des Meisters in der Tradition des Karate-Do
1 Der Sensei – ein Lehrer mit umfassendem Bildungsauftrag
In den fernöstlichen Künsten nimmt der Lehrer bzw. Meister eine zentrale Rolle ein. Das gilt auch für die chinesisch inspirierten Kampfkünste, in denen ein vorbildlicher und weiser Lehrer als eine Art Ideal angesehen wird. Überhaupt findet man in der Kulturtradition des fernen Ostens von der Frühgeschichte an immer wieder das Bild eines kulturprägenden Meisters oder Weisen, dem für gewöhnlich ganz herausragende, fast übermenschliche Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben wurden. Nicht selten wurde einem solchen göttliche Verehrung entgegengebracht. In der abendländischen Kulturgeschichte, die griechisch-römisch und germanisch geprägt ist, gibt es weder in der Kriegskunst noch im Sport dafür eine Parallele. Lediglich im frühen Christentum findet sich – wie auch in anderen Religionen - zuweilen die Bezeichnung „Meister“ für den Religionsstifter oder für einen Propheten. In der westlichen Mythologie sind es eher die Götter, Halbgötter oder Helden der Mythen, die Erklärungen für besondere Entwicklungen der vorgeschichtlichen Zeit der Völker liefern. Heutzutage wird die Bezeichnung „Meister“ im Westen eher für eine Berufsqualifikation im Handwerk oder für erfolgreiche Sportler bei bedeutenden Wettkämpfen verwendet. Für westliche Bürger, besonders für Adepten der Kampfkünste, stellt die östliche Meisteridee ein besonderes Faszinosum und Ideal dar.
Während man in der westlichen Welt mit der Bezeichnung Lehrer eine Person verbindet, die Wissen oder Können im Sinne einer Ausbildung vermittelt, geht der Anspruch des Lehrers oder Meisters (japanisch: sensei) in den asiatischen Kulturen weit darüber hinaus. Dort ist er jemand, der nicht nur Inhalte vermittelt, sondern über die Auseinandersetzung mit seiner Kunst auch eine moralische und spirituelle Bildung sowie eine Lebenshaltung vermittelt, die im Einklang mit der kosmischen Ordnung (tao/do) und der Natur ist. Ein solcher Lehrer vermittelt technisches Können und selbst kognitives Wissen immer eingebunden in dieses übergeordnete Ziel Er hilft seinen Schülern, die meist im selbstsüchtigen Ego begründeten Hindernisse zu be seitigen, um offen für die Erfahrung des großen Einen zu werden. Er lenkt letztlich den inneren Kampf seiner Schüler um eine innere, geistige Befreiung.
Diese spezielle Rolle des Lehrers und besondere erzieherische Ausrichtung ist durch die taoistische und zen-buddhistische Geistestradition geprägt. In der chinesischen Kulturtradition hat man nahezu jede Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Kenntnissen „Meister“ (dse) bezeichnet. In der japanischen Zen-Tradition erhielt ein Lehrer die Ehrenbezeichnung „Roshi“ (verehrungswürdiger Meister) erst, wenn er selbst tiefe Erleuchtung erfahren und dafür ein Bestätigungssiegel eines anderen Lehrers erhalten hatte. Dazu waren ein reiner, standhafter Charakter und eine reife Persönlichkeit erforderlich. Allerdings sind auch im heutigen Japan diese strengen Maßstäbe abhanden gekommen, so dass dieser Ehrentitel häufig allein aus Respekt vor der Position und des Alters der Person verwendet wird.
In den zen-orientierten Budokünsten ist dagegen der Begriff „Sensei“ üblich (auch in Abgrenzung gegenüber Schülern oder Studenten), der einen Lehrer bezeichnet, der sich schon lange auf dem Weg befindet, der seine Kunst auf einem hohen Niveau beherrscht und die Schwierigkeiten des Weges kennt. In der Persönlichkeit eines solchen Lehrers sollte der jahrelange Kampf um innere Haltung und Bemühen um ein ewiges Ideal sichtbaren Ausdruck gefunden haben. Wie im Zen ist auch eine echte Budo-Ausbildung ohne Meister nicht möglich. Er sorgt durch eine harte körperliche Schulung über Jahre hinweg dafür, dass die Schüler eine charakterliche Läuterung erfahren. Er greift rigoros ein, wenn sich beim Schüler das eitle, selbstsüchtige Ego erhebt. Die Rolle eines Meisters impliziert die Funktion der Lehre und Ausbildung, d.h. ohne Schüler kein Meister! Dazu bedarf es einer größeren persönlichen Qualifikation, als ein großes technisches Können und umfangreiches theoretisches Wissen zu besitzen. Der Budo-Meister muss weder ein Gelehrter noch ein Champion sein; jedoch muss er Menschen auf dem Weg zur Verinnerlichung der Technik und zur Befreiung des Selbst von dem fiktiven „Ich-Männlein“ führen können. Diese Erziehung und Ausbildung hat die körperlich-geistig-seelische Ganzheit des Schülers im Blick und darum ist die Ausbildung in den Zen- und Budokünsten immer auch mit einem harten körperlichen Training und der Einübung spezifischer Rituale verbunden, wozu immer das Mittel der unendlichen Wiederholung gehört. So gehören die höflichen Verbeugungen dazu, das Ego klein zu halten.
„Eine Verneigung, bei der das Ich völlig abwesend ist,
ist die höflichste aller Verneigungen. (…..)
Es ist ein zeremonielles Selbst-Vergessen,
ein Erleuchtet werden durch die Verneigung“
(Maezumi, 2002, S. 70).
Schließlich werden das mühelos wirkende, gesicherte Können und die würdevolle Ausübung der Rituale zu einem Ausdruck eines verwandelten Seins. Darum spricht man im Osten auch von einem „Tao der Technik“, wenn Technik und Tao in einem Menschen eins geworden sind (vgl. Dürckheim, 1988, S. 99).
In den Kampfkünsten muss der sogenannte Meister also besonderen technischen und moralisch-geistigen Ansprüchen genügen, um die Rolle eines meisterlichen Vorbildes und Erziehers erfüllen zu können.
2 Chinesische Ursprünge des Meisterbildes
In der chinesischen Geistestradition gibt es keine Schöpfungsgeschichte odermythen wie im Abendland. Vielmehr steht dort am Anfang ein personifiziertes Symbol der himmlischen und irdischen Ordnung. Die Menschen der Vorzeit, die noch in „unordentlichen“ Verhältnissen lebten, wurden von Weisen belehrt, wie sie im Einklang mit den Normen von Himmel und Erde zu leben hatten. Der durch höhere und tiefere Einsicht ausgezeichnete Weise galt als höchste Verkörperung der menschlichen Gesellschaft und verband diese durch allgemeingültige Normen mit der himmlischen Ordnung. Es galt als Verdienst dieses Weisen oder Meisters, die Ordnung des Himmels und der menschlichen Gesellschaft erkannt und festgesetzt zu haben, wodurch er Magier, Lehrer, Richter, Prophet oder auch Heerführer in einer Person wurde. Wer so als Mittler zwischen der himmlischen Ordnung des Universums und der menschlichen Gesellschaft stand, wurde als Herrscher auch bald „Sohn des Himmels“ genannt. So galt König Wen (Gründer der Dschou-Dynastie, um 1100 v. Chr.) als Weiser, da er den Grundtext des “Buches der Wandlungen“ verfasst haben soll. Sein Sohn, Herzog Dan von Dschou, galt ebenfalls als einer der ersten Weisen, weil er die Satzungen und Riten geschaffen haben soll, die künftig für alle Herrscherdynastien als Vorbild gel -ten sollten.
Sehr früh schon vermischten sich die Vorstellungen des Weisen mit dem eines weisen Herrschers, der durch seine Weisheit die Menschen mit den Sphären des Himmels und der Erde in ein harmonisches Verhältnis bringt. Auf der anderen Seite verkörperte ein schlechter Herrscher Unordnung und Disharmonie, die Wirrnis der Welt. So waren nach altchinesischer Vorstellung Wohl und Ordnung eines Staates von der Tugend („de“) der Verantwortlichen abhängig. Daher zeigt sich in der chinesischen Frühzeit mit der Idee des Meisters oder Weisen ein Ideal, das sowohl die Rolle eines religiösen und weltlichen Führers innehat und gleichzeitig als Gesetzgeber und Lehrer für die Wahrung der himmlischen Ordnung und für soziale Harmonie in der Gesellschaft zuständig ist. Dieses Bild wurde noch durch die Tendenz verstärkt, dass immer mehr Idealvorstellungen der jeweiligen späteren Zeit in die mythischen Gestalten der ersten Weisen zurückprojiziert wurden, je mehr diese in den Nebeln grauer Vorzeit verschwanden.
Mit zunehmender Zivilisation und Entwicklung einer arbeitsteiligen Gesellschaft wandelte sich das Bild des Weisen allmählich, während der Kaiser, der „Sohn des Himmels“, als Symbol alle idealtypischen Tugenden verkörperte. Die Taoisten (Dauisten) wirkten zunehmend als spirituelle Lehrer, indem sie darauf hinwirkten, die Lebenshaltung dem “dau“ (tao/ do) anzupassen. Ziel war die Rückkehr der Gesellschaft in die große mystische Einheit des „Dau“ (tao/do). Als Gründer und Meister der Dauisten gilt die legendäre Persönlichkeit Lao-tse (gespr: Laudse/ lau =alt, dse = Meister). Ihm wird auch die berühmte Schrift “Tao-te-king“ (gespr: daudedsching) zugeschrieben, was man mit „Schrift vom rechten Weg und der Tugend“ übersetzen kann.
In Dschuang-dses Schrift „Das wahre Buch vom südlichen Blütenland“, der anderen grundlegenden Schrift des Dauismus, findet sich folgender Hinweis für tugendhaften Handeln und Erlangung des ewigen Daus
„Wer das Dau begriffen hat, strebt nicht nach Ruhm;
wer höchste Tugend besitzt, strebt nicht nach Besitz.
Der wahrlich große Mensch hat eingebüßt sein Selbst und
erreicht den Gipfel der Selbstbeschränkung.“
(Dschuangdse, in: Schwarz, 1998, S. 70).
Als in der Spätzeit der Dschou-Dynastie durch Machtkämpfe und Kriege rivalisierender Königreiche die gesellschaftliche Ordnung in China immer mehr zerrüttet wurde, suchten die Herrscher dauistische Lehrer als Ratgeber und Regenten zu gewinnen, um die Ordnung wieder herzustellen. Auch Dschuang-dse erhielt ein solches Angebot, lehnte dieses aber ab.
In diese unruhige Periode fallen auch Leben und Werk des Kung-dse, 551-479 v. Chr., (Meister Kung, lateinisiert: Konfuzius). Kung-dse hatte sich vergeblich um ein öffentliches Amt bemüht, um als Berater eines Fürsten an der Wiederherstellung einer tugendhaften gesellschaftlichen Ordnung mitzuwirken. Er schuf eine Schule, eine Art Akademie, und verfasste die vier klassischen Bücher der chinesischen Literatur in ihrer letztgültigen Form. In seiner Lehre verzichtete er auf die spirituellen und kosmischen Aspekte und entwickelte eine sozial-politische Morallehre, die das ganze zwischenmenschliche Leben und die Beziehung zur Obrigkeit festen Regeln unterwarf. Menschenfreundlichkeit spielt in seinem System eine dominierende Rolle, wobei der gehorsame Sohn und der treue Untertan als pädagogisches Ziel angesehen wurden, wie das folgende Zitat belegt: „Selten geschieht es, dass einer, der seine Eltern und älteren Brüder ehrt, willentlich gegen die Obrigkeit verstößt“ (Konfuzius in: Schwarz, 1998, S.20).
Damit sollten politische Ordnung und Frieden wiederhergestellt und Zwietracht vermieden werden. Über die Wirkung eines Lehrers und Meisters äußerte sich Kung-dse wie folgt:
„Aus der Ferne betrachtet, wirkt er streng.
Naht man ihm, ist er sanft. Hört man ihn reden,
klingen seine Worte endgültig und entschieden.“
Auch wenn Kung-dse nicht gleich durchschlagenden Erfolg hatte, fand seine Lehre allmählich immer mehr Anhänger. Mit der Zeit wurden seine Lehren die Grundlage für die bis heute geltende soziale Ordnung in China.
3 Meister der Kriegs- und Kampfkünste
Schon im chinesischen Altertum fand sehr früh eine Spezialisierung der technischen und handwerklichen Fähigkeiten statt. Das galt auch für die Kriegs- und Kampfkunst. Für Leute, die sich intensiv mit einer Sache beschäftigten, wurde die Bezeichnung „kung-fu“ verwendet, die später auch auf die chinesische Kampfkunst übertragen wurde, weil auch sie hinge bungsvollen Fleiß erforderte. Die chinesische Kampfkunst wurde ursprünglich „wu-shu“ bezeichnet. Das gleiche Schriftzeichen dafür wird auch in Japan verwendet; nur wird es dort „bujutsu“ gelesen. Es bedeutet sinngemäß „die Lanze aufhalten“, was doppelsinnig zu interpretieren ist, nämlich den fremden Angriff sowie auch den eigenen zu vermeiden.
Die Pflege spezieller Künste war aber für einfache Handwerker und Bauern schon aus zeitlichen Gründen nicht möglich; so blieb dies für lange Zeit eine Sache gehobener Kreise oder der Mönche in Klöstern. Aber auch die Experten der Kampfkünste, denen es zunächst nur darum ging, ihr Können für den Einzelkampf oder für den Krieg zu perfektionieren, wurden bald als Meister bezeichnet. Ursprünglich trugen lediglich die spirituellen und politischen Lehrer diesen Ehrentitel; sehr bald – wann, ist nicht nachvollziehbar – wurden aber alle lehrenden Spezialisten und Experten mit diesem Titel bezeichnet. Aber alle lebten in einer dauistisch-konfuzianisch geprägten Kultur und Tradition, so dass zwangsläufig auch solches Gedankengut mit ihrer Kunst verwoben war. So stellt die Übernahme der Meister-Bezeichnung für Experten und Lehrer der Kampfkunst auch eine folgerichtige Entwicklung dar.
Als Anfang des 6. Jahrhunderts der indische Brahmane Bodhidharma, der 28. Nachfolger Buddhas, nach China kam und sich im Kloster Shaolin niederließ, führte er den Meditations-Buddhismus in China ein. Maßgeblich durch den Einfluss Bodhidharmas erhielt die im Kloster praktizierte Kampfkunst wieder eine mehr spirituelle, moralische Ausrichtung und stand lange Zeit im Dienst des Meditationsweges. Auf Bodhidharma gehen auch die goldenen Dojukun-Regeln zurück, die für alle Kampfkunstrichtungen zur moralischen Leitschnur wurden. Die Übungspraxis des frühen Shaolin-Kempo war mehr gymnastisch und meditativ ausgerichtet und nicht kampforientiert. Sie drehte sich um Dau-Komplexe (Kata), wodurch der Übende sein Selbst in Einklang mit dem kosmischen Dau (Do) bringen sollte. Um einen solchen spirituellen Weg zu beschreiten, braucht man die weise Führung durch einen Meister, der seinen Schülern die egoistische, dunkle Seite ihres Wesens aufdeckt und ihren Geist als übereinstimmend mit dem Geist des kosmischen einen Geistes erfahrbar macht. Das frühe Shaolin-Kempo stellt mit den bei -den Merkmalen eines körperlich-technischen Weges und einer spirituellengeistigen Ausrichtung, die dauistische, konfuzianische und buddhistische Elemente bewahrt, schon das Grundmuster und Vorbild für alle später entwickelten Kampfkünste dar. So sehen fast alle der heutigen ostasiatischen Kampfkünste im Shaolin-Kloster ihren Ursprung. Nur solche können den Anspruch einer Kampfkunst im Sinne des „Do“ für sich reklamieren, die sich diesem ganzheitlichen Anspruch verpflichtet fühlen.
Im 12. und 13. Jahrhundert, als China zunehmend durch mongolische Angriffe bedroht und schließlich erobert wurde, erfolgte eine zunehmend kämpferische Ausrichtung des Shaolin-Kempo. Erst recht nach der Auflösung des Shaolin-Klosters im 16. Jahrhundert wurden neue kämpferische Konzepte entwickelt, die auf den Tierstilen basierend nun mehr auf den praktischen Nahkampf ausgerichtet wurden. In jener Zeit hatten sich die Kampfkunst-Mönche des Shaolin-Klosters in ganz China verstreut, wodurch allmählich immer mehr Differenzierungen und Stile des Kempo entstanden, die in der rückschauenden Betrachtung grob in die „südlichen kurzen Stile“ und die „nördlichen langen Stile“ unterteilt werden können. In dieser Phase, in der die Kampfkunst wegen der praktischen Nutzanwendung als Verteidigung gelehrt und gelernt und auch verändert wurde, ist es naheliegend, dass die moralisch-spirituellen Inhalte immer mehr vernachlässigt wurden. Jedenfalls scheint die Tatsache, dass im 16. Jahrhundert der Moralkodex des Shaolin-Kempo in 10 Regeln neu kodifiziert wurde, dafür zu sprechen. Andererseits muss wohl davon ausgegangen werden, dass die Meister-Bezeichnung eher inflationär verwendet wurde, denn einerseits untermauerte sie die Autorität der Lehrer und andererseits entspricht es wohl dem menschlichen Geltungsbedürfnis.
Seit dem Mittelalter gab es einen intensiven kulturellen Austausch zwischen China und Okinawa, wodurch auch die chinesische Kampfkunst nach Okinawa kam und sich mit der dortigen eigenständigen Kampfkunst zum Okinawa-te verband. Diese Entwicklung wurde gefördert durch die Ansiedlung von 36 chinesischen Familien in Naha auf Okinawa und durch den Aufenthalt von Diplomaten bzw. Militärattachés nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Zwei dieser Gesandten waren berühmte Meister des chinesischen Kempo, nämlich Wanshu und Kushanku, die speziell ihre Dau (Kata) Wanshu (Empi) und Kushanku (Kanku) dort lehrten und insgesamt die okinawanische Kampfkunst sehr beeinflussten. Die Experten des Okinawate, die sich bis dahin ausschließlich an Techniken im Kampf auf Leben und Tod orientierten, fanden zunächst keinen Zugang zu den inneren Werten des chinesischen Kempo und übernahmen daher diese Übungsformen als technische Methode. Sie veränderten viele Daus (Kata) und interpretierten sie – ihrer Tradition gemäß – als praxisorientierten Kampfstil. Im Laufe der nächsten einhundert Jahre ließen sich doch immer mehr okinawanische Meister in die geistigen Aspekte einweisen; sie gingen bei chinesischen Meistern in die Lehre und manche bereisten China, um dort ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen. Dadurch wurde bis ca. 1850 das Okinawa-te zu einer den ganzheitlichen Ansprüchen genügenden Kampfkunst, wodurch diese Lehrer sich im zunehmenden Maße dem umfassenden Meisterideal verpflichtet fühlten. Allerdings gab es gewiss auch Lehrer, die an der rein technisch und praktisch orientierten Ausrichtung des Okinawa-te festhielten; sie benutzten die chinesischen Daus lediglich dazu, ihr altes Konzept zu erweitern. Die herausragende Persönlichkeit in der Meistertradition der Kampfkünste war zweifellos der Begründer des modernen Karate, Gichin Funakoshi (1869-1958). Er war ein hoch gebildeter Mann, hatte die Kampfkünste Okinawas auf einem hohen Niveau gemeistert und beschäftigte sich mit chinesischer Kultur und mit Zen-Künsten. Er verband die höchsten moralischen Leitgedanken des Zen-Buddhismus mit der Kampfkunsttradition seiner Heimat Okinawa und schuf damit ein leuchtendes Meistervorbild, das in der Kempo-Karate-Tradition seinesgleichen sucht.
4 Wie in Japan die Kriegskunst zur Budokunst wurde
Die Meistertradition in den Budokünsten Japans mit dem hohen Anspruch eines spirituellen und moralischen Vorbildes speist sich nicht nur aus der Traditionslinie in China-Okinawa, sondern auch aus einer Linie, die sich aus der Schwertkunst der Samurai und der Verbindung mit dem Zen-Buddhismus entwickelte.
Im 13. Jahrhundert musste sich Japan zweier massiver Eroberungsversuche der Mongolen erwehren. Beim ersten Versuch 1274 gelang dies nur mit großer Mühe und dank eines hilfreichen Sturmes (kamikaze), der die mongolische Flotte zerstörte. Dabei waren auch Mängel und Schwächen in der Kampfkraft der Samurai deutlich geworden. Daraufhin sorgte der Hojo-Regent Tokimune dafür, dass die militärische Schulung der Samurai, besonders das Bogenschießen und der Schwertkampf, nach den Prinzipien des Zen-Buddhismus, der im 12. Jahrhundert durch Eisai und Dogen endgültig in Japan etabliert werden konnte, ausgerichtet wurde. Diese Ausbildung führte dazu, dass die jeweilige Kampftechnik effizienter und den Samurai die Angst vor dem Tod genommen wurde. Bei der zweiten Invasion 1281 hielten die zahlenmäßig unterlegenen Samurai den Mongolen sieben Wochen lang stand und konnten sie schließlich völlig vernichten. Der Schwertkämpfer wurde immer wieder ermahnt, sich völlig frei von Gedanken über den Tod oder den Ausgang des Kampfes zu machen. Solange noch irgendein solcher Gedanke vorhanden war, konnte er nicht eins mit seiner Waffe und der Situation werden und er schwebte in höchster Gefahr. Ein chinesisches Sprichwort lautet: “Wenn du entschlossen handelst, gehen selbst Götter dir aus dem Weg.“ Auf die Entschlossenheit kam es für den Samurai also besonders an. Diese Entwicklung zeigt, dass die kriegerische Tüchtigkeit der Samurai und die militärische Stärke Japans vom Zen-Geist profitiert hatten.
Die Kampfkunst, wie j...