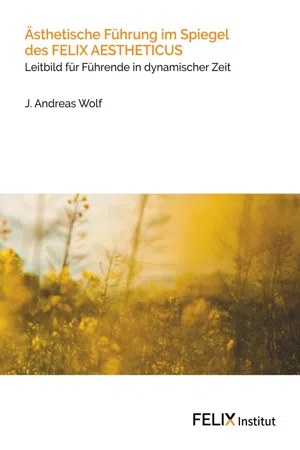![]()
ÄSTHETISCHE FÜHRUNG IM SPIEGEL
DES FELIX AESTHETICUS
Seit der Jahrhundertwende kennt das Feld der Organisations- und Führungswissenschaft den Begriff der „ästhetischen Führung“ im Sinne einer managerialen Feinsinnigkeit im Wahrnehmen, Bewerten und Einbringen organisationaler Tendenzen und Richtungsimpulse. In diesem Beitrag möchte ich die Essenz des gegenwärtigen Forschungsstandes der ästhetischen Führung zu dem Begriff des „felix aestheticus“ von Alexander Gottlieb Baumgarten als Begründer der neuzeitlichen Ästhetik im 18. Jahrhundert in Beziehung setzen. Aus der Spiegelung des heutigen Verständnisses von ästhetisch fundiertem Führungshandeln auf seine philosophischen Ursprünge verspreche ich mir Einblicke und Impulse für bewusst und sorgsam Führende in heutigen organisationalen Kontexten. Dieser Abgleich scheint auch insofern überfällig, als Baumgartens historisch ohnehin nur eingeschränkt rezipierte1 Ästhetikkonzeption im heutigen anglophon geprägten Diskurs ästhetischer Führung quasi nicht vorkommt.2
I. ZUM BEGRIFF DER „ÄSTHETISCHEN FÜHRUNG“
„Ästhetisch Führen“ meint ein Führungshandeln, das auf einer alle Sinne umfassenden Wahrnehmung aufbaut, um auf eine diesen äußeren und inneren Sinnen wohlgefällig scheinende Zukunft hin zu orientieren. Die Betonung liegt dabei auf der Einführung der körperlich-sinnlichen Dimension in wahrnehmendes und interagierendes Handeln. Dabei gehen sinnliche Empfindungen immer unmittelbar mit Bewertungsempfindungen und Bewertungen mit Körperreaktionen einher. Dieser Ausgangspunkt entspricht der noch jungen psychologischen Einsicht, dass Kommunikation nicht in Informationsübermittlung, sondern in der Resonanz von Körpern in Begegnung besteht (Melina et al. 2013; Storch & Tschacher 2014) sowie der soziologischen Perspektive, dass menschliche Begegnung eine gemeinsam konstituierte Resonanzerfahrung ist (Rosa 2016). Die ästhetische Dimension ist – trotz ihrer späten Entdeckung – für Führungsstudien deshalb so interessant, weil mit Chester Barnard schon 1938 einer der ersten Managementtheoretiker davon gesprochen hat, dass Management „eher ästhetisch als logisch“ sei und mit Begriffen wie „Gefühl, Urteil und Sinn“ angemessener zu theoretisieren wäre als mit Begriffen von Rationalität und Effektivität (Hansen et al. 2007: 546, Übersetzung AW).3 Da es aber anders kam und sich die Führungstheorie schnell einer primär ökonomischen Perspektive verschrieben hatte,4 verbindet sich mit dem Signalwort „ästhetisch“ auch die Hoffnung auf einen Weg zu einem „more integrated and holistic understanding of the nature of leadership in the 21st Century“ (Patrick 2008: 1). Gleichsinnig ist die Rede vom „philosophical point to develop an alternative to the mainstream paradigm [...] of [...] leadership“ (Hansen et al. 2007: 547) und sogar schon vom „emerging aesthetic paradigm of leadership“ (Ropo & Sauer 2008: 560).5
In der Konkretisierung ästhetischer Führung lassen sich unter Bezug auf zentrale Akteure des anglophonen Diskurses wie Adler, Bathurst, Dobson, Hansen, Katz-Buonincontro, Ladkin, Ropo, Sauer, Strati, Taylor u.a. drei wesentliche Handlungskategorien unterscheiden: Wahrnehmung, Orientierung und Interaktion.6
In der Führungspraxis ist es dann von entscheidender Bedeutung, zu welchem Ausmaß die entsprechende Fähigkeit ausgebildet und für die Einflussnahme auf soziale Einheiten nutzbar geworden ist. Wie an anderer Stelle argumentiert (Wolf 2015), geht es hierbei um die Künste der feinen Wahrnehmung, der klugen Orientierung und der taktvollen Interaktion. Diese drei Dimensionen sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
FEINE WAHRNEHMUNG
Eine an der komplexen Ganzheit der Phänomene orientierte sowie Intuition, Körperwissen, Emotion und Einfühlungsvermögen integrierende „feine Wahrnehmung“ dient als Grundlegung für alles weitere Führungshandeln und ruht auf den zwei Säulen Körperlichkeit und Emotionalität.
Die Körperlichkeit des Menschen als unhintergehbaren Faktor im Führungshandeln zu verstehen, meint zuerst eine überdurchschnittlich wache Aufmerksamkeit für die eigenen sinnlichleiblichen Reaktionen. Diese zunächst vorverbalen Erlebnisse gehen dabei den eindeutigeren Wissensformen voraus und beinhalten eine Mehrzahl möglicher Deutungen für die gemachte Erfahrung. In diesem Sinne arbeitet ein Führender z.B. dann „ästhetisch“, wenn er die Signale seines Körpers bewusst spürt und sie als Faktor in der Bewertung eines Handlungskontextes ernst nimmt. Solche sinnlichleiblichen Erlebnisse können sich ebenso auf das eigene Selbst wie auf das/die Gegenüber oder die Situation als solche beziehen. Es kann der eigene „Bauchschmerz“ bei der neuen Strategie sein, das „Unwohlsein“ beim Gedanken an eine zukünftige Begegnung, die „innere Abwehr“ gegen die mimisch und gestisch vermittelte Haltung des Gegenübers oder das innere „Aufatmen“ nach dem Aussprechen des lange Überfälligen. Oder es drückt sich in einer ängstlichen, erwartungsvollen oder aktivierten Spannung der Zuhörerschaft aus, einem „Knistern im Raum“, bei dem man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören könnte. In allen Fällen handelt es sich um eine „viszerale Erfahrung“ (Taylor 2013a: 74), also eine Reaktion der Körperorgane. Es geht für den Führenden nun darum, auf diese somatischen Ausdrücke acht zu haben und diesbezüglich sich selbst und anderen gegenüber sprachfähig zu werden, also die eigene und der anderen „ästhetische Stummheit“ und damit die weitverbreitete organisationale „An-Ästhesie“ (Taylor 2002) zu überwinden. Emotionalität als Ressource für das Führungshandeln zu begreifen ist keine neue, aber nichtsdestotrotz eine in der Praxis allzu häufig missachtete oder geradezu verrufene Wahrnehmungsquelle. Die eigenen und der anderen Emotionen in ihren leicht als unentwirrbar, unbeherrschbar und unüberwindbar erscheinenden Wi...