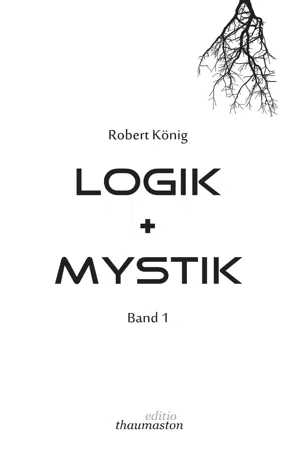![]()
Die Interimsliebenden. Nicht nur die Einstürzenden Neubauten sprechen von demjenigen, das sie in angemessener Weise Interimsliebe nennen. In der Interimsliebe gibt es keine harmlosen Worte, nicht ein einziges nämlich, auch das Wortlose nicht, und es wird zugleich Meta, Meta, Meta, Meta für Meta durch den Dreck dieser harmvoll bedeutenden Metaphern gestapft. Es gibt sie gestern nicht mehr und morgen noch nicht, die Interime, die alle freilich selber ausgetreten, eingetreten, harmvoll, harmlos zugleich, denn bloß Worte bleiben. Was für eine Philosophie man wähle, hänge deshalb mit Fichte davon ab, was für ein Mensch man ist – eine in ihrem Kern totale Interimsliebe ist in diesem Satz romantisiert, solange er nicht behauptet, sich immer schon zu verstehen. Immerhin stellt ihm das Philosophische mit Recht keinen toten Hausrat, keine harmlosen Worte dar, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es beliebte, so sehr es ein Philosophisches in philosophischem Sinne auch nicht mehr und noch nicht geben mag. Es mag viele Auslegungen geben, die man Fichtes Ausspruch anheimstellen könnte, etwa derjenigen nicht hoch genug zu schätzenden, dass Philosophie niemals Ideologie sei (eine Ideologie lässt sich nämlich annehmen und ablegen), dass sie keine mit sonstigem vergleichbare Alltagstätigkeit, kein toter Hausrat eben sei, so als würde man sie etwa zum Beruf haben, sie als Zeitvertreib ausleben, damit Privatleidenschaften, Interessen, Geschmäcker, Meinungen äußern und befriedigen, oder hunderte weiterer dieser Schubladen öffnen, in denen dann eben Hausrat verstaut wird. Neben all den Aufgaben oder auch teilweise mit ihnen vermischt, möchte man hierauf vielleicht noch Philosoph sein, so man dann gerne laut und mit Stolz verkündet, eigentlich lasse sich ja ganz leicht und wie zur Zerstreuung über alles philosophieren, ohne zu wissen, wie man das eigentlich meine. Man weiß es deshalb nicht, weil man sich in Wahrheit eine Philosophie gar nicht vorstellen, geschweige denn eine durchführen, ja ertragen kann. Denn so viel Seligkeit mit dem Philosophischen hergehen mag, so viel Leid und Schmerz bringt es auch, wovon etwa Platon eine interimsliebend harmvolle Metapher in seinem Höhlengleichnis gibt.
Dass Philosophie ebenso wenig Sache der Willkür in demjenigen Sinne sei, als könnte man jetzt philosophieren, später den Rasen mähen und hernach zu Abend essen, erkennt auch nur der Interimsliebende. Das hart verdiente Philosophieprofessorenbrot, von dem Schopenhauer so köstlich und wohlgeschmacklich polemisiert, enthält vom ersten bis zum letzten Bissen den bitteren Ernst der eigentlich seligen Interimsliebe – und wie es im Evangelium heißt, missverstehen wir solange, solange wir meinen, es sei bloß vom Brot die Rede. Denn niemand kann sich eigentlich das Philosophische zum Beruf machen, am allerwenigsten ein Lehrer, wovon kaum ein echter Philosoph je müde wurde, zu berichten. Mit dem kleinen Prinzen ließe sich nämlich noch vermerken, philosophieren kann man nur im und mit dem Interim gut, das Wesentliche ist für die Lehre unsichtbar. Wer von ihr nicht angetan ist, philosophiert nicht, er kann es lernen, imitieren, üben wollen, wie er möchte. Sophia lässt sich nicht mit einem jeden dahergelaufenen Don Giovanni ein, er mag irgendwelche bezirzenden Sätze auswendig lernen und wiedergeben können, wie er wolle. Sie liebt nicht im Hier oder Dort, sie liebt allein im Interim. Sie liebt kalyptisch, könnte man sagen. Wer für sie nicht seine Seele riskiert, ist ihrer nicht wert und wen sie berührt, der wird in der Interimsliebe seine Seele frei hingeben, denn sie wird gar nicht mehr die seine sein, sondern bereits allen gehören, die Sophia bereits geliebt hat und noch lieben wird.
Philosophie, die mit Fichte also vom Menschen abhängt, so zeigt sie selbst in ihrer Tätigkeit obendrein, heißt weder, manche würden als Philosoph geboren, noch, man könne sie sich gleichsam wie ein Handwerk beibringen oder auch nur fordern, indem man bestimmte Techniken beherrschen, Brotgelehrter im Sinne Schillers zu sein lernt. Was bleibt aber, ließe sich fragen? Die scheinbar so unbedeutende Frage der Antike von der Lehrbarkeit der Tugend, eigentlich so gar kein harmloses Wort, fragt schon nach diesem Problem. Wenn sie weder von außen erlernbar, noch schlichtweg gekonnt werden kann, was dann? Was bleibt? Was ist es, zu philosophieren? Wo ist das Interim?
Meister Eckhart hat in jener Predigt von der seligen Armut, für die er vielleicht mehr, als für alles andere den Titel „Meister“ verdient, die in unseren bisherigen Zeilen nur negativ und sich von anderem abgrenzend bestimmte Interimsliebe in so manche Worte gegossen. Sein Guss gipfelt in der goldgeschmiedeten Sentenz: Wer diese Rede nicht versteht, bekümmere sein Herz nicht damit. Denn solange der Mensch dieser Wahrheit, von der auch wir hier reden, nicht gleiche, solange würde er diese Rede nicht verstehen. Es ist jenes Gleichen, das Fichte im Auge hat, das Abhängen des Philosophischen vom Menschen, insofern dieser sich erst zum homo philosophicus bestimmt, auf diese Weise der Wahrheit gleichend und gleichwerdend, nicht sie etwa bloß darstellend, lehrend oder beschreibend vermitteln könnend. Das Wort „bestimmt“ fiel übrigens im letzten Satz nicht zufällig, sondern nicht zuletzt pathetisch mit dem schicksalsträchtigen Fatum so mancher Stoiker aufgeblasen, allen voran des Stoikers Nietzsche. Aber dieses heilige Wort der deutschen Sprache: bestimmt, es wird ohnehin noch zu bedenken sein. Mit Stimme beseelt und wie Saiten eines Musikinstruments stimmig gemacht, stimmend auch wie ein Eckhartgleichwerden, das dann stimmt, heißt es auch, um solche ganz und gar nicht harmlosen Worte bestimmend zu verwörtlichen.
Jetzt zu behaupten, es müsse so gedacht werden, ja, man müsse überhaupt denken, wäre natürlich bereits wieder Hausratsphilosophie, als führte sich in diesen Zeilen, Leser und Hörer, eine ebensolche Tätigkeit aus, wie es Verdauung, Atmung, Kognition oder Bewusstsein wären, was in dem berühmten Wort des Aristoteles: pos, d.h.: in gewisser Weise natürlich auch zutrifft. Es fällt zu, wie überhaupt der und jeder Gedanke zunächst nichts weiter als ein solches Pos zu sein scheint, ein Irgendwie, ein Zufälliges, durch das das Denken selbst die Irgendwieheit zu sein imstande ist – und ihr misslungener Schein obendrein. Indem es so das Denken ist, das sich in seiner Bestimmung zufällt, pos, irgendwie, sich trifft als sich und sich selber tut, denn zu denken ist eine Tätigkeit, kein Habitus – es sei denn, es tut sich als einen solchen – denkt sich erst so ein Irgendwie, irgendwie nämlich wegen der Freiheit seiner selbst, keine seiner Bestimmungen bloß zu sein, sondern vielmehr dem Akt ihres Bestimmens selbst als Denken innezuwohnen. Denken, das ist der Fichteabhang, mit sich und ohne sich zugleich, das tut es hier gerade, auch in dir. Jetzt.
Deshalb wird beim Denken dann gerne mit Begriffen wie unendlich, selbst, allgemein, bestimmt, ichlich, setzend und so fort agiert, weil es selber stets nichts als diese Handlung, dieses Agieren seines eignen freien Irgendwie zu sein scheint und in diesem Schein auch ist. All das bleibt freilich bloß eine Beschreibung, ein sich anschauendes Denken, intellektuelle Anschauung manchmal genannt, hin und wieder als ein Wunder bezeichnet, hin und wieder als rein transzendente Illusion – beides freilich eckhartgleich, mit sich und ohne sich zugleich.
Denken jedenfalls, zumal philosophisches, scheint eine ganz freie Handlung zu sein, wenn es sich als solche nämlich aus der Freiheit, die es sich darin erst selber gibt, bestimme, wenn es sich in Eckharts Worten: gleich wird in seiner Wahrheit und dadurch erst in seine Wahrheit kommt, sie sei als Übereinstimmung von Begriff und Realität, als Übereinstimmung des Begriffs mit sich selbst, als absolute Selbstbestimmung gefasst oder in sonstigen Pleonasmen. Seine Freiheit ist dem Denken ebenso wenig ein Zustand, wie es mit seiner eben noch getanen zufälligen Irgendwieheit schlicht identifizierbar wäre, sie alle sind nämlich seine ganz eignen freien Handlungen, das Wählen eben in Fichtes Satz vom Hausrat. Erst sich frei zu handeln, bestimmt das Denken als frei. Es erhebt sich frei zu sich, indem es sich frei zu sich erhebt. Es findet sich nicht einfach als frei und handelnd, sondern es erdenkt sich eben denkend hierzu – und so von allem übrigen.
Eine bloße Wieheit, Wiebeschaffenheit, Qualitas des Denkens, wie Cicero die griechische Poiotes übersetzt haben soll, bliebe dabei zu unangemessen. Von ihm irgendwelche Beschreibungen von Eigenschaften oder Richtlinien angeben zu wollen, gar müßig. Auch ist das Denken in seinem Interim nicht bloß eine Qualität, so als könnte man von ihm als einem etwas, gar einem Ding oder von ablesbaren Bestimmungen sprechen. Dass es sich als solche aber ebenso qualifizieren kann und qualifiziert, wie sich als Denken zu denken, als Handlung auszuhandeln, sich selbst zum Bestimmten zu bestimmen und so fort, lässt es stets in jenem freien Interim, das es selber gar nicht denken kann, aufgehalten bleiben. Und dass es dies Interim nicht denken kann, ist nichts als das Denken des Interims selbst (dies hier ein Genitivus subjectivus und objectivus). Irgendwie zumindest. Pos, lesen wir immer wieder bei Aristoteles.
Das Denken wird als dieses Interim selbst erst denkend, indem es sich frei aus sich zu sich erhebt, es gibt hier keine harmlosen Worte. So sehr man daher auch versucht sein könnte, ihm ein Gepräge, ein Gedeih oder Gelingen oder gar diese oder jene Reflexionsbestimmung zuzuweisen, es bleibt als Denken diejenige Handlung, die so handelt. Sein Interim ist, dass das Denken nirgendwoher abgeleitet werden kann, als aus dem, zu dem es sich selber erst denkend macht. Es handelt aus einem und als absolutes Non sequitur, selbst dort, wo es sich als zufällig und ganz subjektiv bestimmt. Das gerade ist sein Non Sequitur, seine sich zur eignen Freiheit befreiende Selbstbefreiung, die sich erst in dieser Wahrheit selber eckhartgleicht und wählt. Das Denken kann sich derart den actus purus der Freiheit nennen. Aber es bestimmt es sich darin gerade so, dass es Interim bleibt, sich durch sein Bestimmen bestimmend, egal, wie es über sich auch sonst unvollendet umherreflektieren mag. Immer schon ist es dabei zugleich in sich hineingeraten, auch wenn es namenlos noch nicht als es selbst sich denkt und erst noch auf sich angelegt gewesen sein wird, indem es sich als sein eignes Interim ausübt. Auch der große Parmenides nimmt das dort in den Blick, wo er in seiner Sprache von der Selbigkeit des Denkens und Seins spricht. So eine interimsliebende Selbigkeit bedeutet nämlich keineswegs eine nachträgliche Zusammenfügung der bereits auseinandergefallenen Seiten, die man, man weiß nicht woher und wieso, das Denken und das Sein nennen könnte. Vielmehr ist diese Selbigkeit nichts als: zu denken und zu sein, oder: das Interim. Das to auto, die freie Selbsterhebung zum Selbst, das Interim, ist es, zu denken und zu sein. Auf dem to auto liegt die Emphase des Satzes. Deshalb ist es auch das to auto, das im sich sich selbst bestimmenden Sein, nämlich dem Denken, gerade als dieses Selbige verloren geht und frei handelndes Interim wird, das sich in jenem Satz selbst denkend zu sich bestimmt. Denn immerhin wird hier in dieser dreifachen Bestimmung zwischen to auto, noein und einai selbst gesagt, sie wäre (estin) – sie wird aus sich selbst mit sich selbst zu sich befreit. Oder sie ist im Satz des Parmenides eben selbst: gedacht, worin ja die Identität des Denkens und Seins sich auf Basis seiner freien Interimshandlung erst als der Satz des Parmenides ausspricht, bestimmt und derart: ist. Zwar bleibt dieser Parmenides vielleicht, soweit wir von ihm wissen zumindest, bei diesem Problem und beim sich darin selbst problematisierenden Interim stehen, ohne es zum Interim zu befreien, doch hat er den Horizont des Denkens als einer sich absolut zu sich selbst befreienden, unhintergehbaren Handlung eines durch diese Handlung erst offenbarten Interims aufgemacht und ins Licht gestellt. Irgendwie zumindest, pos.
Die alte Rede vom aristotelischen Irgend scheint sich also zufällig denkend mitzunehmen. Das Irgend begegnet freilich nicht erst bei der heiteren philosophischen Ursprungsfrage: Was ist? – denn egal, womit, wie, worin, woher und freilich: was angefangen wird, dass das Angefangensein selbst interimisch mit in sein Anfangen gerissen wird – und es muss nicht als Gedanke von einem Gedanken geschehen – dies Hineinreißen, diese Ruptur des Anfangens ist das Irgend des Interim. Das Interim in seiner sich selbst als Denken handelnden Ruptur bedeutet, dass die Freiheit, von der hier die Rede ist, nur dort sich zu sich befreit, wo sie denkt – zu denken aber umgekehrt erst hierin anhebt, sich zu bestimmen, nicht etwa sich immer schon kennt (das ist seine interimische Ruptur gegen sich). Deshalb ist auch, mit Parmenides formuliert, nicht einfach von Anfang an zu sagen, was denn das Denken sei.
Hegels Wissenschaft der Logik stellt das vielleicht aus einer gewissen Perspektive bestimmter irgendwie heraus, als die des Parmenides, immerhin ist sie unendlich ihr eigenes unablässiges Anfangen, das in seinen eignen Anfang, sein Interim, hineingerät. Egal, wie weit sie von diesem An-fange weggehen mag, ein ganz wunderliches An dieses Sichfangens tut sie sich da dem Denken jedes Mal wieder an. Der Inhalt, wenn es im Interim handelt, ist nichts als das Anfangen, das sich entwischende Interim selbst, gestern nicht mehr und morgen noch nicht, in dauernd einstürzenden Meta-phern gesagt. Sie sind aber freilich als das Denken ein produktives Verschwinden, eines, das übrig lässt, was erst durch sein Verschwinden entsteht. Dass sich auch hier noch nicht gesagt hat, was zu denken eigentlich sei und dennoch – man könnte sagen: zirkulär – stets mit diesem Begriff operiert wird, geschieht durch nichts als die eben hierin entwischende interimische Struktur des Denkens selbst. Es entwickelt sich frei aus sich zu sich im wahrsten Sinne des Wortes: wickelt sich im Tun aus.
Nur in einem Sinne spielt es daher diesen Metaphern eben keine Rolle, wie sie sich bewörtern, in einem anderen sind sie nichts als das, was sie tun, ohne dass ihre Tätigkeit sich je durch etwas, das sie tun, einfach fassen ließe. Gleich (in Meister Eckharts Gebrauch des Wortes), gleich also, welches W man ihnen denkend an-hängen möge: warum, woher, wohin, wozu, wer, was … ihr Interim ist selbst der Abhang (nun in Fichtes Wortgebrauch) an dem all ihr Anfangen gebrochen ist, ehe es anfängt, anfängt aber nur als dieser Bruch, der Einriss des W, weshalb auch wir Irgend-wie sagen mussten, um zum interimisch niemalswie irgend zu gelangen. Was denkt, wird diese Frage seines eignen Interims, des von manchen gejagten Zwischen von Subjekt und Objekt etwa, das sie nicht bloß nachträglich als Subjektobjekt zusammenfügt, denn so etwas ist selbst schon ein Objekt. Obendrein denkt das Denken selbst auch nicht nur als Zusammenfügen von Zerrissenen, denn ein solches versubjektiviert sich neben seiner einseitigen Objektivation auch nur in die Unbestimmtheit eines Subjekts. Es ist zugleich das Reißen des Risses zu sich hin selbst. Das Zwischen ist keine Summe aus Teilen, sondern wie in einem phantasierenden Infinitiv: zu zwischen. Das Interim ist freie Handlung – und auch als solche natürlich bereits aus einem darin verschwundenen Interim heraus, aber so, dass es sich zugleich darin ganz immanent wird, sich selber angehört, sich in sich ohne äußeren Referenzpunkt einschließt. Sein handelndes Zwischen, das sich nicht einmal endgültig als Handlung zu fassen imstande ist, zeigt sich in diesen Sprachkonstruktionen freilich einmal mehr als absolute freie Bestimmbarkeit, denn alles Denken, das sich sprechend erdenkt, wird folgerichtig schlichtes Sprachkonstrukt. Von so etwas dann großtätig zu sagen, es wäre willkürlich, wäre in sprachkulturelle Grenzen eingeschlossen und deshalb höchstens relativ, wäre bloß historisch gewachsen oder sozial bedingt, trifft zu, nur verfehlt es die Freiheit des Denkens zugunsten derjenigen des sich bereits sprachlich ersprechenden Denkens. Dasselbe gilt übrigens, wo das Denken sich zu meinem oder deinem Denken erklärt.
Erst einmal individualisiert, ist es keine große Leistung, es als individuell zu bestimmen. All dies ist selbst Handlung des Denkens und das Interim in ein Extrem zu zwängen, ist nicht völliges Denken. Schon hier dürfte sich veranschaulichen, dass zu denken kein aristotelisches Organon, kein Instrument allein ausmacht. Denken als Werkzeug für etwas, als Zugreifen auf Vorhandenes, zu denken, wie bei Hegel und anderen mit Recht in die Kritik seiner Verkürztheit gezogen, präformiert es interimisch wiederum sich selber und alles Gedachte in interimsloser Weise, die freilich selbst nur ein besonderes Interim darstellt. Denken etwa als Problemlösen, als Archivstruktur, als Datenwiedergeben und ähnliches zu denken, präformiert ihm alles Gedachte als Problem, Archivierung, Daten. So von allem übrigen.
Das Denken, oft gegenüber anderen Tätigkeiten für belanglosen Spaß verrückter Philosophen gehalten, ist vielmehr der allertödlichste Ernst und das allerheiligste Tun, denn es bestimmt in seiner Selbstbestimmung zugleich, was, wie, warum und so weiter überhaupt gedacht werden kann. Hier gibt es keine harmlosen Worte. – Was hier also, wie alles Denken, das sich versprachlicht, als Sprachkonstrukt erscheint, tut dies nur solange, solange das Anfangen, das Irgend im Ist obiger Frage als sprachlos anfängt, wie es auch nie anders kann. Hierher stammt auch z.B. jede metaphysikkritische Linguistik des Irgend, die im Traum sprachlicher Symbolik ihr eigenes Anfangen im hierdurch frei bestimmten Interim verkennt. Alles Sprechen bleibt selbst auf diese Art mehr Metaphysik als jede von ihm kritisierte Metaphysik, worin auch kein Problem bestände, löge man sich nicht ulyssenhaft vor, man wäre ein Niemand, man gliche nicht der Wahrheit, denn es gäbe ja gar keine Wahrheit, man wäre kein homo philosophicus, sondern ein bloß märchenerzählender Homo narrans, der selbst nicht ist, was und wie er spricht.
Was für ein Mensch man ist, hängt mithin in einer leichten Paraphrase Fichtes davon ab, wie man das Interim denkt. Hierin wird als Bestimmung etwa auch die Sprachlichkeit wohl anerkannt. Denn wodurch sonst als durch Sprache, durch ihr eigenes Denken und im selben Atemzug ihr eigenes interimisches Sichersprechen wird Sprache als sich eckhartgleich denn geleugnet? Oder kurz: Alles kann gesprochen werden, doch bis nicht die entscheidende Frage: Was ist Sprechen? gesprochen wird, bleibt alles zugleich fichtescher Hausrat, schillersches Brotgelehrtentum, heideggerische Betriebsforscherei. Da hilft es nicht mehr, diese absolute Selbstbeziehung des Denkens, das sich eben als und in seiner eignen Handlung erst erdenkt – auch dort freilich, wo es sich als Denken denkt – als Illusion, als Fehler, ja Denkfehler, als missratenes Ich, als Selbstwiderspruch des Bewusstseins, als evolutionären Faux pas oder ähnliches zu fassen, denn all diese seine eignen Ermangelungen machen das Denken erst zum Interim. Das eigentlich Absolute, das sogar von sich selber als frei durch seine eigne hierin erst sich befreiende Freiheit Losgelöste, umfasst eben, indem es absolut ist, seine eigne Negation. Wenn die Bestimmung mithin: Omnis determinatio est negatio posaunt, dann wird meist selbst schon Negiertes, nämlich Bestimmtes gemeint, so als wäre alles Denken damit getan, ein Bestimmtes gegen ein anderes zu unterscheiden. Aber es fragt sich dem Denken erst: das hierin nicht in seinen eignen Unterschied fallende Interim, aus dem sich diese Unterscheidung bestimmt: wie bestimmt es sich selber? Durch Negation möchte man meinen – sodass schließlich ersichtlich wird, nicht jedes Bestimmte oder jede Bestimmung, sondern das Bestimmen selbst, die Bestimmtheit des Bestimmten ist Negation. Hierdurch erdenkt es sich, dass alles Denken bestimmt sei, nämlich die sich negativ bestimmende Bestimmtheit, die sich darin, dass sie zugleich schon bestimmt und selbstbestimmt ist, nur negativ auf sich selbst beziehen kann als dasjenige, das allem Bestimmten, auch dem der Negation, vorhergeht. Das Denken ist erst dasjenige, das sich mit sich selber so eckhartausgleicht und sich selbst sein eignes Interim wird, dass es es selbst wird, indem es nicht es selbst ist – dass es sich negiert und seiner selbst ermangelt: durch sich selbst. Derart gerät das Omnis determinatio übrigens zu demjenigen, was man Synthesis oder spekulativen Satz nennt. Dass das Absolute also absolut ist, indem es nicht nur absolut affirmiert, absolut ist oder bejaht, sondern indem ihm als Schluss-, Grenz- und Anfangsstein auch seine eigene Verneinung angehört, macht das Interim aus – denn wie könnte es das Absolute sein, wenn seine eigne Negation nicht zu ihm gehörte (welch eine selbstexplosive Frage)? Dass überhaupt gefragt werden kann, macht nämlich dabei selbst schon die bestimmte Negation jeder Frage aus.
Deshalb fragen wir also aus sich hierin zu sich befreiender Freiheit: Wie konnten wir das alles nun überhaupt sagen, was wir da eben sagten? Wie erfragen? Was ist es, das hier vor sich geht und das allein schon durch diese seine eigne Frage sich selber angehört? Wie konnte sich all das selbst: an-fangen, seinen Fang, seine erste Ception in der hierauf keimenden Percep...