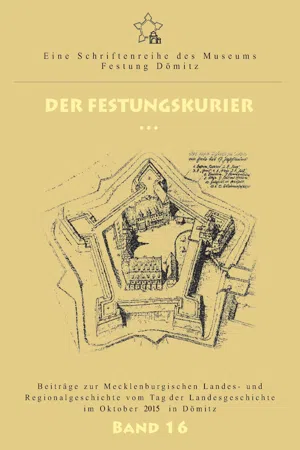![]()
Festung Rostock: Altes Bild – Neue Betrachtung
VON TOMMY JARK
Der jetzige Stand der Forschung über die Rostocker Befestigungsanlagen entspricht in etwa noch den Ergebnissen der 1930er Jahre. Das heißt, dass das aktuelle Bild über die Fortifikationen verhältnismäßig alt ist. Es gibt mittlerweile neue Aspekte und Methoden, um einzelne Fragen erneut zu verfolgen. Dabei spielt auch die Wortwahl eine Rolle. Meistens ist von den Rostocker Stadtbefestigungen die Rede. Damit werden die Wälle der Stadt untergeordnet. Eine Festung Rostock hebt die Anlage auf gleicher Ebene mit der Stadt; wie eine Symbiose sind hier beide Elemente bedeutend: Der Wall schützt die städtischen Gebäude, diese beherbergen die Menschen, die den Wall erhalten und bemannen. Für diese Titulatur bedarf es jedoch einer angemessenen Dimension der Fortifikationen. Es besteht zum Beispiel kein Zweifel daran, Neuf-Brisach (Neu-Breisach) mit dem Begriff Festung zu würdigen.26 Die Frage, die mit den neueren Methoden der Forschung als auch der Betitelung einhergeht, ist: Wie muss die Fortifikation um Rostocks Innenstadt bewertet werden; war sie nur eine Wallanlage oder zeitweise doch so stark, dass die Stadt als komplette Festung anzusehen ist?
Für die Beantwortung der Frage werden vor allem drei Historiker herangezogen. Zum einen Lorenz27, denn alles, was wir heute von den Wallanlagen annehmen zu wissen, beruht größtenteils auf seinen Zusammenfassungen. Es gibt zahlreiche einzelne Schriften zu unterschiedlichsten Aspekten der Rostocker Militärgeschichte. Lorenz ist es gelungen, die wichtigsten davon in seinem Werk zu vereinen. Dieses fundamentale Werk muss also als Basis dienen und zugleich selbst kritisch hinterfragt werden.
Bachmann28 wurde ebenfalls in Lorenz aufgegriffen, hat aber zusätzlich einen Plan der Belagerung 1631 aus dem Schweriner Landeshauptarchiv abgezeichnet, welcher relativ unbekannt ist. Dieser Plan bietet jedoch wichtige Hinweise auf Position und Ausrichtung der Fortifikationen.
In neuerer Zeit ist eine Dissertation von Weber29 erschienen, die sich mit Johan van Valckenburgh als hanseatischem Ingenieur beschäftigt.30 Genau dieser Aspekt ist bei Lorenz weitestgehend unbeachtet geblieben, obgleich Valcken-burghs Rolle für die Stadtbefestigungen nicht unbedeutend ist. Zudem erlauben die zahlreichen, bei Weber abgedruckten Pläne einen Vergleich mit anderen Werken. Ähnlichkeiten in Geometrie, Finanzierung und Aufbau der Fortifikati-onen können so zu neuen Ergebnissen führen.
Die neueren digitalen Möglichkeiten erlauben außerdem einen Vergleich von Plänen, die Lorenz noch nicht einsehen konnte. So liegen uns – neben der Ansicht Hollars – noch mindestens drei Pläne aus dem 17. Jahrhundert vor und drei weitere undatierte. Mit diesen kann recht präzise verglichen werden, was während der wichtigsten Umbauphasen geschaffen wurde. Die Digitalisate können noch dazu auf aktuelle Karten überlagert und angepasst werden, sodass die fast metergenaue Position von Werken oder Besonderheiten markiert wird. Darauf soll hier aber nicht näher eingegangen werden.
Rondellierung
Die genauen Daten zum Baubeginn der ersten neuzeitlichen Umwallung sind nicht überliefert. Es finden sich lediglich Ersterwähnungen mit ihren bekannten Problemen einer zeitlich präzisen Zuordnung. Damit bleiben auch die geistigen Ursprünge der Wälle verborgen, die es zu rekonstruieren gilt.
Die uns heute vorliegende Umwallung ist in ihrer ersten Ausbauphase zum Ende des 16. Jahrhunderts komplett. Sie bestand aus einem der Mauer vorgelagerten Wall mit vier Rondellen. Von Ost nach West:
Das Mühlentorrondell wurde erstmals 1567 erwähnt. Es schützte das Mühlentor und den Mühlendamm, es konnte einen großen Abschnitt des Dammes bestreichen und auch in Richtung Steintor feuern. Damit arbeitete es eng mit dem Steintorrondell zusammen. Von diesem war es ungefähr 70 rheinische Ruthen entfernt, insofern Bachmanns Plan präzise ist.31
Das Steintorrondell wird um 1570 erwähnt. Dies ist erst einmal irreführend, da zu dem Zeitpunkt eigentlich die herzogliche Konterfestung auf diesem Gelände stand. Der darauf befindliche Zwinger wurde zwischen 1526 und 1532 erbaut.32 Unabhängig von der genauen Beschaffenheit des Werkes konnte es das Vorfeld des Steintores in einem 180°-Winkel bestreichen und damit sowohl in Richtung Mühlentorrondell als auch in Richtung Heumagazinbastion decken. Er diente als „Torburg“, wie wir es aus Neubrandenburg kennen.33 Lorenz hat bei der Beschreibung des Turmes einen Fehler aus früheren Überlieferungen übernommen. In seinen Plänen zum Zwinger sind im ersten Stockwerk links der Geschützscharten kleinere Schlitze in die Mauer eingelassen, die er als Zieleinrichtungen interpretiert. Dabei stützt er sich vermutlich auf eine Chronik aus dem Siebenjährigen Krieg, die Krause überliefert hat.34 Es handelt sich vielmehr um Gewehrscharten, die jedoch etwas unkonventionell eingerichtet wurden. Sie befanden sich auf Körperhöhe und ermöglichten eine Nahverteidigung des Turmes.
Eine Ungereimtheit sieht Lorenz in der Anordnung der oberen Scharten. Denn diese für Geschütz ausgelegten Pforten wurden scheinbar von einem äußeren Wehrgang verdeckt. Dieser Widerspruch löst sich jedoch, wenn man bedenkt, dass die inneren Geschützscharten für Fernkampf, die Gewehrscharten mit Maschikuli für den Nahkampf ausgelegt waren. Eine merkwürdige Lösung für die Rauchabzüge, die teilweise in den oberen Raum hinein führten, bringt Lorenz mit einer vermuteten Umbauphase um 1575 in Verbindung.35
Die Heumagazinbastion (auch „Altes Rondell“) wird 1570 zum ersten Mal erwähnt. Es handelt sich auch hier um ein klassisches Erdrondell. Es konnte sowohl nach Süden als auch zu beiden Seiten hin decken. Damit bestrich es einen großen Raum der südlichen Wallanlage. Die Position ist interessant gestaltet: Die Bastei liegt fast genau mittig zwischen Kröpeliner und Steintor mit einer Entfernung von rund 110 Ruthen. Damit konnte sie jeweils nur die Hälfte der Wallstrecke effektiv bestreichen.36
Die Fischerbastion hat wohl erst im 17. Jahrhundert ihr heutiges Gesicht bekommen. Davor war sie (wenn man Hollars Ansicht vertraut) in Form eines einfachen Bollwerks ausgeführt. Sie bestrich die Warnow und konnte bis vor das Kröpeliner Tor schießen.37
Nimmt man diese Werke zusammen, erschließt sich folgendes Bild: Die östliche Mauer wurde mit keinem Werk verstärkt und galt vermutlich als sicher. Abgesehen davon wäre es äußerst schwierig gewesen, jenes Gelände ordentlich zu befestigen, da zum einen der weiche Boden, zum anderen die erhöhte Lage der Stadt eine effiziente Verteidigung erschwerten. Ein toter Winkel bildete sich vor dem Kröpeliner Tor. Das direkte Vorfeld hatte kein flankierendes Feuer zur Verfügung, der hohe Torturm bot zudem ein perfektes Ziel. Damit gab es dort eine Schwachstelle in der Verteidigungsanlage. Wenn man die späte und fast gleichzeitige Überlieferung der einzelnen Bollwerke betrachtet, ist vorstellbar, dass die Fortifikationsarbeiten vor 1565 begannen und mit dem Streit mit den Herzögen endeten. Um den besagten unbestrichenen Punkt zu decken, wäre ein weiteres Rondell vor oder knapp neben dem Kröpeliner Tor nötig gewesen. Eventuell hat dazu schlicht die Zeit oder das Geld gefehlt. Mit diesen fünf Werken hätte Rostock eine zeitgemäße Befestigung aufgewiesen, die wichtigsten Zugangswege angemessen zu schützen.
Herzogliche Konterfestung
Im Jahre 1566 wurde Rostock von den mecklenburgischen Herzögen eingenommen. Als Repressionsmaßnahme wurde eine Konterfestung erbaut, die sich gegen die Stadt richtete. Wie sie genau aussah, ist bisher nicht eindeutig überliefert worden. Lorenz hat sich an eine Rekonstruktion gewagt und dazu einige Hinweise aus Chroniken und anderen Quellen herangezogen.
Abbildung 1
Ansicht Rostocks von Wenzel Hollar, vor 1625
Er verortet die Konterfestung unmittelbar südöstlich vom Steintor, sodass der Zwinger als nordwestliches Rondell diente. Lorenz distanziert sich selbst ein wenig von diesem Versuch und das zu Recht. Es treten einige Probleme auf, die hier kurz aufgezählt werden sollen:
In einem Brief erwähnt der Herzog die Festung und vergleicht sie mit Ziegenhain. Dies war eine neue, viereckige Festung mit Rondellen an den Ecken. Die genaue Beziehung (Neuheit, Stärke oder ähnliches Aussehen) steht nicht fest, sodass sich dies erst aus einem Zusammenhang erschließen kann.38
Lorenz sagt selbst, dass der Zwinger keine Schießscharten stadtwärts hatte. Zugleich hatte er eine Bauzeichnung kurz vor dem Abriss des Turmes zur Verfügung, aus der er keinerlei entsprechende Umbauphasen erkennen konnte. Somit wäre der Zwinger als nördliches Werk völlig unangebracht gewesen: Nicht nur, dass die Tür den Rostockern fast offen stand, die Scharten hätten die Festung selbst bedroht.39
Jedes Stück der Befestigung wurde abgerissen mit Ausnahme des Zwingers. Dieser hatte also eine strategische Bedeutung, die mehr galt als seine Masse an Steinen. Dies spricht für eine effektive Einbindung in die Konterfestung.
Lorenz stützt sich bei der Ausrichtung des Zwingers auf eine Lithografie, bei der der Turm von Süden betrachtet wird und eine kleine ausgebrochene Scharte andeutet. Dies setzt er mit einem früher beschriebenen Gang gleich, obwohl dies nirgendwo bestätigt werden kann. Damit ist die Verbindung des Turmes mit einem Wall nach Süden nur vermutet. Genauso gut könnte die Pforte 1761 herausgebrochen worden sein, als preußische Soldaten die Geschütze mitnahmen.40
Es wird in einer Chronik erwähnt, dass die Vermessungsarbeiten sowohl vom Steintor als auch vom Zwinger aus begonnen wurden. Das Tor wäre ein ungewöhnlicher Punkt, wenn die Festung weiter südlich stand. Eine Überlegung zur Verschiebung der Rekonstruktion nach Norden wäre angebracht.41
Die Himmelsleiter, also der Wall östlich des Zwingers, stellt Lorenz in Beziehung zur Fe...