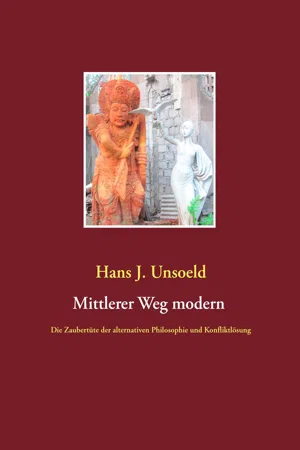![]()
Janus modern
Schwankender Boden
Die Welt scheint uns immer komplizierter, immer komplexer zu werden. Gern würden wir unser Bild von ihr vereinfachen, sowohl in unserem eigenen Leben wie auch bei der immer schwieriger erscheinenden wissenschaftlichen Erfassung der Welt. Hat aber nicht in unserem Leben wie auch in der Natur vieles “seine zwei Seiten” (1), ist also nicht einfach? Ist das nur eine Redensart, über welche man hinweggehen kann, ohne nachzufragen, um was es dabei geht,- nur ein antiquiertes Thema vergangener Philosophie, unserer fragwürdigen Suche nach möglichst leicht fassbarer Weisheit oder einer relativ einfachen Basis, einer „Weltformel“? Oder sollte man dem wieder mit größerem Nachdruck auf den Grund gehen? Wollen wir etwa mögliche Konsequenzen nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie uns zu schwerwiegend vorkommen?
Dass menschliche Wahrnehmungen und Folgerungen aus Bereichen jenseits der Grenzen des uns bislang Zugänglichen nicht eindeutig und eventuell sogar in uns scheinbar wohlbekannten Bereichen ebenfalls nicht allgemeingültig sein mögen, kann Paradigmenwechsel (2) beinhalten, die Autorität bedrohen und Fundamentalismus von vorne herein infrage stellen können. Umgekehrt ist es aber auch kein Geheimnis, dass die Mehrzahl der Menschen weder Autorität noch Fundamentalismus sonderlich liebt. Ob ihnen eine Antwort weiter helfen kann?
Dabei geht es nicht nur um die Richtigkeit und Wichtigkeit der Behauptung, dass vieles und zwar mehr, als wir bisher gedacht haben, besagte zwei Seiten habe, sondern auch um die Art und Weise, wie diese gestellt und bekannt gemacht werden kann. Es gibt genügend Beispiele in der menschlichen Geschichte, dass Paradigmenwechsel grimmig bekämpft und lange Zeit unterdrückt worden sind und obendrein ihren Urhebern größte Schwierigkeiten und lebensgefährliche Bedrohung gebracht haben, weil sie traditionellen Interessen zuwider laufen. Was tun? Den Mund halten, sich in die schweigende Mehrheit zurückziehen?
Politische Konflikte verhindern
Konflikte an ihrer Wurzel anzupacken war immer eine Aufgabe der Philosophie, und Konfliktforschung (3) hat bereits Tradition. Doch ihre Werkzeuge sind stumpf geworden, ausgehebelt von verschiedenen Seiten.
In unserer Welt nimmt die Zahl und Intensität von Konflikten infolge der stark steigenden Bevölkerungsdichte und der bedrohlichen Waffentechnik in Besorgnis erregender Weise zu. Kann in dieser Situation einer verbesserten Philosophie wieder zunehmende Bedeutung zukommen? Konflikte entstehen zwar vordergründig durch unterschiedliche Interessen, welche überall und immer vorkommen werden. Doch ihre eigentlichen Ursachen scheinen oft unzugänglich zu sein, so dass es immer wieder um Lösungen schlecht steht.
Im privaten Rahmen ist es zumindest in modernen Gesellschaften mehr und mehr üblich, dass die Anwendung von Gewalt geächtet wird. Auffällig oft treten aber gewalttätige Konflikte dennoch auf, wo ein ideologischer Hintergrund gegeben ist. Dies wird in der meist auf den öffentlichen Bereich bezogenen Konfliktforschung oft nur zweitrangig berücksichtigt. Religiöse Überzeugungen und finanzielle Motive spielen beide im privaten Bereich eine wichtige Rolle, ohne dass die Bedeutung von als krankhaft anzusehenden psychischen Einflüssen negiert werden soll. Die ersteren beiden lassen sich jedoch auf Ideologisierungen zurückführen, sowohl generell in institutionalisierten Religionen als auch in wirtschaftlichen Grundüberzeugungen, vor allem kapitalistischer oder kommunistischer Art.
Im öffentlichen Rahmen moderner Gesellschaften ist diese Tendenz noch viel deutlicher. Das gibt der bereits früher geäußerten Ansicht Nachdruck, dass das im betreffenden Bereich vorherrschende Privatleben und das politische Leben weitgehend Spiegelbilder (4) zueinander sind. Das Privatleben sollte daher bei der Konfliktforschung im politischen Leben nicht ausgespart werden. Vom Privatleben kann möglicherweise ein wichtiger Aspekt religiöser Ideologisierungen und wirtschaftlicher Extrempositionen im öffentlichen Bereich kommen. Umgekehrt wird auch das Privatleben vom öffentlichen Leben beeinflusst. Diese sicher nicht getrennten Erscheinungen lassen sich als spiegelbildliche ideologische Extrempositionen zusammenfassen.
Krankhafte psychische Einflüsse können zwar im politischen Bereich ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, etwa in Diktaturen in Form von Größenwahn oder infolge direkter Erkrankung wie zum Beispiel durch Parkinson bei Hitler. Hier soll jedoch nur am Rande bemerkt werden, dass medizinische Kontroll-Untersuchungen aller führenden Politiker durch öffentlich bestellte und zur Rechenschaft verpflichtete Ärzte genauso wie für Piloten zwingend sein müssten, wie zum Beispiel der absichtlich herbeigeführte Absturz eines deutschen Flugzeugs in Frankreich im Jahre 2015 gezeigt hat.
Ein Nachlassen der Gewalt, wie von Steven Pinker noch 2011 angenommen (5), und damit eine Linderung des Konfliktpotentials kann etwa angesichts der grausamen Folter des Assad-Regimes (6) kaum noch behauptet werden. Dass die gesellschaftliche Ungleichheit als wesentliche Konfliktursache, wie insbesondere von Thomas Piketty konstatiert (7), nur durch Einschränkungen im Kapitalismus gelöst werden könne, bleibt ebenfalls sehr vage, weil letzterer nicht als einseitige extreme Position eingestuft wird.
Die vielfach mit ausschließlicher Analytik alles vereinnahmenden Geistes- und Naturwissenschaften und die massenhafte bedenkenlose Synthese von Medien und Technik tragen gewiss erheblich zu den Problemen bei. Die Naturwissenschaften fordern wie in einer Mantra Überprüfbarkeit durch Experimente und brillieren mit den Erfolgen der Technik. Im neuen Jahrtausend scheint sich jedoch das Blatt gewendet zu haben. Trügen die Zeichen, dass die Wissenschaften zu stagnieren (8) scheinen? Zunehmend werden sie aber als nützliche Hilfe für eine modernere menschenfreundliche Philosophie erkannt. Ob daraus auch neue nützliche Beiträge zu Konfliktlösungen entstehen können?
Ideologische Extrempositionen
Die Bedeutung philosophischer Erkenntnisse (9), welche bezüglich der zugrundeliegenden Gesetze und Ideen insbesondere von Wilhelm Windelband (10) thematisiert wurde, könnte aber besonders wichtig sein bei der Beurteilung von ideologischen Extrempositionen, welche oft die Wurzel von Konflikten sind. Die Philosophie vergangener Zeiten enthielt oft unter dem Deckmantel von dogmatischen Glaubensüberzeugungen oder axiomatischen Grundannahmen ideologische Elemente (11), deren Bedeutung bei der Einflussnahme extremer Positionen verdeckt blieb. Das scheint in ähnlicher Form für den religiösen wie für den wirtschaftlichen Bereich zu gelten. Die gemeinsame Parteinahme religiöser und wirtschaftlicher Gruppierungen ist eh und je ein unübersehbares Phänomen gewesen. Wie weit dies bewusst geschah oder aber durch mangelnde Einsicht zustande kam, soll hier nicht erörtert werden.
Wichtiger erscheint klar zu benennen, wo entscheidende Punkte in fehlender Einsicht gelegen haben oder heute vielleicht auch immer noch liegen können, welche den Bereich der bislang längst nicht von allen Menschen geliebten Philosophie tangieren. In der Vergangenheit bezog diese sich in einem solchen Zusammenhang auffällig oft in nicht ausgewogener Form auf Basisbereiche, womit vor allem das Verhältnis von Leben und Natur gemeint ist, welches oft arg im Dunkeln blieb. Diese Trennung hat im Laufe der Zeit zu getrennten Geistes- und Naturwissenschaften geführt, was sich insbesondere in neuerer Zeit immer mehr auch in der etablierten Philosophie widerspiegelt. Gleichermaßen betrifft das den Erfahrungsschatz, auf welchen sie zurückgreift wie auch die Methodik und die verwendete Sprache, sowohl geographisch wie auch fachlich.
Die moderne Philosophie scheint an einem Punkt angekommen zu sein, wo diese Trennung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften dringend reduziert und überwunden werden muss. Das stößt nicht selten auf Widerstände, erfordert aber Anstrengungen von beiden Seiten und mag belohnt werden nicht nur mit neuen Einsichten in theoretische Grundlagen, sondern auch mit sehr praktischen neuen Vorschlägen zu Konfliktlösungen. Dieses zielt in zwei scheinbar verschiedene Richtungen, nämlich einerseits klarere Formulierungen von wichtigen Grundvorstellungen und andererseits einen „Ersatz“ für extremistische Ideologisierungen. Die Anführungszeichen sollen deutlich machen, dass es sich nicht einfach um neue Ideologisierungen handeln darf. Klarer formuliert werden sollte, wie im folgenden Abschnitt genauer ausgeführt wird, vor allem der als grundlegend anzusehende Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung (12). Besagter „Ersatz“ aber mag in Lernprozessen liegen, systematisch einen Mittelweg zwischen statischen Extrempositionen zu suchen und damit dynamischen Einstellungen und einer Bereitschaft zu Kompromissen eine viel größere Bedeutung zu geben.
Beide Ziele lassen sich, wie sich zunehmend zeigt, mit einer moderneren Philosophie (13) deutlich besser als bisher anpacken und müssen vielleicht sogar zukünftig verstärkt derart angegangen und gefördert werden. Ein viel engeres Zusammengehen von geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Philosophie ist vor allem gemeint. Es wird zunehmend an verschiedenen Stellen deutlich, dass beide Disziplinen bei ihrem Alleingang an wahrscheinlich prinzipielle Grenzen gestoßen sind, welche sich nicht überwinden lassen, wenn versucht wird, sich weiterhin auf den jeweiligen Bereich zu beschränken. Interdisziplinäres Vorgehen dürfte auch hier in einem viel weiteren Ausmaß nötig werden, als man bisher bewusst zur Kenntnis genommen hat.
Die geisteswissenschaftliche Orientierung wird vor allem im englischsprachigen Raum als humanistisch bezeichnet (14), was ihren Bezug auf das menschliche Leben besonders hervorhebt. Moderne Forschung zeigt jedoch in zunehmendem Maße eine viel größere Nähe von Mensch und Tier, insbesondere höheren Tieren, als früher bewusst wahrgenommen wurde. Tiere haben bereits Formen von Intelligenz, Gedächtnis und Gefühlen (15), welche in vergangenen Zeiten und vielerorts auch heute noch absolut unterschätzt werden. Dieser Konflikt zwischen verschiedenen Positionen zeigt sich besonders scharf in der Konfrontation zwischen streng religiösen und darwinistischen Orientierungen (16). Doch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften herrscht auch allgemein trotz zunehmender Kontakte oft noch unzureichende Zusammenarbeit.
In allen künstlerischen Disziplinen gibt es entsprechende ähnliche Konflikte. Insbesondere durch den Existenzialismus wurde die Auseinandersetzung (17) auf die Spitze getrieben zwischen Anhängern einerseits von möglichst großer Authentizität in weiten Bereichen bis hin zur Führung von Hochschulen und sogar in der Politik, und andererseits von bewusstem „fake“ etwa in Mode, Theater und Film oder bei Festen mit Verkleidung. Des Weiteren gab es durchaus entsprechende Auseinandersetzungen innerhalb der Extrempunkte Anarchie und Diktatur (18). In letzteren beiden Bereichen wurde ebenfalls deutlich, dass es auf mittlere Positionen und Kompromisse ankommt.
Geist gegen Natur?
Vom philosophischen Standpunkt besonders wichtig und für mögliche Problemlösungen beispielhaft dürften jedoch die tief verwurzelten Konflikte zwischen Geistes- und Naturwissenschaften (19) sein. Letztere scheinen sich nicht selten nur darin einig zu sein, dass sie gemeinsam unter dem Dach von Universitäten oder damit vergleichbaren Organisationen zusammen sein wollen. In vielen Fällen hört damit aber die Gemeinsamkeit schon auf. Die Ursachen sind schwierig einzukreisen. Während die Geisteswissenschaften immer vehementer das typisch Menschliche in den Mittelpunkt stellen, betonen die modernen Naturwissenschaften vor allen die Wichtigkeit von Konsistenz und experimenteller Überprüfbarkeit.
Die historische Erfahrung in aller entscheidender Heuristik (20) zeigt aber, dass die wichtigsten Erkenntnisse, nämlich solche, welche zu wirklichen Paradigma-Wechseln geführt haben, außerhalb von Institutionen stattgefunden haben, welche mit den heutigen Universitäten vergleichbar wären. Namen wie bereits Odysseus, Demokrit und Archimedes und später Seefahrer wie Marco Polo und Kolumbus und Ungläubige wie Leonardo da Vinci und Galileo Galilei weisen auf die Bedeutung eines abenteuerlichen Lebens hin, welches sie von ausgetretenen Pfaden entfernte. Erst in der Neuzeit scheint sich ein Trend zur Einordnung in Universitäten durchzusetzen, zum Beispiel bei Kant und Naturforschern bis hin zu Einstein. Doch auch letztere stehen dem Establishment ferner, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Kant lebte zum Beispiel als Außenseiter im fern liegenden Königsberg und Einsteins Privatleben ist auch eher abenteuerlich und gerade in seinen kreativsten jungen Jahren nicht in den festen Rahmen einer Universität gebunden.
Der ausschließliche Bezug der Geisteswissenschaften eben auf den sogenannten geistigen Bereich und das Menschliche gerät auch immer mehr in Kontroverse. Einerseits dringen in viele Bereiche der sogenannten Geisteswissenschaften mit naturwissenschaftlichen Methoden auch deren Denkweisen (21) ein, insbesondere eben der bereits genannte Wunsch nach einheitlicher Konsistenz und Überprüfbarkeit. Andererseits haben nicht nur zum Beispiel durch naturwissenschaftliche Messverfahren gezeigte Ähnlichkeiten der DNA-Zusammensetzung (22) von Lebewesen, sondern auch extreme Kriegserfahrungen (23) die Einschränkung auf das Menschliche unterlaufen. Tiefe Spuren hat die Erfahrung hinterlassen, dass im Krieg zahlreiche Menschen in einer Bevölkerung grausamer als Tiere (24) sein können.
Eine unerwartet wichtige Rolle spielt dabei die Mathematik. Sie ist Geisteswissenschaftlern oft völlig unzugänglich oder wird gar prinzipiell abgelehnt, ist aber die Hauptbasis aller naturwissenschaftlichen Beschr...