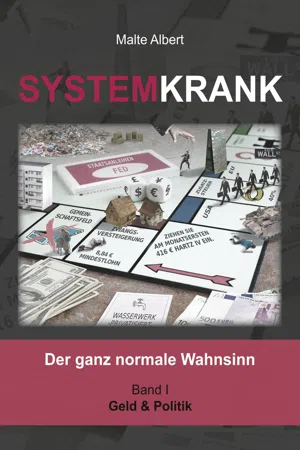![]()
Teil I
Das Geldsystem – ein systematischer Betrug
»Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine
Revolution noch vor morgen früh.«1
(Henry Ford)
![]()
Kapitel 1
Dagobert-Duck-Denken
Geld, Geld, Geld... Überall reden die Leute vom Geld! Jeder will es – kaum einer hat es... Doch könnten Sie die Frage beantworten, was Geld überhaupt ist? Auch wenn es recht banal klingt, was genau ist Geld eigentlich? Und weiter stellt sich die Frage: Warum gibt es Geld und wie entsteht es? Wie wirkt es sich auf unser Leben aus und warum dreht sich scheinbar alles darum?
Sollte es Ihnen gelingen, diese zunächst so simpel wirkenden Fragen korrekt zu beantworten, so dürfen Sie dieses Buch nun zuklappen und sich anderem widmen – doch höchstwahrscheinlich werden Sie das nicht tun. Denn der Großteil aller Menschen hat vom Wesen des Geldes nicht den Hauch einer Ahnung. Die viel spannendere Frage lautet daher wohl: Weshalb eigentlich nicht? Immerhin benutzen wir Geld im Alltag regelmäßig, die Meisten beinahe täglich. Als Bindeglied zwischen den Wirtschaftsgütern ist es das meist gebrauchte Produkt! Haben Sie sich daher je gefragt, weshalb das zentralste Gesellschaftsgut zu Ihrer Schulzeit kein einziges Mal umfassend thematisiert wurde? Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Man könnte fast meinen, es bestünde kein Interesse daran, dass Sie das Wesen des Geldes verstehen lernen... Und überhaupt: Woher stammt eigentlich die seltsame Verhaltensnorm, dass man über Geld nicht spricht?
Viele Mythen und Mysterien ranken sich ums Thema Geld. Der Zauber und die Faszination, die von ihm ausgehen, sind in der menschlichen Geschichte unerreicht. Selbst der Gottesglaube, ein die Kulturen für Jahrtausende beherrschender Splitter im Kopf, scheint dem Glaube an das Geld mit der Zeit erlegen; der moderne Mensch folgt dem Geld, wie der Hund seinem Herrchen. Schon die Jüngsten plündern heimlich das Sparschwein ihrer Geschwister; Geschiedene quetschen mit Scheidungsanwälten ihre Ex-Partner aus; Hinterbliebene zerstreiten sich über das Erbe; Investmentbanker verkaufen ihre Seele für Boni; und selbst das Wichtigste auf der Welt, die Freundschaft, hört bei Geld bekanntlich auf. Betrachtet man es auf diese Weise, so mutet seine Aura gar unheimlich an. Betrug, Diebstahl, Fälschung, Einbruch, Prostitution und Mord, sie alle gehen Tag für Tag auf sein Konto. Ist es also eine Lüge zu behaupten, Geld mache frei? Nein, es stimmt: frei von Bedenken, frei von Anstand, frei von Moral. All diese Dinge sind käuflich, solange der Preis stimmt...
»Wer der Meinung ist, für Geld alles haben zu können, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist.«2 (Benjamin Franklin)
Schon in den Comicheften der Kleinen schwimmt der habgierige Dagobert Duck im Geldspeicher herum. Als Prachtexemplar eines Geizkragens beweist er, wie lohnend es ist, jeden Cent zweimal umzudrehen. Wen wundert es da schon, dass sogar Erstklässler penetrant auf ihr Taschengeld beharren, selbst wenn sie noch mit den Fingern rechnen? Bereits von Kindesbeinen an trichterte man uns ein: »Halte dein Geld zusammen!« Einige Kinderstuben erwecken gar den Anschein, dies sei der Leitgedanke einer guten Erziehung. Ob man es im Leben zu was bringt oder nicht, bemisst sich offenbar nicht in Zufriedenheit – Geld ist der Maßstab, mit dem Glück quantifiziert wird! Wohl kaum einem anderen Substantiv entsprechen mehr gängige Synonyme: Kohle, Asche, Piepen, Moneten, Zaster, Taler, Knete, Kröten, Flocken, Blüten, Patte, Pinke, Euronen, Kies, Märker, Pennies, Rubel, Scheine, Bares, Moos, Groschen, Zunder, Schotter, Tacken, Ocken, Schleifen, Mäuse – um hier nur einige zu nennen. Doch wie man es auch dreht und wendet, so eindringlich, wie das Original, ist kein Zweites – Geld! Nicht wenige Menschen scheinen zu allem bereit, um es in die Finger zu kriegen. Solange die Kasse ordentlich klingelt, rücken selbst unmoralische, andernfalls unvorstellbare Dinge in den Bereich des Möglichen. Wie heißt es seit Machiavelli so schön: Der Zweck heiligt die Mittel! Doch war nicht Geld einst nur Mittel zum Zweck? Dient es uns überhaupt noch in seiner Ursprungsfunktion, als praktisches Hilfsmittel? Oder hat es unser praktischer Diener von einst mittlerweile gar selbst zum Dienstherren gebracht?
»Viele Menschen benutzen Geld, das sie nicht haben, für den Einkauf von Dingen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen.«3 (Walter Slezak)
Ein altes chinesisches Sprichwort besagt: »Arm zu sein, ohne zu klagen, ist leichter, als reich zu sein, ohne zu prahlen.«4 Ohne Zweifel ist dies ein netter Aphorismus. Wie hoch der ihm innewohnende Wahrheitsgehalt jedoch wirklich ist, kann kaum einer sagen. Wer kann schon von sich behaupten, arm und reich gleichzeitig zu sein? Oder wenigstens, beides im selben Leben erfahren zu haben? Die deutsche Klassengesellschaft zumindest erlaubt laut jüngster OECD-Bildungsberichte den Aufstieg von unten nach oben immer weniger.5 Und auch anderswo scheint der alte amerikanische Traum – vom Tellerwäscher zum Millionär – nur überaus selten in Erfüllung zu gehen. Die Anzahl derer, die dieses Sprichwort tatsächlich bewerten könnten, ist also ziemlich gering.
Doch lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen: die wahre Kunst liegt nicht darin, erfolgreich arm oder reich zu sein. Die wahre Kunst liegt darin, erfolgreich zufrieden zu sein! Es ist der Wunsch nach Zufriedenheit, der unser aller Handeln antreibt. Das Geld spielt hierbei eine nur untergeordnete, wenngleich auch schizophrene Rolle: Wir haben uns daran gewöhnt, Geld als Wegweiser auf dem Pfad der Zufriedenheit zu interpretieren. Solange wir der Spur des Geldes folgen, bilden wir uns ein, der eingeschlagene Weg sei der Richtige. Kaum einer denkt ans Abbiegen solange der Rubel rollt. Als provokante Reaktion auf diese Merkwürdigkeit, spricht der deutsche Politikwissenschaftler Elmar Altvater bei unserer jetzigen Epoche vom Kapitalozän, dem Erdzeitalter des Kapitals. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hingegen benennt es etwas scherzhafter mit Knetozän – dem Zeitalter, in dem sich alles um Knete dreht. Ein wenig wohlklingender formuliert es wiederum der deutsche Philosoph Richard David Precht, mit dem von ihm geprägten Ausdruck Monetozän, der monetären Epoche.6 Dabei verbindet sie alle dasselbe Bedürfnis: Sie alle suchen nach der adäquaten Vokabel, um die wohl eigentümlichste Zivilisationsetappe überhaupt zu beschreiben. Waren es im Actionfilm Matrix noch die Maschinen, welche realitätsentfremdete Menschen kontrollierten, so ist es außerhalb von Hollywood das Geld, das ihren Platz einnimmt. Wer bitte könnte ernsthaft von sich behaupten, geistig autark und damit frei von jedweder wiederkehrender Geldfantasie zu sein? Während die Armen in der Regel ans reich sein denken, denken Reiche regelmäßig ans reicher werden. Denn auch wenn dieses Eingeständnis Abgründe auftut: Geht es um Geld, ist es meist Gier, die uns beherrscht. In Geldfragen lautet die Antwort stets »mehr!«. Wir wollen Geld anhäufen und stapeln, am liebsten bis unter die Decke. Und tatsächlich ist das heute auch möglich; denn im Gegensatz zu früheren Tagen, als gärende Lebensmittelvorräte die Speicher blockierten, lagern wir fortschrittlichen Menschen Unverrottbares ein. Pecunia non olet – Geld stinkt nicht, erkannte schon der altrömische Kaiser Vespasian im ersten Jahrhundert.7 Zugegeben, essen können wir den Inhalt unserer Speicher heutzutage nicht. Doch dafür haben die klimpernden Münzen und bunten Scheinchen einen unfassbaren Wert – darauf zumindest, haben wir uns geeinigt.
Viele ackern sich halb tot, um ihr Geld zu mehren. Nicht bloß in Deutschland ist die überschwängliche Arbeitswut Leitkultur und Ethik-Kodex zugleich. Vollgestopfte Bürotürme, in denen auch am Wochenende spät Abends noch Licht brennt, dominieren die Skylines aller Metropolen, von Europa über Asien bis Amerika und zurück. Analog zu legendären Börsen-Filmen wie The Bank, The Big Short, Margin Call, Wall Street oder The Wolf of Wall Street, nimmt hier die ewige Jagd nach dem Geld oft ganze Leben in Beschlag. Selbst jahrhundertealte Schriftwerke kreisen häufig um fanatische Begierden, geweckt durch Smaragde, Rubine, Silber und Gold. Unzählige Legenden ranken sich um Abenteuer von besessenen Schatzjägern, die auf der Suche nach Schatzinseln und -kammern alles andere vergaßen. Wie aus der menschlichen Geschichte extrahierbar scheint, war uns die Sehnsucht nach funkelnden Reichtümern schon immer ein schwerwiegendes Laster...
Aller Evidenz zum Trotz, scheinen nicht wenige nach wie vor bereit, ihre nur kurze Lebenszeit der Geldjagd zu verschreiben. Schon längst treiben wir es so weit, sogar die Zeit, in der wir dem Geld nachlaufen, selbst in Geld zu bewerten. Immer engere Zeitfenster und utopischere Deadlines stehen Projektentwicklern, -steuerern und -managern zur Verfügung. Selbst Kreativschaffende und Wissenschaftler werden zunehmend durch enge Zeitvorgaben, bedingt durch noch viel engere Budgets gegängelt. Wo dringend Raum für Kontemplation geboten wäre, will der effiziente Kapitalist von heute wissen, wie effizient seine Effizienz ist. Denn Sie wissen ja: Zeit ist Geld! Zumindest aus Investorensicht. Für die von ihrer Profitgier gebeutelten Arbeiter dagegen ist es zumeist eher umgekehrt. Hier lautet das Motto: Geld verdienen kostet Zeit! ...Ist es nicht die Ironie der Effizienz, dass einige das Reichwerden anderer so teuer bezahlen?
Der US-Milliardär John D. Rockefeller sagte diesbezüglich einmal: »Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen.«8 Eine wohl recht herablassende Aussage von einem Mann, der mehr Geld sein Eigen nannte, als er je hätte ausgeben können. Zumindest statistisch ist anzunehmen, dass Sie nicht in solchen Sphären spielen. Wahrscheinlich ist das Tauschgeschäft Arbeit gegen Geld fester Bestandteil Ihres Lebens. Doch haben Sie sich je die Zeit genommen, diesen Deal zu hinterfragen? Immerhin geht es hier um etliche Ihrer Lebensjahre, da sollte die Sache doch zumindest mal auf den Prüfstand geraten, oder nicht? Sicher, was Sie dem Arbeitsmarkt anzubieten haben weiß niemand so gut wie Sie – daran besteht kein Zweifel. Doch wie steht es mit dem, was Sie am Arbeitsmarkt nachfragen, dem Geld? Haben Sie je überlegt, was Ihnen da eigentlich angeboten wird?
Absonderliche Arbeitswelt
Jahrtausende kamen Gesellschaften ohne Lohnarbeit zurecht. Erst vor rund 200 Jahren war der althergebrachte Lebensstil des Menschen flächendeckend einem Wandel unterworfen. Man mag sich darüber streiten, inwieweit dieser Umbruch in der Berufswelt unser Leben verbessert hat. Nur wenige würden die legebatterieähnlichen Zellenbüros der Moderne als artgerechte Haltung des Menschen bezeichnen. Oder den typischen Nine-to-five-Job, das Stechuhr-konforme Schuften nach Dienstplan, als finale Stufe der Berufsevolution. Nichtsdestotrotz ist das Gefühl, zur Arbeit zu gehen, um Geld zu verdienen, heute weit verbreitet. Und in der Tat erscheint dieser Gedanke, isoliert betrachtet, recht plausibel. Ein genaueres Studieren der Gesamtsituation entlarvt ihn jedoch als Zerrbild. Spannt man den Bogen nämlich weiter auf und blickt auf die gesamte Volkswirtschaft, gerät die Plausibilität ins Wanken: Fakt ist, dass wir in unserer arbeitsteiligen Wirtschaftswelt arbeiten, um mittels Arbeitskraft Waren und Dienstleistungen zu generieren. Diese dienen der Versorgung unserer Gesellschaft, und damit ebenso der Versorgung unserer Selbst. Das Geld dient hierbei lediglich als eine Art »Verbundmittel«, ähnlich eines Brückenelements, um das Zusammenspiel von aufgebrachter Arbeitskraft, eingesetzten Ressourcen sowie des Erwerbs hergestellter Produkte zu simplifizieren.
Streng genommen also ließe sich Wirtschaft auch ganz ohne Geld betreiben... Würde ein Jeder morgen früh aufstehen und agieren wie immer, das Selbe arbeiten, nutzen und konsumieren, so könnte auf den Austausch klimpernder Münzen und bunter Scheinchen verzichtet werden, zumindest theoretisch. Als entscheidende Lektion hierzu gilt nämlich folgendes: Waren und Dienstleistungen können auch ohne Geld verwendet werden – Geld ohne Waren und Dienstleistungen nicht! Würde nur eine einzige Komponente aus der Wirtschaft entfernt (Arbeitskraft, Ressourcen oder Produkte), so käme der gesamte Wirtschaftskreislauf zum Erliegen. Die Bedürfnisbefriedigung der Wirtschaftsteilnehmer wäre sofort dahin. Durch die Entfernung des abstrakten Bindegliedes Geld hingegen müsste sich prinzipiell gar nichts ändern – alles könnte seinen gewohnten Gang gehen.
Bevor wir uns jedoch im hypothetischen Denken verlieren, beschäftigen wir uns zunächst weiter mit der gegebenen Situation. Arbeitsteilige Wirtschaften fußen auf der Idee, dass jeder von der Tätigkeit der anderen profitiert. Sinnvoll wäre es daher, Berufen mit der tragendsten Funktion die höchste Belohnung zukommen zu lassen, während andere Berufszweige mit geringerem Gesellschaftsnutzen entsprechend weniger erhalten – dies wäre ein gemeinnütziger Ansatz. Vermutlich würden auch Sie eine Wirtschaft derart konzipieren, wenn Sie sie auf dem Reißbrett entwerfen sollten, oder nicht? Eine Betrachtung unserer heutigen Ist-Situation offenbart jedoch etwas gänzlich anderes: Während Menschen in bedeutenden Berufsgruppen kaum über die Runden kommen, erhalten andere für fragwürdige Machenschaften und ominöse Geschäfte Unsummen. Millionenfach nagen die Eckpfeiler unserer Gesellschaft, wie Krankenpfleger, Postboten, Abfallentsorger, Kanalarbeiter, Busfahrer oder Erzieher, nahezu am Hungertuch. Dem Gemeinwohl unzuträgliche, halbseidene Tätigkeiten hingegen versprechen oft riesige Gehälter und satte Boni.
»Das Einkommen der Berufsgruppen verhält sich umgekehrt proportional zu ihrer physioökonomischen Bedeutung.«9 (Andreas Clauss)
Tatsächlich könnte man meinen, die Grundidee unseres Zusammenlebens stünde auf dem Kopf. Wo Menschen einst zur gegenseitigen Unterstützung Gesellschaften bildeten, begibt sich nunmehr ein Jeder ins Getümmel, um das Meiste für sich herauszuschlagen. Wie es scheint, ist unse...