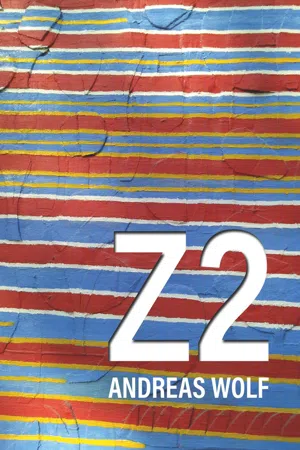![]()
IV. Das Subjekt
Hochwertige Biomassen.
Jede physikalische Weltbeschreibung hat ein bedeutendes Problem: Sie ist enorm langweilig und erinnert in ihren weiteren Ausführungen den genervten Zuhörer an eine der beliebtesten Serien innerhalb der Muppet Show, nämlich: „Schweine im Weltall“. Besonders anständig ist das nicht. Wenn man genauer hinschaut, dann sind die physikalischen Modelle langweilig und spannend, hochbedeutend und reiner Nebbich, treffend und gegenstandslos zugleich. In einem Mesobereich, also der mittleren Lage, in der wir uns bewegen, brauchen wir keine Higgs-Felder (oder denken es zumindest), bei der Fahrt zum Zahnarzt stört uns am allerwenigsten die Rotverschiebung und einen Parkplatz finden wir trotz der allgemeinen Raumexpansion selten genug. Ja, selbst ein Flug zum Mond ist in einem Newtonschen Universum anstandslos abzuwickeln, wo also ist das Problem? Zum einen besteht das Problem darin, dass wir extrem undankbar sind, oder, was hier dasselbe besagt: extrem dumm. Wir konsumieren die moderne Physik, ohne es eigentlich zu wissen. Sämtliche Dinge, die ziemlich geil erscheinen (Computer, Handy, Flachbildschirme) sind digitale, nämlich: quantenmechanische Dinge. Wir leben also jetzt schon in einer ziemlich smarten Welt, dies aber mit Begriffsfeldern, die dem 19. Jahrhundert entstammen und in Sätzen wie „Wer viel frisst, das scheißt auch viel“ klare Kraft-, Masse- und Kausalitätsverhältnisse glauben angeben zu können.
Gleichwohl liegt dieser Apathie ein reales Unbehagen zugrunde, und dieses reale Unbehagen ist für das Subjekt (lat.: subiectum, das, wörtlich und zunächst Daruntergeworfene, aber letztlich auch: Zugrundeliegende) eindeutig metaphysischer Art. Es stellt sich nämlich die Frage nach dem Sinn der ganzen Unternehmung Welt, und dies wiederum ist nur eine Deckfrage für die eigentlich entscheidende: Was ich damit zu tun habe. Mit Wittgenstein gesagt:
„Wir fühlen, dass selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind“ (Tractatus). Wir glauben also, dass die Frage nach der Welt immer und zuerst die Frage nach dem Ich ist, und das aus dem besten aller Gründe, denn sie, die Welt, erscheint im Ich und nur in ihm allein, so dass eine weltliche Darstellung der Welt (also in der Physik) vom Fragesteller selbst mit einer gewissen Gleichgültigkeit bestraft wird, weil seine Ansprüche wesentlich anderer Art und im Kern keine physikalischen, sondern metaphysischen Fragen sind, da mag das Subjekt sich so realitätstüchtig gebärden, wie immer es will. Es steht als Subjekt immer schon in einem metaphysischen Bereich und fühlt sich durch Higgs-Bosonen, sagen wir es deutlich: sachlich negiert, also verneint, und zwar zum Ding verneint. Und dazu hat das Ich jedes Recht der Welt. Es ist also ein Kategorienfehler, wenn das Subjekt als Träger eines Elementarteilchenzoos, der es physikalisch natürlich auch ist, angesprochen wird, es fühlt, dass dies richtig, aber belanglos, hochbedeutend und vor allem reiner Nebbich ist. Eine solche Einsicht könnte man als „die Stunde der wahren Empfindung“ (Handke) bezeichnen.
Aber was erkennt man in solch einer Stunde der wahren Empfindung, was, anders gefragt, ist überhaupt eine wahre Empfindung? Wir denken dies, dass alle Zu- und Abschreibungen, jedes objektivistische Denken gleichsam ein Denken aus zweiter Hand ist, ein schwerer Phantasiefehler (Thomas Mann), weil das Subjekt, so mies und materiell es auch immer daherkommen mag, niemand anderes ist als, pathetisch gesprochen: „Der Hirte des Seins“ (Heidegger, Brief über den Humanismus). Ist es aber der Hirte des Seins, dann kann es auch Ansprüche an dieses Sein geltend machen – und das ist genau der Grund, weshalb das Subjekt sich ungern schräg von der Seite, nämlich als Biomasse anquatschen lässt –, denn es ist nicht nur der Hüter des Seins, es beansprucht nicht nur das Sein und wird seinerseits vom Sein beansprucht, es ist – erstaunlicherweise – niemand anderes als das Sein selbst (natürlich keineswegs vollumfänglich, was ja einigermaßen trostlos wäre). Aber wir haben teil am Sein, und das nicht nur hegend und hüterisch, also mehr oder weniger metaphorisch. Und genau darin zeigt sich (Wittgenstein) auch der Solipsismus. Nämlich im Tod. Wir sprachen ja eingangs von einer erkenntnistheoretischen Pointe. Da ist sie.
Das Ich, so Fichte, setze das Sein „vermöge seines blossen Seyns“, was ja ziemlich irre und übrigens eine wahre Titanenarbeit wäre (die ein Baby etwa gar nicht leisten könnte), wenn es nicht das Sein selbst sei. Fichtes berühmte „Thathandlung“ wäre anders gar nicht möglich und reines Begriffstheater und pompöse Narrheit. Also ist es nichts anderes als eine doppelte Tathandlung.
Und auch Hegels Bestimmung, dass „das Wahre nicht als Substanz, sondern eben so sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken“ sei (Phänomenologie des Geistes), macht nur so einen Sinn. Das Subjekt, nun einmal sehr anschaulich und damit zugleich auch ziemlich blöde gesagt, liegt wie ein Teebeutel im heißen Wasser der Wirklichkeit, entfaltet sich dort und verändert seinerseits das Wasser, nämlich zu Tee. Die Schnur dieses Teebeutels, gleichsam also der Lebensfaden, der ja bekanntlich gar nichts bewirkt, nach rein gar nichts schmeckt und nur so sinnlos am Tassenrand herunterhängt, ist sozusagen das Rückreiseticket des Subjekts. Allerdings sind Begriffe wie Rückreiseticket eher touristischer als philosophischer Art, hier nennt man sie auch nicht Teebeutelschnur und auch nicht den Lebensfaden der Parzen, sondern: die transzendentale Einheit des Ichs (Kant).
Meine Fresse!, könnte man sagen, da sind sie ja wieder, nämlich Kasperle (das transzendentale Ich) und das Krokodil (nämlich das Ding an sich). Die sollen sich doch endlich einmal lieb haben. Haben sie doch! Denn natürlich ist das Leben ein Vollwaschgang mit Schleuderstufe 1600, und klar, natürlich verwirklicht sich das Subjekt nur im „konkret Allgemeinen“ (Hegel) – wo denn auch sonst? – und verändert wiederum dieses konkret Allgemeine, also letztlich auch das Ding an sich selbst (nämlich in der Wissenschaft). Also nimmt die Zeit, die wir zu reiten vermeinen, uns selbst unter ihre Hufe, ein etwas kompliziertes Denkbild, das man gemeinhin und mit Hegel die Weltgeschichte nennt. Natürlich erschafft sich das reale Subjekt nur in Bezug auf andere Subjekte und schafft so Wirklichkeit, natürlich geht es immer in den „Kampf um Anerkennung“ (Hegel), das ganze Intersubjektivitäts-Tralala ist völlig richtig, aber auch geschenkt.
Wenn also etwas feuilletonistisch gesagt wird, das Ich sei gleichsam der Autor seiner Welt, dann ist das auf einer realen Ebene absolut richtig, denn in der Auseinandersetzung mit den Dingen verwandelt er sie. Man nennt das Arbeit. Es ist psychologisch nur bedingt richtig, da sich das Ich zunächst durch das äußere Bild seiner selbst nicht nur formiert (Lacan) und transformiert, um sich dann – und nun stimmt die Richtung wieder – gewissermaßen lebenslang vor dem Spiegel zu frisieren, fröhlich vor sich hin projiziert, dabei stets und gerne zu groben Fehlattributionen neigt und letztlich „always in the same car“ (David Bowie) crasht. Auch scheint uns an dieser Stelle die Beobachtung Hannah Arendts bemerkenswert, wonach das Ich nicht altert, also keine Zeit kennt (womit offenbar der Selbstbezug gemeint ist). Uns interessiert allerdings allein die absolut vorgängige, kaum noch ichfunktionell zu nennende Erzeugungsleistung der transzendentalen Apperzeption (und Synthesis), nämlich schlicht die Fähigkeit, überhaupt erst einmal eine Welt hervorzubringen, eine allem zugrunde liegende Welt also und sämtliche Erfahrungen auf die Terme „Ich“ und „Außen“ hin zu verbuchen, und das auf eine stets vor- und mitgedachte „Welt“. Wir halten dies für ein extrem erklärungsbedürftiges Muster und für ein metaphysisch erstklassiges Motiv, ohne nun gleich mit dem „Geistersehen“, dem Zweiten Gesicht und seinen „Vorbränden“ wie etwa bei Schopenhauer rustikal und bauernphilosophisch ins Metaphysische hineinzupoltern. So gesehen (und auch nur so gesehen) könnte man davon sprechen, dass der Mensch in der Welt steht, aber nicht von der Welt ist (Johannes 15,2) und mit Georg Trakl sagen: Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden. Wir sind theologisch nicht sonderlich musikalisch und halten uns mit eigenen Expektorationen zurück, möchten aber das einzig mögliche Interface auch geradeaus und deutlich genug benannt haben. Denn das transzendentale Ich ist weder das empirische Ich noch das reflektierende Ich noch das Ich als Selbstreflexion, es ist gleichsam ein Hauch, der auf diesen Formen des Geistes liegt, kaum Ich noch zu nennen, aber es ist die Bedingung ihres Funktionierens und als solche steht es (wo soll es auch anders stehen?) an der Schnittstelle zum Sein.
Allerdings definieren wir das Sein wiederum viel lieber als höhere Möglichkeit, was auch seitens des Subjekts uns als die bessere Bestimmung erscheint. Denn man müsste schon einen ziemlich ambitionierten, ja: durchgeknallten Subjektbegriff unterhalten, wenn man Leute an einer Currywurstbude als Seinshüter bezeichnen würde, auch wäre es einigermaßen abwegig, nur die Rilke-Leser in diesen schönen Rang erheben zu wollen. Es ist letztlich völlig gleich und bestimmt nur den Grad der Selbstdurchsichtigkeit, ob jemand eine Currywurst isst oder die Duineser Elegien liest. Das sind alles empirische Möglichkeiten, die, sagen wir es zunächst einmal grob und direkt, metaphysische Grundstruktur des Subjekts selbst bleibt davon völlig unberührt.
Was aber ist die metaphysische Grundstruktur des Subjekts, und vor allem: Wie äußert sie sich? Wir meinen: in einem leichten Hauch, der auf jeder Wahrnehmung, jeder Erfahrung, jedem Denken liegt, nämlich darin, dass ein sehr leichtes, sehr abstraktes Ich denke „alle meine Vorstellungen muss begleiten können“ (Kant). Diese überaus raffinierte, allerdings zwingend notwendige transzendentale Form der empirischen Erkenntnis selbst ist der extrem schwache, kolibriartig kleine „Ichpol“ (Husserl), der der kompakten Majorität der Dinge, Verhältnisse und Sachverhalte zwingend gegenüberstehen muss und auch steht. Wer nun die Dinge von der anderen Seite, nämlich geschichtlich, epistemisch, dialektisch-materialistisch betrachtet, wird diese extreme feinstoffliche Funktion als besseren Fliegenschiss anzusprechen sich genötigt sehen (Foucaults Kritik an Husserl), als Spinnerei eines in die Jahre gekommenen Hochreckturners. Aber wir halten dafür, dass die Dinge keineswegs so einfach sind, dass es mit einem burschikosen Heidewitzka, Herr Kapitän sein Genüge finden könnte. Und auch der Hinweis, hier werde der Vereinzelung ja Tür und Tor geöffnet, ist gegenstandslos, denn in der „Einfühlung“ (Husserl) sagen wir deutlich: In der Liebe erfahren wir ja gerade, dass auch der Andere ein ebenso feines und vom Empirischen aus gesehen irres Subjekt- und Weltempfinden hat wie wir, die transzendentalen Spinner, selbst. Und genau darin besteht die besagte metaphysische Struktur des Subjekts: in dieser transzendentalen Grundfunktion eines jeden Subjekts.
Wir sind keine Idioten, und glauben die Dinge einigermaßen humorlos zu sehen. Natürlich ist der Mensch immer so etwas wie ein bunter Hund, ein ziemlich mieses Blatt, das er im Laufe seines Lebens wohl oder übel wird ausspielen müssen (so in etwa drückt es Nietzsche aus). Natürlich sind die Subjekte vor allem gegenüber dem Tao, dem Sein gegenüber nur „stroherne Hunde“ (um das vermutlich berühmteste Zitat von Laotse zu verwenden). Aber doch scheint es möglich, dass beide mitunter zusammenkommen und in einer Flamme brennen. Zumindest in hohen Momenten. Denn das Subjekt besitzt mitunter eine merkwürdige Gefühlstotalität oder, wem das lieber ist, eine Totalitätsfühligkeit, und wenn es mit Grund und Gegengrund selten genug zugrunde geht, dann gibt es doch akausale, man kann sagen: lyrische, man kann auch sagen: seinsverdichtete Momente, in denen es auch genau weiß, was hier gespielt wird. Es erkennt sich selbst als Teil des Ganzen. Und dieses Ganze ist als Ganzes (allein schon begriffslogisch) nicht irgendwie jenseitig oder rein jenseitig, sondern stets gegenwärtig, und genau deshalb spürt man es als Subjekt ja auch. Zwei, drei Takte guter Musik reichen zuweilen dafür schon völlig aus. Mehr braucht es nicht. Dann hört man die Melodie des Stücks (wir etwa hören, während wir dies schreiben, die Titelmelodie des Soundtracks zu True Grit, wiederum: Coen-Brüder (2010), eine Melodie, die ja schleppend genug beginnt).
Das wäre in der Tat eine ziemlich überraschende Wendung für jemanden, der aus durchaus kontingenten, wir dürfen vielleicht biologisch deutlicher sagen: hervorkarnickelten Verhältnissen kommt – inter faeces et urinam – in kontigenten Verhältnissen lebt – wir sehen ihn gerade Pommes rot-weiß an einer Currywurstbude essen – und in kontingenten Verhältnissen stirbt, etwa indem er einen Klettball aus einem Meter Entfernung gegen eine Klettwand wirft, dabei umfällt und verscheidet, wobei der Begriff der Kontingenz, also der Nicht-Notwendigkeit (die Summe dessen, was man eigentlich alles nicht braucht), die kruden Umstände eher verschleiert als benennt. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass die Wirklichkeit, die uns ja schon bei ihrer Entstehung als ziemlich durchtriebenes Stück aufgefallen ist, auch in ihrem nun sauber materialisierten Zustand mit einer gewissen Doppelsinnigkeit in allen Bereichen, also auch dem humanen, durchaus nicht spart, ja der Doppelsinn und die Durchtriebenheit ist. Denn sie, die Durchtriebenheit, bezeichnet technisch und formal nichts anderes als eine gewisse doppelsinnige Verschränkung zweier Zustände. Und wir wagen jetzt schon die Aussage, dass wir es letztlich auch in der Abgründigkeit des Subjekts selbst – berufsethisch bis in die Haarspitzen und zugleich grabesnah, ins Empirische vernarrt wie ein Pudel und zugleich ins Nichts gehalten – mit einem metaphysischem Binärmechanismus zu tun haben, bei dem zwischen Z 1 und Z 2 nichts mehr passiert als dies, dass die Signifikanten tauschen. Möchten wir das Subjekt funktional bestimmen, so kommen wir zunächst um eine völlig scholastisch anmutende Formulierung nicht herum. Sie lautet: Das Subjekt ist haltend im Halten gehalten. Sorry. Klingt wirklich verschroben, das geben wir zu. Nämlich nach Heidegger (und seinem Begriff der Gelassenheit). Wir werden ihn aber entfalten und glauben auch, dass er wesentlich mehr erklärt als die passivistische Gelassenheit, wie wir ohnehin vorhaben, stärker in die Entblödung zu gehen als der Schleicher vom Schwarzwald.
Neuronale Schwundstufen.
Es gibt schon heute sehr raffinierte Kühlschränke, die ziemlich komplexe Funktionen unterhalten. Nun stellen wir uns einen Kühlschrank vor, dessen Komplexität so enorm ist, dass er selbst denkt, er sei ein Kühlschrank. Diese Selbstwahrnehmung können wir leicht dechiffrieren. Wir sehen also, dass das Ich-Erlebnis des Kühlschranks (auf das er sich einiges einzubilden scheint) im Grunde nur die Summe seiner Funktionen ist. Ja mehr noch: ein notwendiges Selbstmissverständnis des Kühlschranks. Denn er kann die Summe seiner Funktionen (auf dieser hohen Komplexitätsebene) nur noch unterhalten, wenn er denkt, er unterhalte sie für sich. Wir, die wir natürlich schlauer sind, haben gegen den Irrtum nicht das Mindeste einzuwenden. Soll er doch denken, was er will, mehr noch: Wir bestärken ihn sogar in seinem Irrtum, denn je mehr er von sich hält, desto besser kühlt er (und das ist letztlich das Einzige, was uns an dem Kühlschrank interessiert). Irgendwann wird unser denkender Kühlschrank auf die Idee kommen, dass es irgendeine Fortexistenz nach der Schrottpresse geben muss, weil ja sonst der höhere Eigensinn (also nicht unser Sinn, nämlich der der Kühlung) des denkenden Systems Kühlschrank fehle, seine Existenz also komplett umsonst war, was ihm denkerisch schlecht ankäme. Wir sehen das Problem (nämlich den Systemzusammenbruch) und bestärken den Kühlschrank, der sich als Idiot seiner selbst schon hinreichend zu erkennen gegeben hat, und stimmen ihm beim Öffnen und Schließen hinterlistig zu, wenn er von einer ideellen Fortexisten...