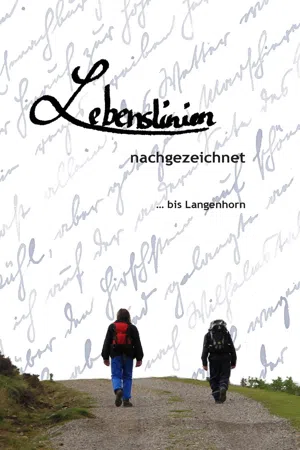![]()
Aufgezeichnet im Frühjahr 2014 von Birgit Wiedenmann-Naujoks
Im Frühsommer des Jahres 1928 erblickt Wilhelm in Swinemünde, der Stadt, die am Schnittpunkt der Inseln Usedom und Wollin liegt, das Licht der Welt. Vier Jahre später bekommt Wilhelm einen kleinen Bruder und nach weiteren vier Jahren eine kleine Schwester. 1928 beginnt die Weltwirtschaftskrise, die nachfolgend auch in Deutschland hohe Arbeitslosigkeit und großes soziales Elend bewirkt. Wilhelm bemerkt als Kind davon nichts, er hat eine wohlbehütete und glückliche Kindheit, die Familie muss keine Not leiden.
Innenansicht des väterlichen Geschäfts, 1947 von Wilhelm aus der Erinnerung gezeichnet
Der Vater hat in guter Lage mitten in der Stadt ein Geschäft für Spielwaren, Schreibwaren, Kunstgewerbe und Sportbedarf. Das Geschäft gehört in Kindertagen mit zum „Reich“ von Wilhelm. Peitschenkreisel und Brummkreisel sind zum Spielen vorhanden, mit dem Roller kann man die lange Geschäftsfront auf- und abfahren, es sind stolze 70 Meter. Es werden aber nicht alle Kinderträume wahr. Die wunderschönen, maßstabsgetreuen Schiffsmodelle aus Blei von Viking haben es Wilhelm schon früh angetan, zu gerne hätte er eines, nicht zum Spielen, denn dafür sind die Modelle nicht geeignet, aber zum Haben, zum Träumen. Wilhelm hat die Idee, sich zu Weihnachten und dem Geburtstag zusammen nichts außer einem solchen Modell zu wünschen, aber der Wunsch wird nicht erfüllt. Fünf Mark soll ein solches Viking-Modell kosten, das ist einfach zu teuer.
Über dem Geschäft hat der Großvater väterlicherseits die Waschküche gebaut, er ist Tischlermeister. In der Waschküche steht u.a. der große Waschkessel auf dem Feuer. Das Waschen aller Wäsche geschieht natürlich von Hand, die Wäsche wird mit Wäscheblau zum Strahlen gebracht.
In Swinemünde werden auf einer Werft alte Schiffe abgewrackt, viele Materialien werden aber woanders weiterverarbeitet. So erwirbt der Großvater die Decksplanken, die aus Teakholz sind, um aus ihnen Möbel und Gebrauchsgegenstände herzustellen. Oft sieht Wilhelm die Werke, die der Großvater aus Teak gearbeitet hat, und bis auf den heutigen Tag ist Teak Wilhelms Lieblingsholz. In späteren Jahren wird er sich alle Möbel und Einrichtungsgegenstände aus diesem Holz kaufen, weil er es so gerne mag.
In der Vorweihnachtszeit bekommen die Kinder „wichtige“ Aufgaben im Geschäft. Sie dürfen die Waren, die die Kunden sich ausgesucht haben, zum Packtisch tragen. Sie erfüllen diese Aufgabe mit sehr großem Stolz und Eifer.
In den Sommerferien verbringen die Kinder herrliche Zeiten bei den Großeltern mütterlicherseits in Wollin. Der Großvater besitzt eine Werft, dort können die Kinder wunderbar spielen. Auch wird oft das Ruderboot benutzt, um auf dem Dievenow-Strom zu rudern. Aber die Kinder lernen auch segeln. Zu Segelbooten umgebaute Ruderboote oder auch kleine Segelboote beherrschen die Kinder bald perfekt. Besonders stolz sind sie, als sie dem Großvater verkünden, dass sie nun auch das Wriggen beherrschen.
Panorama von Wollin, 1947 gezeichnet von Wilhelm
Der Vater hatte nach dem ersten Weltkrieg den Wunsch, Förster zu werden. Daraus wurde zwar nichts, aber ein guter Freund des Vaters ist Förster, und so verbringt die Familie auch viel Zeit dort. Dem jungen Wilhelm wird die Natur gezeigt, er lernt z.B. Flugbilder von Habicht und Mäusebussard unterscheiden und stromert oft lange in den herrlichen Kiefernwäldern Usedoms herum, um Wild und Natur zu beobachten. Ich meine förmlich, den harzigen Duft der Kiefern an einem Sommertag zu riechen, als mein Gesprächspartner erzählt. Ausgerüstet mit einem Fernglas und daheim mit dem „Neudammer Förster-Lehrbuch“ für angehende Förster hat er bald ein ansehnliches Fachwissen. So kann er beispielsweise die lateinischen Namen einiger Tiere und Pflanzen auswendig.
In der Volksschule ist ein guter Sportsfreund des Vaters der Klassenlehrer. Wilhelm gehört zu den fünf leistungsstärksten Schülern, welchen eine besondere Aufgabe zufällt. Sie korrigieren die Hausaufgaben der Mitschüler.
1938 wechselt Wilhelm von der Volksschule auf die städtische Oberschule für Jungen, die Tirpitz-Schule, und er kommt, wie alle anderen seines Jahrgangs, zum Deutschen Jungvolk, später natürlich auch zur Hitlerjugend. Die Uniform trägt er mit einem gewissen Stolz.
Am Gymnasium wird Wilhelms Klasse in Kunst von einem Kunstmaler unterrichtet. Wilhelm hat zum Malen und Zeichnen Talent, und so kann er alle Kniffe und Tricks in Bezug auf Perspektive, räumliche Darstellung usw., die der Kunstlehrer den Schülern zeigt, sehr gut umsetzen.
Der Schreibtisch von Wilhelm ist immer aufgeräumt, jedes Ding hat seinen festen Platz. Auch im zwischenmenschlichen Bereich spielen Regeln eine sehr große Rolle. Als der Vater eine Regel bricht, wird er vom Sohn über eine lange Zeit als Strafe für den Regelbruch gesiezt.
Als nach der Geburt der Schwester eine Tante verkündet :„Wilhelm, Deine Mutter hat heute früh ein Schwesterchen erwartet“, da korrigiert der Achtjährige sie ohne zu zögern: „Tante, die Mutter hat das Schwesterchen heute früh nicht „erwartet“, sondern „bekommen“, so muss das heißen.“ Von der Tante wird er daraufhin als „Klugscheißer“ bezeichnet.
Diese Ordnungsliebe behält Wilhelm sein ganzes Leben bei, Regeln und Ordnung werden immer eine wichtige Rolle spielen. Wilhelm sagt, er sei schon als „Pedant“ geboren worden.
Dennoch verfällt Wilhelm irgendwann in der Oberschule ein wenig der Faulheit, seine Noten werden schlechter, er bekommt „Nachhilfe“. Diese besteht allerdings nur darin, dass der ein paar Jahre ältere Schulkamerad Horst aufpasst, dass Wilhelm seine Hausaufgaben auch tatsächlich macht. Der gewünschte Erfolg stellt sich schnell ein.
Der Vater von Horst ist der Hausarzt der Familie, Horst selber wird später ein berühmter Arzt und Diabetologe werden. Der Hausarzt, Jude, ist aber zugleich auch ein Freund. Und so ist die Familie sehr verwundert, dass der Freund eines Tages von heute auf morgen verschwunden ist. Die nichtjüdische Ehefrau und die Kinder sind nicht verschwunden. Nach drei Wochen taucht der Freund plötzlich wieder auf und wird natürlich bekniet zu berichten, wo er war und was ihm in der Zwischenzeit widerfahren ist.
Aber der Freund schweigt. Über die Erfahrungen dieser drei Wochen wird er nie sprechen, er sagt lediglich, er sei im KZ gewesen und habe unter Androhung des Todes versprechen müssen, nie ein Sterbenswörtchen verlauten zu lassen.
Wilhelms Familie stellt nach dem Krieg Recherchen an, weil die Sache so merkwürdig ist. 1918 war Hitler in Pasewalk im Lazarett, um sich von seinen Verletzungen, die er bei einem Senfgasangriff erlitten hatte, kurieren zu lassen. Einer der behandelnden Ärzte war wohl eben dieser Freund. Und Hitler hat die Hilfe, die er von ihm erfahren hat, wohl nie vergessen, und so hat entweder Hitler selber oder Goebbels im Auftrag Hitlers die Freilassung von Horsts Vater angeordnet. Bis zum Kriegsende kann der Arzt daraufhin unbehelligt weiter in Swinemünde leben.
1936, also lange bevor der Krieg beginnt, werden die Geschäftsleute praktisch gezwungen, der NSDAP beizutreten. Der Vater umgeht diesen Zwang, indem er sich freiwillig zum Militärdienst meldet. Er hat so auch die freie Wahl, wo er eingesetzt werden möchte. Und als der Krieg beginnt, muss er nicht am Russlandfeldzug teilnehmen, sondern bleibt in Swinemünde auf der Festung Engelsburg stationiert.
Als das Memelland 1939 wieder mit dem Deutschen Reich vereint wird, reist Hitler auch durch Swinemünde. Die „Rückholung“ des Memellandes stößt in der Bevölkerung auf breite Zustimmung, und so wird Hitler an allen Stationen seiner Reise planmäßig bejubelt. In Swinemünde wird auch das Jungvolk zum Jubeln und „Heil“-Rufen abkommandiert. Wilhelm ist noch recht klein. Er wird von einem großen, fast schon erwachsenen Jugendlichen auf die Schultern genommen. So ist er beinahe auf Augenhöhe, als der Zug mit dem grüßenden Hitler langsam vorbeirollt. Wilhelm ist stolz, so einen guten Aussichtsplatz gehabt zu haben, aber er ist nicht begeistert, nicht emotional berührt, wie wohl viele andere.
Auch Wilhelms Mutter, überzeugt, dass Hitler ein „Mistkerl“ ist, will sich diesen Mann einmal aus der Nähe besehen und nutzt die Gelegenheit, als dieser durch Swinemünde reist. Hinterher sitzt sie tränenüberströmt zu Hause. Wilhelm kann sich nicht erklären, warum die Mutter denn so weint, und so fragt er nach. Ja, sagt daraufhin die Mutter, sie sei doch absolut gegen Hitler eingestellt, sie fände den Mann furchtbar, und dennoch habe sie beim Vorbeifahren Hitlers wie von Sinnen aus Leibeskräften „Heil“ gebrüllt, ganz gegen ihre innere Überzeugung. Dass das gemeinsame Jubeln so sehr mitreißend wirkt, findet sie sehr erschreckend. Die Massensuggestion wirkt also.
Wilhelm erhält Klavierunterricht, der ihm aber nicht sonderlich gut gefällt. Clementi empfindet er als Geklimper und nicht als erstrebenswert zu spielende Musik. So übt Wilhelm auch mehr halbherzig als intensiv. Ein Schulkamerad in späteren Jahren kann sehr gut Klavier spielen und ist wohl auch sehr talentiert. Er spielt eines Tages die Invention Nr. 8 in F-Dur von Johann Sebastian Bach, und als Wilhelm das hört, ist es für ihn wie eine Offenbarung, so klar, so wunderschön, so erhaben empfindet er diese Harmonien! Die tiefe Begeisterung für Bachs Musik soll das ganze Leben lang erhalten bleiben.
Am 21. März 1943 wird Wilhelm in der Christuskirche von Pastor Graeber konfirmiert.
Wilhelm wird 1943, wie so viele andere, sogenannter „Kriegsfreiwilliger“. Die angebliche Freiwilligkeit wird durch massiven psychologischen Druck erreicht. Pro forma werden die Anwesenden gefragt, wer sich nicht melden wolle. Die wenigen, die tatsächlich vortreten, werden dann vor versammelter Mannschaft nach allen Regeln der Kunst schikaniert und niedergemacht. Als Wilhelm das mitbekommt, erkennt er, wie aussichtslos es ist, sich aufzulehnen, und macht stillschweigend mit.
Die „Freiwilligen“ werden aber nicht einfach so zu Kriegsdiensten eingesetzt, sie werden dem ganz normalen Prozedere des Militärs unterzogen. Das heißt, sie alle müssen sich mustern lassen. Tatsächlich werden einige der Jugendlichen nicht als k.v., also „kriegsverwendungsfähig“, eingestuft. Die k.v. – Gemusterten empfinden trotz ihrer „unfreiwilligen Freiwilligkeit“ einen gewissen Stolz, ihrem Vaterland dienen zu können, die als nicht kriegsverwendungsfähig Eingestuften empfinden das als Makel.
Im Juli 1943 wird die Bevölkerung von Swinemünde evakuiert. Swinemünde ist Marinestützpunkt und somit für die Alliierten ein wichtiges Ziel. Die Familie von Wilhelm zieht nach Wollin zu den Großeltern mütterlicherseits. Der Schulunterricht findet aber nach wie vor in Swinemünde statt, und so muss Wilhelm tagtäglich einen je einstündigen Schulweg mit Bahn und Fähre bewältigen Da Wilhelm sich in Swinemünde von der Hitlerjugend ab-, in Wollin aber nicht wieder angemeldet hat, ist das Pensum zu schaffen.
Im Januar 1944 werden der gesamte Jahrgang 1928 des Gymnasiums sowie Lehrlinge als „Marinehelfer“ zur schweren Flak eingezogen. Die Jugendlichen müssen Soldatenarbeit verrichten, dazu gehört selbstverständlich auch das Hantieren mit den schweren Geschützpatronen. Wilhelm ist in der Flakbatterie „Ahlbeck“ am Stadtrand von Swinemünde stationiert. Dort ist die 10,5cm Flak aufgestellt, die Geschosse wiegen über 70 Pfund. Tagtäglich müssen diese schweren, unhandlichen Teile aus dem etwas entfernten Munitionsbunker geholt und in den Munitions-Schapps verteilt werden, die rund um das Geschütz angebracht sind. Aber auch als Befehlsübermittler werden die Jugendlichen eingesetzt. Da dies ein sehr verantwortungsvoller Posten ist, fühlen sich die Jungen ein wenig geehrt.
Die älteren, zwar erfahrenen, aber oft doch wesentlich ungebildeteren Soldaten, die hierarchisch natürlich über den Flakhelfern stehen, werden oft hinter vorgehaltener Hand allein schon wegen ihrer falschen Grammatik belächelt. Diese „Kritik“ geschieht natürlich verborgen. Absoluter Gehorsam ist oberstes Gebot.
Die Flakhelfer sind in Betonbunkern unter den Geschützen untergebracht. Dort befinden sich mehrere dreietagige Betten und für jeden ein kleiner Spind. Der Tag beginnt um sieben Uhr, es gibt ein gemeinsames Frühstück. Jeden Tag wird exerziert, marschiert und die Bedienung der komplizierten Flugabwehrkanone geübt. Jeder hat zwar den ihm zugewiesenen Posten, aber für den Fall, dass jemand ausfällt, muss man natürlich auch auf allen anderen Posten exakt Bescheid wissen. Wilhelm ist Richtkanonier. Ein Team von zwölf aufeinander eingespielten Soldaten und Flakhelfern bedient das schwere Geschütz. Wenn alles reibungslos funktioniert, kann alle fünf Sekunden ein exakt einjustiertes Geschoss mit klar definierter Höhe und präzise eingestelltem Zeitzünder abgefeuert werden.
Einmal pro Woche geht es zum Duschen in die Kaserne. Werktags ist vormittags, wenn nicht gerade Alarm ist, immer für die Gymnasiasten „dienstfrei“. Der Lehrer kommt in diesen Zeiten in die Batterie, um die Jugendlichen weiter zu unterrichten. Es gibt dann aber sehr bald die „Reifebescheinigung der Klasse 7“, das Kriegsabitur.
„Angst hat man damals nicht gehabt“, sagt Wilhelm auf meine Nachfrage. Selbstverständlich hätte man vom Verstand her erfasst, in welch einer gefährlichen Situation man sich befände, aber da man daran nichts ändern konnte, war es müßig, über diesen Umstand nachzudenken.
In der Familie von Wilhelm ist es üblich, sich zur Begrüßung zu küssen, zu umarmen, körperlich Vertrautheit zu zeigen. Eines Tages wird Wilhelm zum Tor gerufen, er habe Besuch. Der Vater von Wilhelm, Feldwebel, nimmt seinen Sohn in die Arme und küsst ihn, so, wie es immer Usus gewesen ist. Als Wilhelm aber in die Unterkunft zurückkehrt, begegnen ihm überall merkwürdige Blicke, so dass er schließlich nach der Ursache fragt. Schnell stellt sich heraus, dass die Vater-Sohn-Begegnung aus Sicht der Fremden eine Begegnung zwischen zwei Männern war: zwei Soldaten, Vorgesetztem und Untergebenem - und dass sich zwei Männer küssen….
Wilhelm, noch vollkommen ahnungslos, wird schnell über die Außenwirkung aufgeklärt, und fortan müssen Begegnungen zwischen Vater und Sohn ohne die sonst üblichen Rituale auskommen.
Im März 1945 steht die Flucht aus Wollin an – die Russen sind bereits bis an die Ostseite der Stadt vorgedrungen, nur der Fluss trennt die Russen noch von der Stadt. Auf dem Hof des großelterlichen Hauses befindet sich in einem Holzschuppen die Holzmiete, der Vorrat für den Winter zum Heizen, ein sehr großer Stapel. Der Bruder baut den Stapel Scheit für Scheit ab, gräbt da, wo zuvor der Holzstapel war, eine große Grube und versteckt hier Silber und Geschirr, um es möglichst nach der Rückkehr (man ging ja immer davon aus, dass das Verlassen der Heimat ein vorübergehender Zustand war) unversehrt wieder ausgraben zu können. Danach wird der Holzstapel wieder Scheit für Scheit in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt.
Und tatsächlich wird das so Versteckte nicht entdeckt. Wilhelm besitzt noch heute Besteck und Geschirr, das in diesem Erdloch versteckt war.
Am 12. März 1945 wird Swinemünde zur Mittagszeit in nur wenigen Minuten von mehreren hundert amerikanischen Bombern in Schutt und Asche gelegt. Da die Stadt zu diesem Zeitpunkt mit Flüchtlingen vollgestopft ist, gibt es weit über 20.000 Tote. Während des Angriffs tut Wilhelm Dienst. Seine Familie wähnt Wilhelm in Sicherheit. Eine Woche zuvor ist die russische Front bis Wollin vorgedrungen, die Familie ist, so denkt Wilhelm, bereits in Sallenthin und von dort weiter unterwegs nach Neubrandenburg.
Aus dem Gefechtsstand sieht Wilhelm eine Reihe von abgeworfenen Bomben explodieren, die genau auf den Gefechtsstand zuhält. „Nun ist es aus!“ durchzuckt es ihn – aber wie durch ein Wunder explodiert die letzte Bombe etwa 25 Meter vor dem Standort, dann hört die Bombenreihe auf.
Als er kurz darauf in dem furchtbaren Durcheinander in Swinemünde seine Eltern vor der Flakbatterie entdeckt, meint er, seinen Augen nicht zu trauen. Ja, sagt die Mutter, sie seien noch einmal umgekehrt, den furchtbaren Angriff habe man aber in einem Bunker unversehrt überstanden.
Die Stadt ist übersät mit Toten und Verwundeten. Besonders schlimm hat es den Kurpark getroffen, der baumbestanden ist und vielen Flüchtlingen zu einer kurzen Verschnaufpause gedient hat. Die hier abgeworfenen Bomben sind nicht erst am Boden explodiert, sondern bereits auf Höhe der Baumkronen. Die zerstörerische Wirkung der Explosion über dem Boden ist verheerend. Viele der Leichen sind regelrecht zerfetzt.
Kurz vor Eintreffen der Bomber ist Superintendent Brutschke unterwegs zu Pastor Graeber, als nur wenige Minuten nach dem Losgehen die Sirenen schrillen und er daraufhin umkehrt. Seinen Kollegen wird er nicht wiedersehen, dieser kommt bei dem Angriff ums Leben. Wäre er also nur etwas früher losgegangen, wäre auch er vermutlich getötet wo...