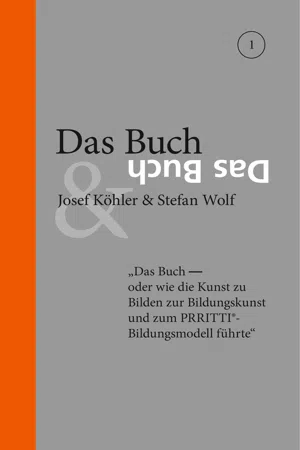![]()
TEIL DREI//
„Wollen wir glücklich sein, müssen wir Freiheit wagen, Autonomie erlangen, uns anerkannt und zugehörig fühlen.“
STEFAN WOLF
![]()
Lernen in der Welt und fürs Leben//
Lernen in Freiheit
Nichts bringt Menschen in ihrer Entwicklung weiter voran, als ihre eigenen Erfahrungen zu machen und Architekten ihres Lebens und ihrer Bildung sein zu können. Niemand würde sich gerne bevormunden lassen, ständig unterordnen oder sich mit Dingen beschäftigen, die ihn nicht interessieren. Wir möchten frei bestimmen können, unsere Meinung frei sagen und uns im Privaten wie Beruflichen in einem Rahmen bewegen, in dem wir frei gestalten können. Wir möchten wenig bis keine Einmischung von außen. Freiheit ist uns wichtig. 2009 haben auf eine Forsa-Umfrage im Auftrag von DBB Beamtenbund und Tarifunion 75 % der Befragten auf die Frage „Halten Sie es für zumutbar, dass Maßnahmen zur Erhaltung der inneren Sicherheit auch die Freiheitsrechte einzelner Menschen einschränken können?“ mit Nein geantwortet. Freiheit ist anscheinend wichtig, sie ist aber auch nötig. Menschen streben nach Autonomie. Es ist ein Grundbedürfnis.1 Freiheit ist eine unabdingbare Notwendigkeit für Lebensglück. Und sie hat eine Bedeutung für unsere Politik, für unsere Gesellschaft. Als Deutsche haben wir zudem nach 1945 ein besonderes Verhältnis zur Freiheit gewonnen. Wir haben ein vorbildliches Grundgesetz und nehmen aufgrund unserer Historie Freiheit und Demokratie ernst.
Eins ist allerdings merkwürdig: Theoretisch finden wir Freiheit wichtig, aber wenn wir wirklich die Wahl haben, entscheiden wir uns sehr oft für Konformität.
Salomon Ash hat bereits in den 50er Jahren mit seiner Konformitätsforschung die psychologische Abhängigkeit von Gruppenmeinungen nachgewiesen. Was andere sagen, hat mehr Gewicht als das, was sinnvoll oder korrekt wäre. Aber man will nicht alleine dastehen, eine einzelne, eine eigene Meinung vertreten.
Etwa zur gleichen Zeit hat Erich Fromm mit der Vorstellung eines normativen Humanismus aufgezeigt, dass der Ausdruck der eigenen Identität immer da an Grenzen stößt, wo Menschen innerhalb ihres sozialen Umfelds in ihm aufgehen wollen und sich, statt eigenständig zu agieren, angepasst, assimiliert und über die Grenze der Selbsterfahrung eigener Identität konform verhalten.
Seltsam daran ist: Frei wollen wir sein, aber sobald wir uns in unsicheren Umfeldern und Gruppen bewegen, wollen wir uns an den Überzeugungen anderer orientieren, um anstelle von Freiheit Sicherheit zu gewinnen.2
Das ist inkonsequent und verhindert letztlich, zufrieden und glücklich zu leben. Denn wollen wir glücklich sein, müssen wir Freiheit wagen, Autonomie erlangen, uns anerkannt und zugehörig fühlen. Das erkannte bereits Aristoteles. Aber anscheinend ist das für Erwachsene schwierig.
Kinder sind wesentlich unkomplizierter und gehen selbstverständlicher mit ihrer Freiheit um als Erwachsene, die sie bisweilen anstrengend finden. Das liegt im Wesen der Freiheit. Sie existiert nämlich nicht per se, sondern muss erkannt und genutzt werden, damit sie real wird. Unangenehm ist auch, dass sie uns nicht sagt, wie wir sie zu gebrauchen haben. Sie öffnet allenfalls einen Raum. Sie markiert den Bereich verschiedener Möglichkeiten, zwischen denen wir entscheiden können. Hätte man nur eine Entscheidungsmöglichkeit, wäre es keine Freiheit. Es wäre Zwang oder Alternativlosigkeit.
Mit Freiheit muss man also, ob man das will oder nicht, kreativ umgehen, um sie gestalten zu können. Sie schafft Möglichkeiten, aber legt die Verantwortung in die Hände der Menschen. Freiheit ist wie eine weiße Leinwand: Malen muss man selbst.
Und um es noch etwas komplizierter zu machen: Freiheit kann, folgt man Isaiah Berlins Essay Two concepts of Liberty aus seiner Berufungsrede als Professor in Oxford, „Freiheit wovon“ sein, also etwas, was zur Abgrenzung dient, wovon man sich befreien will, oder sie kann „Freiheit wozu“ sein3, also Freiheit, die in einer positiven Weltzugewandtheit Möglichkeiten nutzt und erschafft.
Es ist also nicht nur eine Frage des Erkennens und der Übernahme der Gestaltungsverantwortung und Kreativität, sondern auch eine Frage der Haltung, mit der jemand in den offenen Raum der Freiheit eintritt. Will ich von etwas weg, oder will ich zu etwas hin? Will ich mich abgrenzen oder in neu gewonnener Freiheit mein Leben gestalten?
Freiheit bietet aber in diesem Sinne die Möglichkeit der Suche nach der besten Lösung. Sie bewirkt Offenheit im Kopf, im Herzen und im Handeln. Es wäre auch deshalb großartig, sie so zu nutzen.
Mich irritiert, dass erwachsene Menschen, statt ein Leben in Selbstbestimmung und Freiheit zu leben, der Freiheit mit einer gewissen Angst, ja, manchmal auch Ablehnung gegenübertreten. Wir leben in Zeiten, in denen Freiheit nicht nur nicht genutzt, sondern aufgegeben wird. In der gegenwärtigen Phase des Postfaktischen und des Populismus verzichten Menschen freiwillig auf mühsam gewonnene demokratische Bürgerrechte und wenden sich stattdessen restriktiveren, abgrenzenden gesellschaftlichen Systemen zu. Aufgrund von Feindbildern, globaler Krisen und sozialen Herausforderungen meint man, dass Abschottung und Rückzug auf überschaubare Größen, wie religiöse Identität und Nationalismus, die Sicherheit bieten, die man gerne hätte. Am Ende wird man, so fürchte ich, erkennen müssen, dass Benjamin Franklin recht hatte, als er sagte: „Wer wesentliche Freiheit aufgibt, um eine geringfügige temporäre Sicherheit zu erlangen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“4
Für Kinder gilt das alles nicht. Kinder haben keine Angst vor der Freiheit. Sie gehen anders mit ihr um. Sie geben sie nicht auf. Sie fordern sie mit zunehmendem Alter sogar ein. Sie gestalten sie außerordentlich kreativ. Kinder leben in einer Welt der hunderttausend Möglichkeiten, der Phantasie. Wären da nicht ängstliche Eltern, würden sie sich noch viel mehr Freiheiten nehmen. Sie probieren aus. Sie entscheiden jeden Tag neu, wer sie (in ihrer Phantasie) sein wollen. Das nennt man „spielen“.
Freiheit als Spiel, mit der Freiheit spielen: Als Erwachsene wissen wir vielleicht noch, wie sich dies anfühlte. Wir erinnern uns, wie unbeschwert diese Momente waren, in denen die Zeit wie im Flug verging und wir sein und tun konnten, was wir wollten. Die glücklichsten Momente der Kindheit sind in der Erinnerung der Erwachsenen in der Regel die, in denen sie unbeobachtet spielen konnten.
Das Spiel unserer Kindheit war keine Flucht aus der Welt, keine „Freiheit wovon“, sondern Bestandteil unserer Welt. Es war auch nicht gegen etwas gerichtet, es war kein Gegenentwurf. Es war schön, harmlos und dennoch in jeder Beziehung wertvoll.
Doch dann passierte es. Mit sechs oder sieben: Einschulung. Diese Welt großer Freiheit wich dem „Ernst des Lebens“. Es wartete ein normierendes System auf uns, in dem das zweckfreie Spiel an den Rand gedrängt und zur Ausnahme erklärt wurde. Alles bekam eine Richtung, ein Ziel. Vorgegebenes wurde erlernt, Kulturtechniken geübt, Hausaufgaben erledigt. Alles in einer bestimmten Reihenfolge und mit dem Ziel, einen möglichst guten Schulabschluss in der Grundschule und dann auf dem Gymnasium – der Traum aller Eltern – zu erreichen. Und auch wenn sich das Abitur wie ein Triumph anfühlte, war dies erst der Anfang. Es folgten neue Aufgaben verbunden mit Stress und Druck im Studium, im Beruf. Das Leben drehte sich ab dem sechsten Lebensjahr für mindestens zehn, manchmal zwanzig Jahre in einem phantasielosen Kreis des Abarbeitens, bei dem man am Ende eigentlich wieder da ankam, wo man gestartet war: einer neuen Etappe mit einem neuen Ziel und größeren Erwartungen.
Spaß? Spiel? Gestalten? Kreativität? All das spielte kaum eine oder keine Rolle. Heranwachsen im Bildungssystem meiner Zeit hatte mit Freiheit und Glücklichsein der Lernenden, auch der Lehrenden nichts zu tun. „Muss das so sein?“, frage ich mich.
Viele von uns haben im konventionellen Bildungssystem einen unnötigen Verlust an Kreativität und Freiheit erlitten, und damit leider auch einen unnötigen Verlust an Selbstsicherheit und Identität. Das Säurebad, in dem sich dies auflöste, hieß „Leistung“. Damit verbunden „Leistungskontrolle“. Wir sind benotet, ständig verglichen und wenig gelobt worden. Und jeder Vergleich hat uns nur noch unsicherer und unglücklicher gemacht.
Nun habe ich nichts gegen Leistung, aber es ist die Frage, was man darunter versteht. Ist es lediglich eine Note oder ist sie Würdigung dessen, was mich ausmacht, was ich kann, was ich erreiche, wie sehr ich auch als Person gewachsen bin, welche Herausforderungen ich angegangen und wo ich über mich hinausgewachsen bin und was ich für andere getan habe?
Ich habe etwas gegen den Verlust der Einzigartigkeit jedes Menschen, seiner sozialen Intelligenz und Kreativität, die dann abhandenkommen, wenn Kinder und Jugendliche von außen an sie herangetragene Ziele erreichen sollen, zu denen nur ein Weg führt, ein Ergebnis abgeliefert werden muss und kein Spielraum, keine Freiheit mehr besteht, und keine Neugierde, kein Entdecken und kein Spaß mehr vorhanden sein muss. Aufgabe-Rechenweg-Ergebnis. Das ist das Unter-Richten, das „Abrichten“, über das sich nicht nur Thomas Sattelberger im Film Erich Wagenhofers mit dem Titel Alphabet zurecht aufregt. Dass dies so ist, ist die eigentliche Krise unseres Bildungssystems, gegen das unsere Idee einer menschenfreundlichen und kindgerechten Bildung aufbegehrt, einen anderen Weg gehen und dabei möglichst viele kindliche Tugenden bewahren möchte.
Was es dazu aber braucht, ist – Sie ahnen es – zu allererst Freiheit: Die Freiheit, als Kind seine Perspektive, seine Wahrnehmung, seine Beobachtungen, Meinungen und Ansichten entwickeln und ausdrücken zu dürfen, ganz im Sinne des erwähnten Rousseau’schen Verständnisses der Freiheit als Menschenrecht.
Kindern ist dies weder bewusst, noch ist es etwas, das sie von sich aus fordern oder einklagen würden, deshalb ist es so leicht, über ihre Bedürfnisse hinwegzugehen und ihnen ihre Natürlichkeit zu nehmen. Und auch, wenn wir sie vollends abgerichtet haben, sind sie erstaunlich resilient und nachsichtig mit uns Erwachsenen. Es ist ihnen eigen, dass sie – trotz allem – es zumindest versuchen, Freiheit zu leben, indem sie die Welt begreifen, erkennen und verstehen, von Geburt an in einem langsam zunehmenden Radius, und mehr und mehr diese Welt zu ihrer machen.
Erwachsene betrachten diesen gleichen Prozess der Weltaneignung, der übrigens niemals aufhört, manchmal so, als sei er abgeschlossen, so als hätten die „Großen“ alles verstanden.
Erwachsene meinen, beurteilen zu können, was zu erfahren und zu wissen notwendig ist. Das ist die Ursache dafür, dass sie langweilige Spielplätze gestalten, Curricula formulieren und durch Wiederholung erprobte Wege als normal oder gegeben setzen. Wer von diesen abweicht, verhält sich non-konform. Wer in die Schule kommt, wo Wissenserwerb überprüft und durch Noten sanktioniert werden darf, wird durch die Anerkennung dieser freiheitsbegrenzenden Setzung belohnt, wer sie nicht respektiert, wird bestraft.
Zugegeben, es ist leichter, sich an dem zu orientieren, was vorgegeben ist, als eigene Regeln zu erfinden. Ein Spiel, bei dem keine Spielregeln vorgegeben würden, ist nicht einfach zu spielen. Aber all dies bedeutet nicht, dass Kinder nicht diese Fähigkeit hätten, sie zu entwickeln.
Kinder gestalten in aller Freiheit ihre Welt, ohne immer im Vorhinein genau zu wissen, was dabei herauskommen könnte. Sie haben ein gesundes Verhältnis zu Fehlern. Wenn sie einigermaßen liebevoll aufwachsen, besitzen sie auch ein gesundes Selbstbewusstsein, das – außer durch Erwachsene – nicht zerstört werden kann.
Kindliches Spiel, das sind endlose Momente des Staunens und ein sich verlieren in der Phantasie des Augenblicks; für Kinder ist das Alltag. Nichts tun zu müssen und doch die Zeit zu nutzen, alles Mögliche zu tun, nur der eigenen Intuition folgend, Aneignung der Welt in all ihren Facetten, Fragwürdigkeiten, Gegensätzen, Herausforderungen und Chancen. Warum sollten wir auf etwas so Wertvolles verzichten wollen und Lernen, das in all dem spielerisch nebenher geschieht, gegen Eintönigkeit und Langeweile eintauschen?
Es gibt kein im Sinne der Persönlichkeitsbildung und Ausbildung eigener Identität sinnvolles Lernen ohne Freiheit. Nur so bildet sich über den Weg des spielerisch-kreativen Umgangs mit der Welt und in der Welt eine eigene Gestaltungskompetenz heraus. Für Erwachsene muss sie zurückerobert, beschrieben, systematisiert und reflektiert werden, dann erst können wir wieder glauben, was Kinder längst wissen: Freiheit ist ein Spielplatz der Erkenntnis. Hier entsteht die Neugier, forschend zu untersuchen, die Lust, schöpferisch zu handeln, und die Erfahrung, aufgrund von Scheitern und Gelingen den eigenen Weg zu finden.
Das vorliegende Buch betrachtet die Vorüberlegungen, die zur Grundlegung eines neuen Bildungsmodells geführt haben, dem PRRITTI-Bildungsmodell. Dieses Modell ist ein Paradigmenwechsel des (schulischen) Lernens, weil es auf der Grundlage von Freiheit und daraus resultierenden Freiräumen zur Förderung der eigenen Gestaltungskompetenz die Praxis des Lernens anders organisiert. Interessant daran ist, dass sich das Modell an Ideen anlehnt, die es schon lange gibt und damit an sich keine überraschend neuen Erkenntnisse beinhaltet. Innovativ und momentan unvergleichlich wird es durch seine konsequente Systematisierung und Ordnung wichtiger Voraussetzungen gelingenden Lernens, also dessen, was Lernen im Kern ausmacht. Es schaut den Kindern über die Schulter, versucht ihren Perspektiven zu folgen und sie im Entdecken der Welt sinnvoll zu unterstützen.
Die Entwicklung dieses Modells geschah weder zufällig noch voraussetzungslos. Die Ideen erwuchsen aus persönlicher Erfahrung, die mich zum Beispiel aufmerksam und sensibel für gelingendes und misslingendes Lernen im klassischen, öffentlich-rechtlichen Schulsystem gemacht haben. Aber auch die reflektierten und ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem Lernen aufgrund der Kontakte und Themenfelder, die wir als Autoren kannten, haben dem Finden der Systematik des Modells enorm geholfen.
Josef Köhler, bildender Künstler und Bildungskünstler, und ich, Theologe und Geschäftsführer einer Bildungsstiftung, haben uns nach vielen unabhängigen Wegen, Umwegen und Abwegen auf einer gemeinsamen Kreuzung wiedergefunden und, wenn auch nicht gewusst, so doch geahnt, dass unsere unterschiedlichen Erfahrungen die Qualität von etwas Neuem in sich tragen, das nun nach langer Inkubationszeit ins Leben gebracht wurde und Gestalt gewinnen konnte. Wir haben 2015 eine Grundschule eröffnet, die ihrerseits auf einer in Grundzügen bereits seit 2008 bestehende Praxis des Lernens in einer Kindertageseinrichtung in Nordrhein-Westfalen beruht. B...