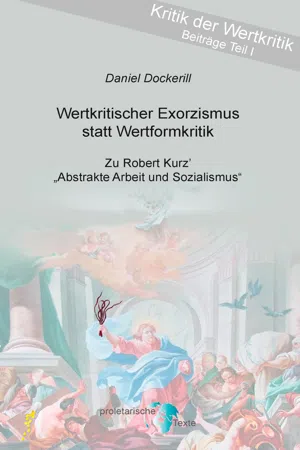![]()
Wert und Arbeit – oder der Kurze Dualismus von Raum und Zeit
Nach dieser weiteren Lektion über die vor allem methodischen Abgründe zwischen Marxens Analyse der Ware und dem vorliegenden Versuch einer „Kritik des Werts selber“ wird uns nun endgültig „das eigentliche Problem“ enthüllt, über das der werttheoretische Neuerer bei der „qualitative[n] Bestimmung des Werts“ gestolpert ist: „nämlich das der ‚Vergegenständlichung‘ von Arbeit.“ (66) Es ist bis hierher, das sei noch einmal ausdrücklich festgehalten, noch keine „analytische Differenzierung“ der Arbeit selbst passiert, die in den Waren (problematisch oder nicht) vergegenständlicht ist. Das „Problem“ der Vergegenständlichung betrifft demnach zunächst grundsätzlich alle Aspekte der Arbeit. Worin liegt nun das Problem?
Nun ja, wo Robert Kurz recht hat, da hat er recht. Sieht man einmal davon ab, dass die „wirkliche, lebendige“ Arbeit, wenn sie Waren produziert, gerade nicht so ohne weiteres „gesellschaftliche“ Arbeit ist und das „System von Verhältnissen“ daher den Wertcharakter der Arbeitsprodukte, die spezifische Weise, wie Arbeit gesellschaftlich wird, den besonderen Ausdruck der gesellschaftlichen Arbeit immer schon einbegreift – sieht man davon ab, so ist es keine Frage: Arbeit ist Prozess, Bewegung, Veränderung in der Zeit. In ihrem Resultat (ob als Wert betrachtet oder als bestimmter nützlicher Gegenstand) ist die Veränderung abgeschlossen, der Prozess vergangen, die Bewegung zum Stillstand gekommen, tot; es ist in der Zeit (in gewissen Grenzen) sich nicht mehr Veränderndes, sich selbst Gleichbleibendes. Aber wo ist da ein „Problem“?
Ein Problem haben zunächst wir mit der Kurzschen Argumentation, denn auch sie kommt an dieser Stelle zwar nicht endgültig zum Stillstand, aber doch deutlich ins Stocken, sie verstummt gewissermaßen für einen Moment und kann nur noch an unser stilles Einvernehmen, unseren gesunden Menschenverstand appellieren. Kurz zitiert Marx, der sagt:
und erklärt dazu:
und als zweifle er an unseren Lesekünsten, buchstabiert er noch einmal: „der Wert soll geronnene Arbeitszeit sein!“ – Na und, fragen wir bockig, was ist daran „paradox“? Der Meister, schier verzweifelnd, rettet sich ins Lateinische:
Ende der Diskussion.
Wir sind somit unversehens bei der hochgradig philosophischen Frage des Zusammenhangs von Zeit und Raum an sich gelandet, in der Kurz nun allerdings überhaupt kein Problem mehr zu sehen vermag: Es gibt da für ihn keinen inneren, Zeit und Raum jeweils an sich berührenden Zusammenhang; Zeit ist Zeit, und Raum ist Raum – basta.
Jedoch wird, was nur mit relativ großem Denkaufwand aus seiner starren Gegensätzlichkeit gelöst werden kann, ist es erst einmal auf solche philosophischen Höhen geschraubt (wie hätte man sich so etwas vorzustellen: die Objektivierung der Zeit im Raum?)53, sofort elastisch und biegsam, sobald man es wieder in den konkreten Zusammenhang stellt, aus dem es genommen war. Ein Arbeitsprozess, der nie zum Ende käme, für immer und ewig prozessierte, wäre weder Arbeit noch überhaupt Prozess, sondern gedankenlose, leere Abstraktion. Dass ich vom Arbeitsprozess als einem bestimmten Ganzen, als „Prozess“ sprechen kann, schließt ein, dass er endlich ist, also ausgeht vom Nichtprozesshaften und übergeht in ebensolches; der Zustand, den er aus einem anderen erzeugt, macht ihn erst zum Prozess. Das Nichtprozesshafte ist also Bestimmung des Prozesses selbst, wie umgekehrt der Zustand, da er nicht aus dem Nichts in die Welt hereingeschneit kommt, sondern entsteht und vergeht, selbst auch bestimmt ist als prozesshaft – eben entstanden, bzw. wieder aufgehoben. Weiter. Da es sich um Arbeit handelt, und zwar um „wirkliche, lebendige“ Arbeit, ist der Prozess unvermeidlich zweckgerichteter gegenständlicher Prozess, gegenständliche Verwirklichung eines Zweckes. Gegenständliches wird zweckmäßig verändert und zwingt dabei der verändernden Tätigkeit, die ihm die Gesetze des bestimmten Zweckes aufprägt, seine eigenen Gesetze auf. Der tätige Zweck vergeht also nicht nur schließlich im umgeformten Gegenstand als objektivierter Zweck oder zweckmäßiger Gegenstand, sondern schon in seinem Tätigsein ist er von Anfang an, bei Strafe der Zweckverfehlung, dem Gegenstand unterworfen. Kurz und gut: die Vergegenständlichung ist nicht nur keine paradoxe Bestimmung der Arbeit, sie ist im Gegenteil unverzichtbare, notwendige Bestimmung an ihr.
Nun hat zwar Kurz sein „Problem“ der Vergegenständlichung ausdrücklich auf die „wirkliche, lebendige“ Arbeit bezogen, die er obendrein als arbeitsteiliges „System“ und damit als konkret nützliche fasst, aber es geht ihm eigentlich ja um die im Wert vergegenständlichte Arbeit. Als solche ist die Arbeit, wie wir gesehen haben, nicht die konkrete Arbeit, die das konkrete in den Austausch eintretende Produkt hergestellt hat,54 sondern nur noch eine bestimmte, nach ihrer Dauer quantifizierte Menge der Zeit, die von einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitskraft unter normalen Produktionsbedingungen für die Herstellung dieser oder jener Warenart aufgewendet werden muss. Die Ware selbst ist als Träger von Wert nicht mehr einzelnes, konkretes Ding, sondern „Durchschnittsexemplar ihrer Art“55. Arbeit und Gegenstand sind hier rein gesellschaftlich bestimmt.
Das „eigentliche Problem“, das Kurz zwangsläufig entgehen muss, weil er statt konkreter Analyse äußerliches Beziehen fertiger analytischer Kategorien treibt, ist also weder das Gerinnen von Zeit überhaupt noch das Gegenständlichwerden menschlicher Subjektivität in ihrer Betätigung. Auch darin, dass die Produkte der Arbeit eine gesellschaftliche Bestimmung erhalten, sich in ihnen ein gesellschaftliches Verhältnis objektiviert, steckt an sich kein Problem. Wenn das feudale Verhältnis von Herr und Knecht die Gestalt von Naturalien annimmt, die der Knecht dem Herrn liefert, so bleibt deren gesellschaftliche Bestimmung völlig durchsichtig. „Der dem Pfaffen zu leistende Zehnten ist klarer als der Segen des Pfaffen.“56 Gegenständlicher Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses ist die Sache hier nur unmittelbar in diesem Verhältnis selbst, d.h. in ihren Beziehungen zu Herr und Knecht. Was dagegen die Wertgegenständlichkeit so rätselhaft macht, ist allein ihre sachliche Form, ihr Erscheinen als Verhältnis der Produkte, das aus deren sachlichen Eigenschaften entspringt. Als Wert ist die Ware nur eine bestimmte Menge vergegenständlichter gesellschaftlicher Arbeit, sie drückt aber dieses ihr Wertsein nicht nur an sich als einzelnem Ding nicht aus, sondern auch nicht in ihrem konkreten Dasein als Arbeitsprodukt und nützlicher Gegenstand, weil sie unmittelbar Produkt ungesellschaftlicher, privater Arbeit ist. Die Beziehung in der die Ware Wert ist, d.h. ihre Beziehung zur gesellschaftlichen Arbeit ist vermittelte Beziehung, weil die gesellschaftliche Arbeit selbst nicht unmittelbar existiert, sondern nur vermittelt über den Austausch der Produkte der privaten Arbeiten. Ihr Wertsein drückt die Ware daher unmittelbar aus in ihrer Beziehung zu anderer Ware.
Diesen Ausdruck des Werts aber, seine Form, hatte Kurz soeben (als „Form in zweiter Potenz“) für die Betrachtungen des Wertbegriffs ins zweite Glied verwiesen und quält sich nun mit der Wertgegenständlichkeit „an der einzelnen Ware“ ab. Aus der Analyse der Erscheinungsform ergibt sich zunächst als ihr wesentlicher Inhalt die Unterscheidung zwischen einerseits je konkret nützlicher und andererseits abstrakt gleicher menschlicher Arbeit. Diese hier ignorierend, kann Kurz folglich die der Wertgegenständlichkeit zugrundeliegende Arbeit nicht bestimmen, d.h. sie wird gedankenlos falsch, konfus bestimmt als gesellschaftliche und konkret nützliche in einem. Das „Gespenstige“ der Wertgegenständlichkeit, von dem Marx spricht und das sich ihm ausdrücklich aus dem spezifischen Charakter der im Wert vergegenständlichten Arbeit ergibt, bezieht Kurz daher ebenfalls falsch, nämlich auf das Vergegenständlichen von Arbeit, ja schließlich von Zeit überhaupt. Und am Ende kann er sich nur noch wundern, warum das „Paradoxe“ daran weder von Marx noch sonst von irgendeinem Menschen vor ihm bemerkt wurde. Nach seiner dogmatischen Verdammnis des Marxschen Ausdrucks der „festgeronnenen Arbeitszeit“ als ungereimten Teufelszeugs fährt er fort:
Kurz ist also verblüfft, und das wäre „an sich“ Gelegenheit, innezuhalten und sein Urteil zu überdenken. Jedoch ist, wer sich erleuchtet fühlt, selten durch menschliche Fragen und Zweifel aus der Bahn zu werfen. Auch Kurz sieht keinen Anlass, wenigstens der Frage nachzugehen, warum er denn mit seiner Erregung über das angebliche Paradoxon so alleine steht, sondern ist nur um so mehr überzeugt, „dass gerade hier ‚der Hund begraben liegt‘“. Also frisch ans Werk! und „genau an dieser Stelle“ den „Hebel angesetzt … um die bisher nicht gelungene theoretische und praktische Kritik des Werts selber in Gang zu bringen.“ (67)
Metaphorisches: Gegenständlichkeit der Arbeit
Um den Hund auszugraben, sei „allererst zu klären, welche Art von Arbeit bzw. ‚Arbeitszeit‘ hier eigentlich ‚gerinnen‘ soll.“ Wir dürfen demnach hoffen, dass Kurz, wenn auch etwas spät, nun doch endlich die Marxsche Unterscheidung zwischen konkreter und abstrakter Arbeit irgendwie zur Kenntnis zu nehmen gedenkt. Die Formulierung „Art von Arbeit“ macht freilich sofort wieder misstrauisch, denn abstrakte Arbeit, wie Marx sie aus seiner Analyse gewinnt, ist bestimmter Aspekt jeder besonderen „Art von Arbeit“ und folglich selber im Grunde keine solche.
Freilich „wäre“ er dann offenbar doch nicht als er selbst, nämlich als „Begriff“, sondern, wie Kurz uns unverzüglich verdeutlicht, „als bloße Metapher zu nehmen“, was nun wiederum ziemlich problematisch ist, denn Metaphorik ist wohl so ungefähr das Letzte, wozu ein derart abstrakter, verallgemeinernder, vollkommen unanschaulicher Terminus wie „Vergegenständlichung“ sich eignet. Die „durch Arbeit hervorgerufenen stofflichen Veränderungen am Produkt“ jedenfalls werden durch die „Metapher“ der Vergegenständlichung von Arbeit keineswegs anschaulicher.57 Im übrigen setzt Kurz uns nicht auseinander, von welcher anderen möglichen Auslegung sich seine Interpretation des fraglichen Ausdrucks „als bloße Metapher“ abgrenzt. Er scheint damit lediglich kundzutun, dass dieser ihm eigentlich überhaupt nicht schmeckt. Vergessen wir also zunächst die Metaphorik und sehen weiter zu, wie Kurz zum Sprung von der Arbeit zum Wert ansetzt:
„Klar“, sonnenklar gewissermaßen, wird hier vor allem, dass auf die Entwicklung der Schlussfolgerungen, zu denen Kurz seine immer noch wohlmeinende Leserschaft führen möchte, sich zusehends dicker werdender Nebel senkt. Hatte unser Wertkritiker noch wenige Zeilen zuvor es abgelehnt, mit der Analyse des Tauschwerts zu beginnen, weil ein solcher Ausgangspunkt angeblich „immer nur zum quantitativen Aspekt zurückführen“ könne,58 so gerät ihm nun die Quantifizierbarkeit schlechthin zum Kriterium wertsetzender Arbeit, ohne dass der qualitative Aspekt ausgeleuchtet, die zu quantifizierende Qualität irgendwie bestimmt wäre. Von der durch menschliche Arbeit umgeformten „Natur des Planeten“ irrlichtert Kurz zum „jeweils einzelnen Produkt“. Mit dem Wert haben beide – ob nun quantifizierbar hinsichtlich der für sie verausgabten Arbeit oder nicht – an sich nichts zu schaffen, solange sie nicht Produkt in der spezifischen Form der Ware sind. „Klar“ ist daher des weiteren, dass wohl „ein jeweils einzelnes Produkt“, kaum jedoch die „Natur des Planeten“, wie auch immer bearbeitet, Warenform annehmen, d.h. in den Austausch gebracht werden kann, es sei denn, dass sie vielleicht im eines Tages installierten intergalaktischen Handel verhökert würde.
Das „einzelne“ Produkt andererseits ist als Ware nicht mehr einfach Einzelnes, sondern nur mehr Exemplar je seiner Sorte. Und wenn nun gar sein Wert ins Spiel kommt, hat es vollends seine Individualität verloren, ist bloß noch Gleichartiges unter Gleichen, Produkt überhaupt. Namentlich die zu seiner Herstellung erforderliche Arbeit hat jeden Anspruch auf individuelle Rücksichten restlos verspielt, sie gilt nur noch, soweit sie Äußerung durchschnittlicher Produktivität ist, ganz gleichgültig, wie produktiv sie wirklich war, wieviel individuelle Arbeitszeit also die Herstellung des Produkts gekostet hat. Robert Kurz mag daher „die für ein jeweils einzelnes Produkt ‚aufgewendete’ Arbeit“ so sorgfältig quantifizieren, wie er will, er kommt damit der wertsetzenden Arbeit keinen Flohsprung näher. Dies nicht deshalb, weil etwa die je bestimmte Quantität, das ermittelte Quantum Arbeitszeit, „auf keinen Fall“ gegenständlichen Ausdruck im Produkt erhalten könne, wie Kurz behauptet. Das Weben von Leinwand beispielsweise drückt seine individuelle Quantität, d. h. die vom Weber webend zugebrachte Zeit in der Länge der Stoffbahn hinreichend handgreiflich aus. Aber dieses Quantum – gegenständlich oder nicht – hat unmittelbar rein gar nichts zu tun mit dem Quantum Wert, d.h. dem Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit, welches das Produkt als Gegenstand des Austausches repräsentiert. „Klar“ wird daher zum dritten, dass Kurz in der Forschung nach der „Art von Arbeit“, die dem Wert zugrundeliegt, uns hier auf eine völlig falsche Fährte gesetzt hat; etwas unklar bleibt eigentlich nur, ob in didaktisch verdunkelnder Absicht, oder weil er es wirklich nicht besser gewusst hat.59
Die Versuchung ist natürlich groß, an dieser Stelle unseren eigensinnigen Pfadfinder in seinem Nebel allein weiter stochern zu lassen und sich dankbareren Beschäftigungen zuzuwenden. Jedoch blamieren sich heutzutage an den Fundamenten der Kritik der politischen Ökonomie auch jede Menge anderer Figuren, ohne dass es in den diversen darum herum sich rankenden Diskursen bemerkt würde. Jene Wissenschaft ist in der Linken, die ihr soviel verdankt, offenbar so gründlich in Vergessenheit gefallen, dass in der neuerdings wieder etwas in Mode gekommenen Rückbesinnung auf sie die Absonderung alles nur erdenklichen Blödsinns erlaubt zu sein scheint. Die Kurzsche Variante besitzt immerhin den Vorteil, dass sie mit besonderer Akribie schwarz auf weiß vorführt, welche kuriosen bis grotesken Missverständnisse und Irrtümer die heutige, mehr oder weniger fundamental wertkritische Art der Rezeption der Marxschen Warenanalyse (es ist die einzige, die wir haben) notwendig zeitigt, wenn sie sich gelegentlich über ein paar zusammenfassende Bemerkungen aus der Marxschen Fetischkritik hinauswagt auf das Feld der analytischen Entwicklung solcher Schlussfolgerungen.60 Geben wir also ruhig zu, dass wir außerhalb der Kurzschen Nebelsuppe auch nicht unbedingt klüger sind, und tauchen unverdrossen weiter in sie ein, in der berechtigten Hoffnung, dass nach ihrer Durchquerung ein Stück wirklicher Klärung uns belohnt!
Schauen wir uns zunächst noch einmal an, was wir bisher zu fassen haben. Kurz präsentierte uns „ein jeweils einzelnes bestimmtes Produkt“ (den umgeformten Globus sind wir glücklicherweise schon wieder los) sowie die dafür „,aufgewendete‘ und insofern durchaus quantifizierbare Arbeit“. Das Produkt, insofern es das „stoffliche Resultat“ der Arbeit ist, dürfen wir auch als deren Vergegenständlichung bezeichnen, aber – bitte sehr! – bloß metaphorisch, nicht buchstäblich, wirklich. Ferner hat die Arbeit eine quantitative Seite (ihre zeitliche Dauer) die sich, ...