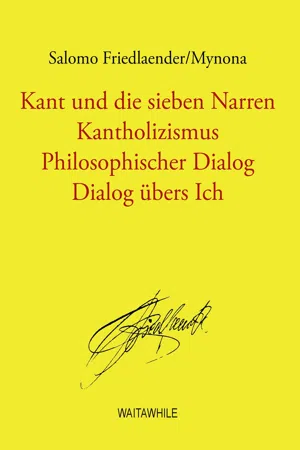
- 268 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kant und die sieben Narren
Über dieses Buch
Drei bisher unbekannte Dialoge und eine utopische Groteske aus dem Nachlaß. Kant und die sieben Narren diagnostiziert in einem präzisen Rundumschlag den sorgfältig kultivierten Defekt der Moderne -Historismus, Relativismus, Psychologismus, Vitalismus usw. In einer Heilanstalt kuriert Kant Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, James, Bahnsen, Keyserling, Husserl, Steiner sowie viele andere akademische Zeitgenossen.Der kurze Philosophische Dialog und die Utopie Kantholizismus, sowie der vermächtnishafte Dialog übers Ich (1943 auf winzigen Zetteln notiert), führen in brillanter Weise Friedlaender/Mynonas spätephilosophische Position vor.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kant und die sieben Narren von Salomo Friedländer/Mynona im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Geschichte & Theorie der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kant und die sieben Narren Ein Philosophiegeschichtchen
Alle Übel der Menschheit an ihrer Wurzel zu packen und auf einmal auszureißen, war man entschlossen. Das dazu einberufene Komitee, die Delegierten des Erdbundes der Geistigen, trat zusammen. Rasch gelangte man dazu, das Grundgebrechen beim Namen zu nennen: es gab noch keine einheitliche geistige Orientierung, der Consensus sapientium fehlte. Hingegen bestand wehrhaft und nahrhaft der Consensus desipientium, und zwar unter dem Vorsitz eines Mannes, der sich über jede neue Auffassung des Lebens, ja sogar über Beweise der Unmöglichkeit jeder von Herzen freute. Das nannte er ‚Einstellungen‘, und er hielt es auch für eine interessante Einstellung, wenn man gegen ihn zu Felde zog; er ließ also, unter anderm, auch die Behauptung der absoluten Wahrheit als ‚Einstellung‘ gelten. Ihm war jedwede Lebensinterpretation recht. Bis er jetzt auf einmal voller Schrecken merkte, daß man gerade diese Weitherzigkeit für das Grundübel hielt, das man ausrotten wollte. Man bestand plötzlich auf Einigung, ohne die, wie man klagte, die Menschheit schizophren und katatonisch bliebe. Dem gegenüber nahm er ‚den Standpunkt der Standpunktlosigkeit‘ ein, der Gleichwertigkeit sämtlicher Interpretationsmöglichkeiten. Aber man überstimmte ihn. Ein Mensch mit bis zum Hinterhauptloch gehender Stirn brüllte, die Einstellungen seien der konzentrierte Blödsinn, sie neutralisierten einander zum Nichts. Der Kampf drohte, in Handgreiflichkeiten auszuarten. Da erhob sich ein kleiner Mann mit schiefer Schulter und rief so entschieden „Silentium“, daß Todesstille eintrat:
„Ich bin“, behauptete das Männlein, „der Professor Kant aus Königsberg.“ Er stellte seinen roten Regenschirm in eine Ecke und fuhr fort: „Ich proponiere die Errichtung eines Heilhauses für verirrte Philosophen. Ich verpflichte mich, sie in dieser geistigen Kaltwasserheilanstalt wieder auf ihre Beine zu bringen. Die Wahrheit, meine Damen und Herren, steht nachgerade auf dem Kopf. Die richtige Orientierung besteht längst, ist aber so verteufelt geschickt unter jene Einstellungen versteckt, daß man sie schwerlich von ihnen unterscheidet. Wir befinden uns in einem Labyrinthe mit unsichtbar gemachtem Ariadnefaden; ich will ihn sichtbar machen.“
Der Präsident lachte gequält: „Als ob es nicht ebenso viele Orientierungen wie Köpfe gäbe! Halt jeder kommt daher und offeriert seine als die allein richtige. Tot capita quot sensus. Was will man dagegen machen?“
„Hier ist“, entgegnete der Königsberger, „die Rede nicht von Sensus, sondern von Ratio, und die gibt es entweder eindeutig, oder es gibt keine. Das Dritte ist ausgeschlossen. Und wenn man die nicht bald entdeckt, dann werden sich die Capita und die Sensus in lauter Irrsinn verwandeln, wozu sie bereits auf dem Wege sind.“
Zwar wollte der Präsident widersprechen, aber die Majorität ließ ihn nicht mehr zu Worte kommen. Man stimmte ab, und es stellte sich heraus, daß man das Sanatorium für kranke Philosophen erbauen wollte. Man wählte den alten Kant zum Direktor: „Sieben Weise“, dankte dieser und nahm die Wahl an, „rühmte sich das Altertum nach. Gebt mir sieben Narren, und ich verbinde mich, sie durch meine Methode zu sieben Weisen auszuheilen.“
*
An der Ostsee wurde in der Nähe von Königsberg ein Turmbau mit sieben Sektoren errichtet. Man gelangte durch eine imposante Halle in einen glasüberdachten Innenhof, und von diesem Mittelpunkte aus überwachte der alte Professor Kant sorgsamst die sieben Zellenbewohner, die man, sobald der Professor sie entließ, durch sieben andere ersetzen wollte. Gab es doch genug Narren auf den philosophischen Kathedern. Einmal, versprach Kant, würde man sie alle, alle richtig orientiert haben. Er verhieß ein neues Zeitalter der Menschheit. Man würde dann genau erfahren, was man wissen könne, wie man handeln solle, und was man hoffen dürfe. Der geistige Völkerbund vertraute der Prophezeiung des alten Mannes. Was auch konnte er besseres tun! Es war die letzte Zuflucht, seitdem der politische Völkerbund durch die zahllosen Weltkriege, die er nicht rechtzeitig verhütet hatte, auf den Hund gekommen war. Die Verzweiflung war zur geistigen Sintflut angestiegen, welche schlimmer war als einst die wässerige. Im Schnabel des alten Kant witterte man den Ölzweig der Gesundung und setzte alles Hoffen auf das Gelingen des Plans.
Der alte Kant redete nicht viel, sondern handelte. Im Innenhof des Turms fühlte er sich außerordentlich wohl, ordnete seine Kartothek und beaufsichtigte die sieben ersten Patienten, die er sich aus dem Gros der desorientierten Philosophen ausgewählt hatte. Jeden Morgen machte er, von handfesten Wärtern begleitet, seine Runde. Denn nichts gleicht der Tobsucht eines Philosophen, der seine Prinzipien bekämpft, ja widerlegt sieht.
An einem schönen Februartage, den roten Regenschirm unter den Arm geklemmt, begab sich Kant zur Zelle Nr. eins. Er klopfte an. Eine Stentorstimme rief: „Herein! Herein nur immer!“
„Gratuliere,“ sagte Kant und trat ein, „Sie haben heute Geburtstag, Freund Schopenhauer.“
„Wer Teufels denn sind Sie, der Sie meinen Geburtstag kennen, aber nicht achten. Wie würden Sie sonst wagen, meine Morgen-Meditation mit so futilen Erinnerungen an ein zufälliges physiologisches Ereignis zu perturbieren! Ich danke Ihnen, aber heben Sie sich hinweg!“
Lächelnd ließ Kant sich unweit des goldenen Buddha in einem Lehnstuhl nieder: „Sie haben neben den alten Indern und dem göttlichen Platon auch mich zu Ihren Heiligen erhoben. Aber wahrscheinlich habe ich nicht den Vorzug, indisch oder platonisch auszusehen, sonst würden Sie mich sofort erkennen. Ich heiße Kant und möchte mit Ihnen sprechen.“
Erblassend wich Schopenhauer zurück: „Sie sind Kant? Sind Sie’s wirklich, leibhaftig? Verzeihen Sie mir! Sie wissen, wie erschüttert ich bin, ich freue mich und möchte vor Ihnen in die Knie sinken. Sie kennen mein Gedicht: ‚Ich sah dir nach in deinen blauen Himmel, im blauen Himmel dort verschwand dein Flug ...‘“
„Keine solche Schwärmerei, mein Lieber,“ bat Kant, „ich mag das nicht. Sondern zur Sache! Was haben Sie aus mir gemacht? Ihr Geisteszustand beunruhigte mich, und ich ließ Sie deswegen hier internieren.“
„Daß man die Wahrheit gern interniert,“ sagte Schopenhauer, „das weiß ich, ahnte aber nicht, daß Kant es ist, der mir so übel mitspielt. Zeit meines Lebens habe ich neben Upanishaden und Platon nur Kant veneriert, dessen Werk ich durch das meinige vervollständigt habe.“
Kant nahm ein Pries’chen aus seiner Tabatière und streckte sich im Sessel aus: „Ich möchte Sie darüber interviewen, lieber Schopenhauer. Ihre Werke sind rhetorisch-dichterisch verfaßt. Ihr Stil hat Kraft und Saft, Fleisch und Blut; nur das Knochengerüst scheint mir gebrechlich. Die Wohlgestalt der Sprache täuscht oft über die Mißgestalt der Logik. Wie konnten Sie über die von mir so scharf gezogene Grenze der Erfahrung voltigieren? Erklären Sie mir das kurz und knapp!“
„Es sei!“ räusperte sich Schopenhauer stark, „aber wahrlich, man muß schon Kant selber sein, um das von mir zu erreichen. Ich nehme diese Zumutung nur von Ihnen hin. Fragen Sie! Aber stellen Sie meine Gutmütigkeit auf keine zu harte Probe!“
Kant lachte fröhlich: „Vor allem Dank, daß Sie das Gewäsche der drei Sophisten, Fichte, Schelling und Hegel von mir abgetan haben. Es hat mich aber stutzig gemacht, daß Sie aus der unwesentlichen Differenz zwischen der ersten und der zweiten Auflage meiner Kritik ein solches Wesens machten. Sie haben mich indisch-platonisch mißverstanden. Raum und Zeit sind kein Schleier der Maja, sondern echte Bedingungen der Erfahrung. Erscheinung ist nicht Schein.“
„Aber doch kein Ding an sich!“ brüllte Schopenhauer, „das ist der Wille, verstehen Sie? Der Wille, wie er sich im Geschlechts ...“
„Akt,“ ergänzte Kant, „ich weiß, mein Lieber, am brennendsten zu erkennen gibt. Lieber Schopenhauer, damit haben Sie den Sigmund Freud gezüchtet, und darauf braucht vielleicht ein Spezialpsycholog, aber kein Erkenntniskritiker stolz zu sein. Bitte regen Sie sich ab! Ihre Irrtümer sind lehrreicher als die Sophistereien der Neukantianer.“
„Irrtümer?“ knurrte Schopenhauer, „widerlegen Sie mich doch!“
„Gern,“ sagte Kant und stellte den roten Schirm zwischen seine Knie, „aus dem Affekt, der bei mir vom Ding an sich her in die reine Sinnlichkeit, d. i. in Zeit und Raum einfällt, machen Sie ein Datum der physiologischen Sinnesorgane. Aus diesen Daten konstruieren Sie wie aus einer Wirkung die Fremdkörper als Ursachen. Aber man konstruiert doch keine Ursachen! Man kann doch nur gegebene Veränderungen als Ursachen erkennen. Der Fremdkörper ist keine in den Raum projizierte Vorstellung, sondern selbst ein Raum und so unmittelbar erkannt wie der Leib.“
Schopenhauer glotzte bärbeißig und schwieg. „Sie können nichts erwidern,“ sagte Kant, „Sie sind ein ehrlicher Mann, und das ist mehr wert als aller Triumph über andre. Sie haben meine Kategorienlehre nicht verstanden, weil Sie naiv irrten, daß zur Anschauung Begriffe nicht vonnöten wären. Sie haben Ihre Einfälle keiner kritischen Kontrolle unterworfen, weil Sie wähnten, Anschauung sei unmittelbar selbstevident. Sie haben dadurch die Nietzsches, Spenglers u. a. traurige Epigonen auf dem Gewissen. Vor allem aber überschreiten Sie die Grenzen der Erkenntnis, indem Sie das Ding an sich mit dem Willen, mit einer sinnlichen, weil zeitlichen Erscheinung identifizieren, mit dem physischen, dem Naturwillen. Den Vernunftwillen kennen Sie nicht, haben also den kategorischen Imperativ nicht kapiert; aber auch noch nicht einmal Ihren Naturwillen haben Sie verstanden. Im Gegensatz zur gesamten übrigen Naturkausalität wirkt der Naturwille prognostisch, d. h. niemals ohne Vermittlung durch Vorstellung und deren Kausalkraft. Sie aber lassen den Willen erst die Vorstellung erzeugen, ohne die er überhaupt kein Wille wäre. An die Stelle der unsterblichen Seele, die der Theolog behauptet, setzen Sie den unsterblichen Willen. Das ist dogmatisch vorkritische Ontologie. Natürlich können Sie die Entstehung der Welt auf eine einheitliche Kraft als Ursache zurückführen. Aber daß diese Kraft ein Wille sei, ist absolut unbeweisbar. Passen Sie auf, wie ich selber das mache! Versuchsweise will ich auf Sie eingehen. Auch ich gründe das Dasein eines Ding an sich, eines Noumenon, auf einen Willen ...“
„Hoho!“ brummte Schopenhauer, „ecco!“
„Moment!“ wehrte Kant ab, „dieser mein Wille ist nicht Ihr blinder Triebwille, sondern der apriorische ethische Gesetzeswille. Das Ich dieses Willens ist Ding an sich, Noumenon. Dieses Ding an sich aber beweise ich praktisch, rein dynamisch, weder unmittelbar noch mittelbar anschaulich. Sie haben das nicht begriffen, und so sind Sie zu Ihrer unhaltbaren Ethik und barbarischen Religion gekommen.“
Schopenhauer sprang auf und raufte sich die grauen Schläfenhaare: „Mitleid also“, schnaubte er, „wäre unsittlich? Und Buddha Barbar!“
„Bitte,“ bat Kant, „setzen Sie sich in jeder Beziehung. Hören Sie mich besser, als Sie mich gelesen haben. Aus Mitleid hat man schon Verbrechen begangen. Wenn Sie die echte sittliche Triebfeder, das Vernunftgesetz, durch Mitleid ersetzen, lähmen Sie den sittlichen Willen. Sie lähmen ihn auch durch Ihren Pessimismus. Der kategorische Imperativ, der weder mitleidig noch grausam ist, sondern rein sittlich, gebietet die Glücksförderung, die Verbesserung der Welt. Sie verhindern das, indem Sie Weltschmerz verbreiten und dadurch noch mehr Leiden verursachen, als es ohnedies gibt. Indien war seit Jahrtausenden durch sittenwidrige Zustände unglücklich. Dieses Volk fürchtete sich, wiedergeboren zu werden – eine sonderbare Angst, welche gewiß nicht begründet ist. So verneinte man den Willen und tötete das Fleisch ab. Wo ist der Beweis, daß das hilft? Verordnet man sich zu solchem Zwecke schwere Leiden, so kann man der Abtötung sicher sein. Ob aber die so zweifelhafte Wiedergeburt dadurch verhindert werde, kann man nicht wissen. So ein indischer, keineswegs kategorischer, sondern abergläubischer und lächerlich barbarischer Imperativ, der tief unsittlich ist, gebietet die Unglücksförderung als Mittel einer zweifelhaften Seligkeit. Kopernikus und ich haben besser umgekehrt als solche Verkehrtheiten.“
Schopenhauer, das Haupt nach hinten überlehnend, schloß die Augen und flüsterte: „Horribel!“
„Gewiß,“ bekräftigte Kant, „entsetzliches Unheil haben Sie angerichtet. Nicht nur haben Sie die jungen Leute dazu verführt, alberne Vorkehrungen gegen die Wiedergeburt zu treffen, sondern Sie haben einen Kerl obendrein hochgezüchtet, dem Ihr indischchristliches Abrakadabra, Ihr asketisches Ideal so toll mißfiel, daß er den Kant mit dem unsaubren Bade dieser Asketerei zusammen ausgeschüttet und Ihr widervernünftiges Ideal ins womöglich noch absurdere Gegenteil umgedreht hat, den ‚dionysischen‘ Nietzsche, Ihr betörtes Opfer. Sehen Sie...
Inhaltsverzeichnis
- Motto
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ein Altkantianer in Paris. Unterwegs zum transzendentalen Polarismus, von Detlef Thiel
- Kant und die sieben Narren. Ein Philosophiegeschichtchen
- Kantholizismus. Utopie
- Philosophischer Dialog zwischen einem Vernunftmenschen und einem Naturmenschen
- Dialog übers Ich
- Nachweise und Anmerkungen
- Verzeichnis der Abbildungen
- Literaturverzeichnis und Abkürzungen
- Namenverzeichnis
- Sachverzeichnis
- Waitawhile
- Impressum