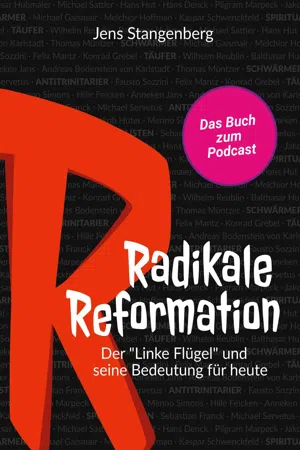
- 320 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
500 Jahre Reformation. Ein guter Anlass, um sich die Ereignisse, Themen und Personen aus der Reformationszeit in Erinnerung zu rufen. Häufig sind nur die Namen der großen Reformatoren bekannt: Martin Luther, Johannes Calvin oder Huldrich Zwingli. Weniger bekannt ist der "Linke Flügel" oder die sogenannte "Radikale Reformation". Schon damals wurden viele innovative Überlegungen angestellt, die jedoch leider nicht breitflächig zum Zuge kamen. Anhand von einzelnen Kurzbiographien wird die Vielfalt der Reformationsdynamik dargestellt und in die heutige Zeit verlängert.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Radikale Reformation von Jens Stangenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Christentum. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
#41 Schwärmender Christus - Ein Traum von Kirche
In dieser letzten Folge möchte ich eine positive Gedankenreise machen. Die Leitfrage lautet: Wie könnte die Gestalt von Kirche aussehen, wenn wir versuchen, jahrhundertealte Fallgruben zu vermeiden?
Dabei komme ich auf die Anfangsbehauptung zurück: Struktur ist Botschaft. Wenn beispielsweise von Mitbeteiligung gesprochen wird, man aber eine starre Hierarchie vorfindet, ist das unstimmig. Ebenso, wenn von einer Willkommenskultur die Rede ist, tatsächlich aber eine strukturelle Ausgrenzung Anwendung findet.
Im Nachfolgenden werden wir (1) uns die seit 2000 Jahren bekannten Problemfelder ansehen, (2) uns einige, für die Struktur wichtige, biblische Aussagen vor Augen führen, (3) die Kirchengeschichte in Erinnerung rufen und (4) eine moderne Analogie suchen, die all diese Beobachtungen versucht zu berücksichtigen.
I. Problemanzeige
Was sind die typischen Konfliktzonen, wenn es darum geht, eine christliche Gemeinschaft zu formieren? Strukturelle Unstimmigkeiten entstehen immer dann, wenn Kirche sichtbar wird. Solange wir von einer weltweiten unsichtbaren Kirche sprechen, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie aber wird das Abstrakte konkret? Wie sieht eine Gemeinschaft von Gläubigen in einem ganz bestimmten Kontext aus? Welche soziale Formierung bildet sich heraus? Bei dem Thema „Sichtbar werden“ geht es um viele Faktoren: Gruppengrößen, Strukturen, Versammlungsorte, Entscheidungswege. Gemeinschaften entwickeln innere Ziel- und Steuerungslogiken, eine Art Verhaltenskodex, der das Selbstverständnis der Gruppe bestimmt.
Dabei muss man sich klar machen: Jede soziale Gestalt sendet eine Botschaft aus. Die selten gestellte Frage lautet: Welche strukturelle Botschaft hat eine christliche Gemeinschaft? Fromme Worte und gute Taten laufen ins Leere, wenn nicht die gemeinschaftliche Struktur selbst Christus gemäß ist. Direkter formuliert lautet die Frage: Was unterscheidet eine christliche Gemeinschaft von einem religiösen Kulturverein oder von einer am spirituellen Markt orientierten kirchlichen Sinngebungsfabrik?
Mir stehen vier Bereiche vor Augen, die in besonderer Weise reflektiert werden müssen.
1) Identität
Um eine Gruppe zu sein, braucht es etwas, das die Teilnehmer verbindet. Wenn es das nicht gibt, ist es nur ein loser Haufen. Sobald aber eine Gruppe eine Identität ausbildet, erzeugt sie gewöhnlich eine Grenze. Es gibt Innen und Außen. Zu dieser Grenze gehören Grenzmarkierungen, englisch: boundary markers. Im Tierreich markieren Hunde ihr Gebiet, indem sie in gewissen Abständen an Bäume und Laternenpfähle pinkeln. Sie setzen Duftmarken. Bei Menschen gibt es andere Markierungen: Bestimmte Kleidung, bestimmte Slang-Worte oder eine gewisse Art der Begrüßung.
Wenn wir über eine speziell christliche Gemeinschaft nachdenken, ist die Frage: Was hält diese Gemeinschaft zusammen? Der Glaube an Jesus? Wer jahrelang in der praktischen Gemeindearbeit unterwegs ist, weiß, dass es oftmals ganz andere Gründe gibt: z.B. das gewohnte Gebäude, die kirchliche Musik, die konkrete Aufgabe, die religiöse Aura der Liturgie, das Sonntagsprogramm, die netten Leute oder pastoralen Leitfiguren. Vielleicht ist es auch einfach nur Gewohnheit oder sogar Trägheit.
Im Zusammenhang mit Gruppenidentitäten begegnet uns das Phänomen der Absonderung. Draußen das Andere, die Welt, das Fremde, das Böse. Drinnen zwar nicht immer Harmonie, aber doch Bekanntes und Vertrautes. Wie offen kann eine Gemeinschaft sein, ohne beliebig zu werden? Wann schlägt das Thema der Zugehörigkeit in Ausgrenzung um? Und wann werden Gruppendynamiken zu struktureller Gewalt? Kann man überhaupt Identität denken, ohne sich abzugrenzen?
2) Regeln
Wie schon angedeutet, gibt es innerhalb von Gruppen sogenannte Steuerungslogiken. Möglicherweise sind es konkrete Personen, die sagen, „was Sache ist“. Oder es ist eher eine Art von Verhaltenskodex, wie bei den Mönchsorden. In deren Ordensregeln ist transparent formuliert, was die Grundlage der Gemeinschaft ist. Eine solche Transparenz ist hilfreich.
Vielfach sind Regelsysteme aber unsichtbar. Man spürt, was man tun soll oder besser sein lässt. Es gibt Kleingedrucktes. Dieses kommt immer dann zum Tragen, wenn eine Grenze übertreten wird. Oft weiß man erst im Nachhinein, was nicht erlaubt war. Häufig geht es um moralische Grenzziehungen, um Überprüfbarkeit der Lebensführung, um Richtig und Falsch und um die daraus folgenden Konsequenzen. Auch Mitgliedschaftsfragen spielen hier mit hinein. Natürlich haben auch Gemeinschaften, die ganz viel von Freiheit sprechen, solche inneren Regelsysteme. Je mehr sie das bestreiten, desto unreflektierter scheinen sie zu sein.
Auch hier ist wieder die Frage: Was unterscheidet eine christliche Gemeinschaft von einer anderen Gruppe? Anhand welcher Kriterien, werden einzelne reglementiert? Wie dynamisch sind solche Regelsysteme? Und wer legt sie fest? Natürlich soll nach evangelischer Überzeugung alles von der Bibel her begründet und bewertet werden. Wie schwierig das aber ist, müsste bereits deutlich geworden sein.
3) Ordnung
Mit Ordnung meine ich hauptsächlich Rangordnung. Manche nennen es auch Schöpfungs- oder Naturordnung. Häufig geht es um eine vertikale Schichtung. Sind einzelne Gläubige Gott näher als andere? Natürlich würde das sofort bestritten werden. Aber wie lässt sich die Überzeugung der „Gleichheit vor Gott“ strukturell im Beziehungsgeschehen einer Gemeinschaft abbilden?
Der griechische Begriff für eine heilige, gottgegebene Ordnung ist „Hierarchie“. Dabei geht es um Machtverteilung und Entscheidungswege in einer Gruppe. Wer bestimmt, was getan wird? Wer setzt sich durch? Wer wird bei solchen Prozessen beteiligt oder aber übersehen? Das Thema „Religiöse Macht“ ist ein dunkles Kapitel. Allzu leicht lässt sich die Ausübung von Macht mit einer göttlichen Beauftragung begründen. Selbst Machtmissbrauch könnte mit geistlichen Eingebungen legitimiert werden.
Um so wichtiger ist die Frage, wie die Themen Leitung, Macht und Ordnung in einer Christus gemäßen Gemeinschaft strukturell zu leben sind. Wenn sich Gott in Christus selbst erniedrigt hat und dieser ein Jesus ähnliches Verhalten von seinen Jüngern erwartet, was bedeutet das dann für die Gestalt von Gemeinde?
4) Richtung
Vor nicht allzu langer Zeit überfiel mich eine scheinbar einfache Frage: Sie lautet: Wo ist vorne? Viele Gottesdiensträume haben ein Vorne. Meist steht dort der Altar oder die Kanzel. Die Stühle sind dementsprechend ausgerichtet. Auf diese Weise wird unser religiöser Lebensraum geordnet. Auch Leiter stehen vorne. Dann sind sie Vorsteher. Wenn sie sitzen, haben sie den Vorsitz. Wenn wir es abstrakter fassen, sind sie ein Vorbild. Immer geht es um die Frage des Vorne. Wohin ist unser Blick gerichtet?
Im Change-Management findet man häufig folgende Methodik: Es geht um einen Dreischritt nach vorne. Mache als Erstes eine Standortbestimmung. Als Zweites kläre, wo du hin willst, also wo „dein“ Vorne ist. Und als Drittes plane die Etappen auf dem Weg dorthin. Das klingt ziemlich einleuchtend. Ähnlich werden heutzutage Gemeinden beraten. Sie entwickeln Leitbilder und Fünf-Jahrespläne, so als könnte man dadurch dem Reich Gottes näher kommen.
Was wäre aber, wenn wir uns gar nicht auf das Reich Gottes zubewegen können, sondern uns dieses von hinten überrascht? Was wäre, wenn das angepeilte Ziel gar nicht fixierbar ist, sondern sich ständig bewegt? Haben wir es mit einem wechselnden Vorne zu tun? Die Frage nach der Entwicklungsrichtung einer christlichen Gemeinschaft wird immer schwieriger, je mehr man sich hineinvertieft. Ekklesia semper reformanda, eine Gemeinschaft, die sich beständig reformiert, die dynamisch ist, in der der Status Quo nicht heiliggesprochen wird und in der immer eine Öffnung über das Sichtbare hinaus besteht. Wie lässt sich das strukturell abbilden?
Wir sind immer noch bei der Problemstellung. Haben wir es möglicherweise mit einer Aufgabe zu tun, die sich gar nicht lösen lässt? Muss Kirche mit diesen permanenten Unstimmigkeiten leben? Macht es überhaupt Sinn zu träumen?
- Von einer Gemeinschaft, die zwar sichtbar, aber nicht statisch ist.
- Mit einem klaren Selbstverständnis, aber ohne Abgrenzung.
- Nicht bewertend, aber auch nicht beliebig.
- Geordnet, aber nicht in einer hierarchischen Weise.
- Mündig, vielfältig und reflektiert.
- Mit Ausstrahlung, aber ohne übergriffig zu werden. Geht das?
II. Aussagen der Bibel
Was sind die großen biblischen Leitlinien und was ist neu am Neuen Testament?
Die Bibel erzählt Gottes Geschichte mit den Menschen. Diese Geschichte beginnt in einem Garten, dem Garten Eden, und endet in einer Stadt, dem neuen Jerusalem. Der biblische Gott ist ein Weg-Gott. Abraham zog aus in ein neues Land, dann der Exodus: Israel wurde aus Ägypten geführt, die Stiftshütte als mobiles Zeltheiligtum, immer in Bewegung. Dann eine Zwischenphase mit Königen, eher eine Notlösung, weil der eigentliche König Gott selbst bleibt. Später das Exil in Babylon. Eine völlig neue Umgebung. Dann die Synagogenkultur. Kleinere Lerngemeinschaften entstanden.
Dieses war das Umfeld, in dem Jesus auftrat. Obwohl er nicht studiert hatte, wurde er Rabbi genannt. Er lehrte „auf dem Weg“ und auf der Straße, selten in Gebäuden. Und er rief auf einen neuen Weg, hinein in seine Nachfolge. Als Auferstandener begleitete er die Emmanus-Jün-ger - auf dem Weg. Jesu Lehre war an vielen Stellen auffällig gegenläufg zu üblichen Ansichten: Wahre Leitung ist dienstbereit. Zugang zum Reich Gottes wie die Kinder. Erste werden Letzte sein. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber gleichzeitig mitten unter euch. Man kann nicht darauf zeigen, als wäre es hier oder dort und doch sind die Wirkungen direkt vor Augen. Alles ziemlich paradox.
Später beschrieb Paulus die Gemeinde als Leib Christi und den menschlichen Körper als Tempel des Geistes. Die Verortung des Heiligen in einem Gebäude ist damit vollständig dekonstruiert. Warum wird das bis heute nicht ernster genommen?
Ich möchte sechs Bereiche nennen, in denen das Neue Testament Neues bringt:
1) Dynamische Wahrheiten
Vom Ende des Steintempels war schon die Rede. Die Linie der organischen Bilder lässt sich verlängern. Paulus sprach von Lebendigen Steinen und von einem Lebendigen Opfer. Im 1. Korintherbrief wird sogar von Christus als dem mitwandernden Felsen gesprochen. Was für ein geheimnisvolles Bild. An all diesem erkennen wir, dass im Neuen Testament ursprünglich statische Begriffe aufgenommen und vitalisiert, also mit Leben gefüllt werden. Das hat weitreichende Konsequenzen: Wahrheit ist keine tote Substanz, kein religiöses Ding und kein statischer Standpunkt. Sie lässt sich nicht besitzen und verwalten. Wahrheit ist lebendig und personal.
2) Relationale Ethik
Weil Wahrheit in einer Person verkörpert wird, ist auch die neutestamentliche Ethik kein Regelkatalog. Das ist eine der Neuheiten, anders als beim alttestamentlichen Gesetz. Der Apostel Johannes sprach in den Briefen vom Gebot der Liebe als dem einzigen neuen, aber zugleich alten Gebot. Es geht um beziehungssensible, umsichtige Liebe. Liebe grenzt die umfassende Freiheit, die durch die Gnade gekommen ist, sinnvoll ein. Deswegen ist Freiheit nicht Rücksichtslosigkeit. Neutestamentliche Ethik ist Kontext bezogen und ergibt sich aus der Relationalität zum Mitmenschen. Dabei geht es immer um das Wohl des anderen.
3) Intrinsische Motivation
Ein Leben, das nicht durch externe Regeln bestimmt wird, lässt sich in unserer Welt äußerst schwer denken. Aber genau davon reden bereits die alttestamentlichen Propheten. Sie beschreiben es, dass Gottes Gebote in unser Herz geschrieben werden. Keiner muss mehr den anderen belehren, weil jeder von innen her weiß, was richtig ist zu tun. Man sollte diese Vision nicht vorschnell als unrealistisch abtun. Denn genau darum geht es im Neuen Testament: Gottes Geist leitet uns von innen her in die göttliche Wahrheit.
4) Entgrenzung
Jesus wurde in einer Region mit schlechtem Ruf geboren. Mit seinem öffentlichen Auftreten wurde er beständig beliebter. Nacheinander übertrat er religiös-kulturelle Grenzen. Nicht weil er per se Grenzen ablehnte, sondern weil er aus der Enge in die Weite führen wollte. Mit seinem Auftreten öffnete er das Denken und den Horizont. Es ging um Reinheitsvorschriften und das Verständnis des Sabbats. Er heilte, wo es keine Hoffnung gab. Und er lud die Ausgegrenzten ein, mit ihm zu essen. Selbst den Himmel beschrieb er als offenes Festmahl. Ganz zum Schluss wurde er selbst ausgegrenzt und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Damit brachte er das Heil endgültig zu den Außenseitern und stellte die Welt auf den Kopf.
5) Entmittung
Der Begriff „Entmittung“ ist eine Wortschöpfung. Indem Jesus aus dem religiösen Zentrum, Jerusalem, ausgestoßen wurde, dezentrierte er das Heilige. Und als nach seiner Himmelfahrt die Jünger staunend stehen blieben, hinterließ er eine leere Mitte. Der zwar umherwandernde, aber dennoch zentralisierte Jesus war fort. Mit dem Kommen des Geistes geschah eine atemberaubende Dezentralisierung des Auferstandenen. Von nun an entstand überall dort immer neu eine heilige Mitte, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt waren. Es gab keine bevorzugte Richtung mehr. Vielmehr war es ein Ausströmen, ein Ausschwärmen in alle Richtungen zugleich. Die Grenze zwischen Heilig und Profan war aufgelöst. Von nun an konnte die ganze Welt geheiligt werden.
6) Entäußern
Das deutsche Wort „Entäußern“ ist geheimnisvoll. „Sich äußern“ meint, aus sich herauskommen, aus dem Innern ins Außen treten. „Entäußern“ meint demnach, dass das Außen abgeschafft wird. Wenn Christus sich entäußert hat, dann heißt es, dass es in seiner Person kein feindliches Außen mehr gibt. Er begegnet jedem Menschen als Freund, selbst Judas, der ihn verriet. Diese Entäußerung Gottes ist Ausdruck...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Dank
- #01 Einführung - Warum dieser Podcast entstanden ist und worum es gehen soll
- #02 Überblick - Zeitraum, Regionen, Deutungslinien und Benennungen
- #03 Unterteilungen - Von Schwärmern, Spiritualisten, Antitrinitariern und Täufern
- #04 Andreas Bodenstein von Karlstadt - Was ist die richtige Geschwindigkeit für Reformen?
- #05 Thomas Müntzer - Radikal für Freiheit und Gerechtigkeit
- #06 Exkurs ins 12. Jh.: Joachim de Fiore - Eine kühne Geschichtskonzeption und ihre Folgen
- #07 Der Bauernkrieg - Kommunaler Befreiungskampf des “gemeinen Mannes”
- #08 Die Kraft der Utopien - Neues nicht nur erträumen, sondern aktiv in Angriff nehmen
- #09 Exkurs ins 20. Jahrhundert - Über die Aktualität der „sozialen Frage“
- #10 Melchior Hoffman - Streitbare Laienpredigt und täuferische Flächenwirkung
- #11 Das Täuferreich von Münster - Religiöser Massenwahn oder Zufluchtsort für Verfolgte?
- #12 Reich Gottes in vier Mustern - Zwischenbilanz: Reflexion der Konfliktdynamiken
- #13 Kaspar Schwenckfeld - Verfechter eines “mittleren Weges”
- #14 Sebastian Franck - Erleuchtete Vernunft und die Geschichtlichkeit von Wahrheit
- #15 Exkurs: Erasmus von Rotterdam - Humanismus in seiner besten Form
- #16 Antitrinitarier - Gegen blinden Glauben und für eine vernünftige Religion
- #17 Zwischenbilanz - Von Ketzern lernen: Acht Kriterien für eine ideale Kirche
- #18 Täuferbewegungen - Überblick über Varianten, Selbstverständnis und Themen
- #19 Erste Glaubenstaufen in Zürich - Konrad Grebel und der Beginn der Täuferbewegung
- #20 Das Martyrium der Täufer - Von der systematischen Ausrottung widerständiger Christen
- #21 Wilhelm Reublin - Aufstieg und Niedergang eines Täuferführers
- #22 Balthasar Hubmaier - Der praxisorientierte Theologieprofessor unter den Täufern
- #23 Die Schleitheimer Artikel - Michael Sattler und der Weg in die Absonderung
- #24 Augsburger Täufersynode - oder: Hans Hut und die Erwartung des Endgerichts
- #25 Hans Denck - Ausstieg aus Wortgezänk und Frontenbildung......
- #26 Pilgram Marpeck - Gutes aus der Anfangszeit erhalten und Extreme vermeiden
- #27 Fundamentalismus? - Reformatorische Autorität und der Griff nach dem Absoluten
- #28 Jakob Huter - Die Hutterer und das Leben in Gütergemeinschaft
- #29 Exkurs: Vorreformatoren - Petrus Valdes, John Wyclif, Jan Hus und ihre sogenannten Ketzereien
- #30 Christlicher Anarchismus - Peter Chelčický und die Auslegung der Bergpredigt
- #31 Menno Simons - Die Mennoniten und die Tradition der Friedenskirchen
- #32 Frauen - Ursula Jost, Hille Feicken, Anneken Jans und Helena von Freyberg
- #33 Allgemeines Priestertum - Kampfansage an die kirchliche Hierarchie
- #34 Vieldeutige Bibel - oder: Von der Pluralisierung der Bibelauslegung
- #35 Streit um die Taufe - “Säuglingstaufe” oder “Glaubenstaufe” – bis heute ungelöst
- #36 Orientiert an Jesus - Zwischen Sadduzäern, Zeloten, Essenern und Pharisäern
- #37 Obrigkeit und Widerstand - Gehorsamspflicht und berechtigte Herrschaftskritik
- #38 Krieg und Friedensethik - Verweigerung der Schwertgewalt und gewaltloser Widerstand
- #39 Gemeindezucht und Bannpraxis - Zwischen starren Regeln und subjektiver Beliebigkeit
- #40 Persönliches Fazit - Begeistert, genervt, frustriert und hoffnungsvoll
- #41 Schwärmender Christus - Ein Traum von Kirche
- Anhang: Teaser-Texte | Podcast
- Literatur
- Impressum