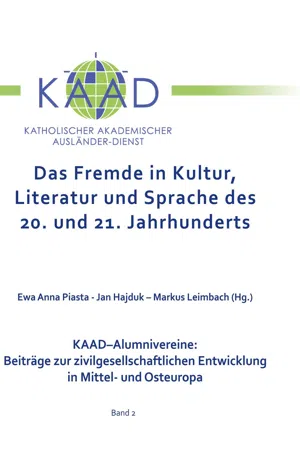
eBook - ePub
Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts
KAAD-Alumnivereine: Beiträge zur zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Mittel- und Osteuropa
- 280 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts
KAAD-Alumnivereine: Beiträge zur zivilgesellschaftlichen Entwicklung in Mittel- und Osteuropa
Über dieses Buch
Der vorliegende Band ist eine Dokumentation der Vorträge der Internationalen Alumnikonferenz des Katholischen Akademischen Ausländerdienstes (KAAD) "Das Fremde in Kultur, Literaturund Sprache des 20. und 21.Jahrhunderts" die im September 2017 an dem Fremdsprachenzentrums der "Jan-Kochanowski-Universität in Kielce stattgefunden hat.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts von Ewa Anna Piasta,Jan Hajduk,Markus Leimbach im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politische Freiheit. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Sprache
JERZY ŻMUDZKI [LUBLIN]
DER TRANSLATOR UND DIE FREMDHEIT IM TRANSLATIONSPROZESS
Die im Titel meines Beitrags genannten Kategorie-Begriffe stehen in einer natürlichen Relation zueinander. Denn sowohl der Translator als auch die Fremdheit verdanken ihre spezifische Existenz bzw. ihr Vorkommen der eigentümlichen prozessualen Determinanz und Dynamik eines jeden Translationsprozesses in der Weise, dass sich speziell die Fremdheit nicht nur aus den translationsstrategisch gesteuerten Evaluationen ergibt, sondern dass sie auch aus den für diesen Prozess typischen und notwendigen Transzendenzen in ihrer relationalen Verflochtenheit und Differenziertheit resultiert. Ihre Identifizierung und Interpretation ist erst im Rahmen eines kompletten Translationsgefüges möglich, was nur vor dem Hintergrund des anthropozentrischen Paradigmas der polnischen anthropozentrischen Translatorik von F. Grucza erfolgreich vorgenommen werden kann. Das Verständnis der Fremdheit resultiert in erster Linie aus dem Bezug auf den Translator als Subjekt dieses Prozesses und Zentrum der Gesamtkonstellation, die den Charakter eines paradigmatischen Basisgefüges besitzt, und zweitens aus der Einbindung des Initiators der Translation und des ZS-Adressaten in die Interpretationsperspektive. Im Fokus der Motivation für die nachfolgenden Überlegungen und Analysen stehen zwei Äußerungen von Helga Hirsch, einer renommierten Übersetzerin der polnischen Literatur ins Deutsche, und Michał Paweł Markowski, einem polnischen Publizisten der polnischen Wochenzeitschrift „Tygodnik Powszechny“.75 Für die erstere bestehe der Sinn einer jeden Translation bzw. Übersetzung in der gekonnten „Zähmung“ des Fremden durch den Translator.76 Markowski dagegen meint, dass durch die unermüdliche Arbeit der Übersetzer der Literatur als Erzählung von Anderem gerade der Andere aufhört, ein Fremder zu sein. Die beiden Äußerungen charakterisieren sehr treffend die wesenhafte Eigenschaft eines jeden Translationsprozesses, und zwar den notwendigen Umgang des Translators v.a. (aber nicht nur) mit konkreten textuellen Exponenten bzw. Indikatoren der Fremdheit als Bewertungsprädikat und Ergebnis der Evaluation durch den Translator und andere aktive Aktanten im Translationsprozess. Denn das Prädikat ‚fremd‘ ist immer eine relative Größe und bezeichnet einen spezifischen Einstellungstyp eines Subjekts gegenüber einer wahrgenommenen belebten resp. unbelebten, einer materiellen bzw. immateriellen/ideellen Entität. ‚Fremd‘ ist also in Anlehnung an die Konzeption von Waldenfels (1990 passim) etwas und/oder jemand für jemand, der mit dem Anderen, was auch immer es ist, zuerst in einem Wahrnehmungsakt, d.h. perzeptiv und anschließend mental-kognitiv konfrontiert wird. Und das Andere bzw. der Andere wird dann zum Fremdem abgestempelt, wenn vom aktiven Subjekt erkannt wird, dass das Andere mit dem Eigenen nicht kompatibel und eine Ausgrenzung des Anderen als Fremdes gegenüber dem Eigenen durch Unverträglichkeiten die Folge ist. Im Rahmen des Translationsgefüges als Modell lassen sich konkrete Typen von Relationen nachweisen, die mit dem Evaluationsprädikat „Fremdheit“ gekennzeichnet werden können und die sich aus der divergenten kommunikativen Spezifik des Translationsprozesses ergeben:
- Initiator der Translation ↔ Translator
- möglicher AS-Textproduzent, direkt involviert in den Translationsprozess
- Translator → Translationsauftrag als Kommunikationsauftrag (vom Translator umgedeutet zur Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe);
- Translator → AS-Text;
- Translator →/↔ ZS-Adressat
- ZS-Adressat → AS-Text;
- ZS-Adressat → ZS-Text;
- ZS-Text-Adressat → AS-Text-Adressat.
Im Folgenden wird die genannte divergente Spezifik dieser Kategorie einer gesonderten komplexen Klärung unterzogen, wobei zunächst das fundamentale Verständnis der Fremdheit im definitorischen Sinn interpretiert wird. Im Anschluss daran wird im Vordergrund dieser Überlegungen die Kategorie der Fremdheit in spezifischer Relation zum Translator untersucht so wie es im Thema dieses Aufsatzes annonciert wurde .
Das Vorkommen des Fremden bzw. der Fremdheit, insbesondere in der zwischenmenschlichen Kommunikation und abgesehen von ihrer Vollzugsspezifik, bildet nicht zufällig die Grundlage und zugleich Voraussetzung jeglicher Translationsprozesse: Der Translator sowie ein jeder aktiver Kommunikationsaktant (auch im Rahmen einer monolingualen Kommunikation) übersetzt also – im weiteren Verständnis der Translation als Kommunikation – immer entweder aus dem Eigenen ins Fremde als das sog. produktive Sichselbst-Übersetzen für Andere oder aus dem Fremden ins Eigene als das sog. rezeptive verständnisbezogene Übersetzen der Anderen im Rahmen einer kommunikativen Beziehung intentional handelnder Subjekte zur Welt. In diesem Prozess der kommunikativen und erfahrungsmäßigen Wechselwirkungen wird nach Loenhoff (1992: 152) das individuell Innere, die psychische Innerlichkeit als kognitives konzeptuelles Konstrukt, das Diesseitige und schließlich das Eigene also ins Äußere, in die soziale Äußerlichkeit, ins Jenseitige, ins Fremde bzw. umgekehrt transferiert77, was als aktive Aufhebung der Unverträglichkeit von zwei disjunktiven Sphären und damit der dualistisch konstruierten cartesianischen Konzeption des Bewusstseins aufgefasst werden kann. Denn erst durch die intersubjektive Erfahrung, so Waldenfels (1990: 32) konstituiert sich unsere Welt, wenn das Vertraute (Eigene) eingegrenzt und das Fremde ausgegrenzt wird, wenn also Eigenartiges und Fremdartiges einer Differenzierung unterzogen werden. So wie Menschen keine abgeschlossenen, hermetischen Systeme darstellen, so sind auch gesellschaftliche Systeme, Sprachsysteme, Sprachgemeinschaften als Kulturgemeinschaften offen, im weitesten Sinne kompatibel, also kommunizierbar. Im engeren Verständnis der Translation als interlingual-interkulturelle Kommunikation, was heutzutage generell sowohl theoretisch als auch praktisch akzeptiert wird, vollziehen sich die o.g. Prozesse des evaluativen Erkennens von Fremdheit (von Fremdem) zuerst im Bereich der Perzeption und Rezeption des AS-Textes stellvertretend durch den Translator, indem die rezeptiv rekonzeptualisierte AS-Text-Welt auf die jeweiligen in Frage kommenden Ziel-Systeme projektiv abgebildet wird, um aus der systemischen Reziprozität die kommunikativ notwendigen Kompatibilitäten und die fundamentale ZS-Ausdrückbarkeit abzuleiten und festzulegen.
Das Fremde als eine wichtige Kategorie der Translation (und Kommunikation schlechthin) wurde sowohl in der Geschichte als auch in der modernen Translationswissenschaft mit verschiedenen Namen bezeichnet, die wiederum verschiedene Konzeptualisierungsvarianten und -aspekte des gesamten Begriffskomplexes abdeckten. Wir treffen also auf ‚Fremdheit’ und ‚Andersheit’ bei den Klassikern wie: Hieronymus, Luther, Goethe, Schlegel, Humboldt, Schleiermacher und in der modernen Translatologie bzw. Translatorik, die sowohl nach literaturwissenschaftlichen als auch linguistischen Paradigmen fundiert ist, weiter auf ‚Alterität’ im Sinne von ‚Andersheit’ bei Steiner, wiederholt auf ‚Fremdheit’ bei Reiss/Vermeer, Nord, Wilss, sowie auf ‚obcość’ (Fremdheit) bei dem polnischen Translationstheoretiker und Spezialisten auf diesem Gebiet, Roman Lewicki und schließlich auf ‚Andersartigkeit’ bei anderen polnischen Vertretern der Translationswissenschaft wie: Hejwowski, Lipiński und auch in meinen Arbeiten. In der modernen Kommunikationswissenschaft thematisieren und situieren T. Luckmann, A. Schütz, B. Waldenfels, und J. Loenhoff das ‚Fremde’ und ‚Fremdartige’ im Mittelpunkt ihrer Analysen der interkulturellen Kommunikation zwischen Menschen, die fremden Kulturen und Sprachen angehören.
Dem ganzen Begriffskomplex, wie auch immer er konzeptuell profiliert ist, liegt jedoch in allen Auffassungen des Fremden das relationale Wesen zugrunde, das sich aus einer konkreten komparativen Aktivität des jeweiligen Subjekts in seiner Erfahrung der Welt ergibt. Evaluativ werden also einerseits und statischerweise Kultursysteme, Kommunikationssysteme und damit auch Sprachsysteme, andererseits gleichermaßen Produkte ihrer Instrumentalisierung im dynamischen Kommunikationsprozess, d.h. Texte, verglichen, die in den meisten Fällen als Träger und mit Abstand die dynamischsten Realisierungsmittel einer jeden Kultur fungieren. Zwecks Systematisierung lassen sich also zwei Domänen unterscheiden: die Systemdomäne und die kommunikative Textdomäne. Die beiden Domänen erhalten ihre besondere Aktualität im jeweiligen Kommunikationsprozess. Die letztere bildet einen praktischen, erfahrungsmäßigen Zugang zu der ersteren und auf diesem Wege bewegten und bewegen sich viele Theoretiker dieser Problematik. Das Vorkommen von Fremdem bzw. der Fremdheit im Originaltext ergibt sich notwendigerweise immer aus einem Vergleich und einer nachfolgenden Projektion und im Falle der Translation aus einer spezifischen Evaluation des Ausgangstextes, so dass wir es im Endeffekt einer solchen Prozedur mit einem Bewertungsprädikat zu tun haben. Dieses besitzt jedoch immer im Sinne der besagten relativen Natur dieser Erscheinung einen subjektiven Bezugspunkt, und zwar die Bestimmung der Person, für welche das Original, seine konstitutiven Elemente fremd sind, und die sowohl seine äußere Form als auch die semantisch-thematischen und kommunikativ-pragmatischen bzw. ästhetischen Dimensionen, Inhalte und sonstige intertextuell-diskursive Bezüge betreffen. Um diesen Problemkreis interpretativ weiter auszuloten, sei also zunächst auf die dynamische Konstitution der Translation im anthropozentrischen Interpretationsmodus verwiesen.
Die Translationsgenese als Kommunikationsgenese resultiert aus und ist enthalten in der dominanten Strategie des Translationsinitiators. Noch tiefer greifend ist sie nämlich in dem die Sprachkommunikation konstituierenden Hauptprinzip verwurzelt, nach dem die Sprachkommunikation in ihrem Wesen der Koordination von anderen Handlungen in einem übergeordneten Kooperationsgefüge dient. Daher wird die Translation in den meisten Fällen zum kommunikativen Funktionieren infolge einer „fremden“ Intention von „Draußen“ bestellt und eingesetzt. Als spezifische Art der Kommunikation wird sie jedoch gerade von der eigenen Intentionsstruktur des Translators konzipiert, organisiert, gesteuert und vollzogen. Diese Intentionsstruktur des Translators bekommt den Rang des Inhalts, der kognitiven Realität seiner Translationsaufgabe. In der Phase der Konstruktion und der Wirkung der Translationsaufgabe sowie insbesondere in der Phase ihrer prozessualen Realisierung werden auch spezifische Evaluationsoperationen vom Translator getätigt und die sich daraus ergebenden Präsuppositionen formuliert. Sie betreffen direkt die Funktionalität einer fundamentalen und kategorialen Konstituente der Translationsaufgabe wieder als Kommunikationsaufgabe und zwar die Kollokutivität78 der Ziele der aktiven Kommunikationspartizipanten, die das Vorkommen der sog. Reziprozität79 ihrer Handlungsperspektiven voraussetzt, weil sie für das Erfolgreichsein einer jeden Kooperation notwendig ist. „Denn die allgemeine interkulturelle Kooperation als Sicherstellung der Perspektivenreziprozität zwischen den Partizipanten wird über interlinguale konversationelle Interaktion, d.h. konkret über die Kooperationsform der Translation oder (in den Termini von J. Holz-Mänttäri 1984: 20) über das Kooperationsmuster translatorisches Handeln realisiert.80 Erst so kann die Reziprozität...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Fremde und… Kultur
- Das Fremde und… Literatur
- Das Fremde und… Sprache
- Das osteuropaprogramm des Kaad
- Impressum