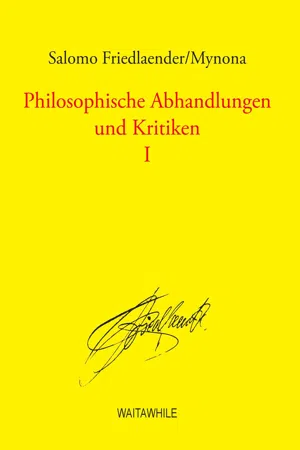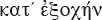![]()
Es ist sehr merkwürdig zu verfolgen, wie es dem Pessimismus nach und nach gelungen ist, den Optimismus, der ursprünglich so behaglich-naiv seiner selbst gewiß war, dennoch in Harnisch zu bringen; wie er nach und nach sein anfangs recht plumpes Gewaffen gegen immer feineres, schärferes vertauschte, bis er, besonders durch die Theorie Darwins und die Philosophie Nietzsches, heutzutage kolossalisch erstarkt, seines Gegners übermächtig geworden zu sein scheint.
Aber bot schon der naive Optimismus, dem es niemals beifiel, an sich selbst zu zweifeln, ein so erbarmungswürdig heilloses Bild, daß Schopenhauer ihn geradezu verrucht nannte, so ist der moderne, mit Selbstbewußtsein trotzig auftretende vollends nicht nur in moralischer, sondern auch gar in intellektueller Hinsicht verrucht.
Mit einem sehr beliebten argumentum ad hominem pflegt man besonders für den Schopenhauerschen Pessimismus nicht das Wesen der Welt, sondern das Temperament Schopenhauers verantwortlich zu machen; ohne übrigens zu bedenken, daß so ein unglückseliges Temperament denn doch auch mit zur Welt gehört, also ein Schluß von seiner auf ihre Beschaffenheit nicht so ganz und gar subjektiv gilt.
Aber freilich! freilich, wenn der Pessimismus, die Lehre von der Eitelkeit alles einem Gehirn Erscheinenden, nichts weiter wäre als eine etwas sublimierte, üble Laune – dann verdiente er, daß man ihn nicht voll nähme, wie eine objektive Wahrheit. Aber er ist in der Tat viel tiefer: er ist im Wesen der Welt, dieses Gehirnphänomens, und eben darin, daß sie so eines ist, begründet. Schon mit dem Satze, mit welchen Schopenhauer anhebt, „die Welt ist meine Vorstellung“, ist Objekt für ein Subjekt, steht und fällt der Pessimismus; wird die Welt so eitel, wie ein Traum nach dem Erwachen.
Das Sein für ein anderes ist nichtig gegenüber dem Sein für und an sich selbst, wie es auch das Tier, auch der Mensch noch nicht hat, weil auch das klarste Selbstbewußtsein eben immer ein Bewußtes, Gewußtes enthält: an sich aber ist nichts bewußt, und ist das Bewußte, als solches, nichts; also diese ganze Welt eigentlich keine Welt, sondern lediglich ein Bewußtsein der Welt. Und mit einem solchen bloßen Bewußtsein sollte man sich begnügen? wie es doch der Optimismus tut.
Die „Welt“ ist aber nicht nur überhaupt ein Gewußtes, sondern dieses in einer ganz bestimmten Weise. Vor allen Dingen ist sie ein Zeitliches, wodurch ihre Nichtigkeit dermaßen handgreiflich wird, daß man auf die Optimisten anwenden muß:
„Den Teufel merkt das Völkchen nie,
Und wenn er sie beim Kragen hätte!“
Die liebe Zeit penetriert ihren ganzen Inhalt, und wär es der allerköstlichste, mit ihrer eigenen Nichtigkeit – was ist es noch wert? Der Raum, dieser Überall-und-Nirgends, macht es nicht besser, nur anders. Die Materie, in beider Strudel geratend, nimmt ein erschrecklich bestandloses, flüchtiges, nichtiges Wesen an: als Wechsel der Dinge. Diese selbe triste Sprache reden, wenn man noch mehr ins Spezielle geht, alle Dinge – vom Mineral, über Pflanzen und Tiere hinweg, bis zum Menschen.
In diesem Betracht genommen, als immanenter Nihilismus, besteht der Pessimismus zu Recht, gesetzt auch, es gäbe nur Genüsse, gar keine Leiden; weil es Leiden gibt, eine schwere Menge, wird der bloße Nihilismus zum Pessimismus, ja müßte es werden, wenn auch, vielleicht vor Jahraeonen, nur ein einziges Leid geschehen wäre: denn nicht auf die Summe, sondern auf das bloße Vorhandensein des Leidens kommt es an.
Daß der Pessimismus so heftig bekämpft wird, geschieht auch wohl weniger wegen einer unzulänglichen Begründung, als aus Besorgnis vor seinem schlimmen Einfluß auf die Kultur. Aber hätte eine Wahrheit auch die schlimmsten Wirkungen – man wäre eben verurteilt, sie hinzunehmen; denn was bedeutet das noch so gute, wenn es nicht wahr ist? Oder kann es dann überhaupt anders gut sein, als besten Falls für das leibliche Wohlsein? Der Wahrheit müßte man sogar blindlings folgen!
Im Grunde aber täte man doch dem Pessimismus den allergrößten Gefallen, wenn man die Furcht vor seinen schlimmen Konsequenzen beseitigte. Das hat Schopenhauer, wenn man ihn wohl versteht, geleistet. Aber „abusus optimi pessimus“ hat sich auch hier bewährt. Wie sehr wird er mißverstanden! Asthenie, Apathie, Fatalismus, Stagnation, Selbstmord, Misanthropie, überhaupt Degeneration – sollen die Folgen sein, zu denen er führe. Und doch fand er es immer so absurd, Vorschriften dem Willen zu geben, der, in der Welt erscheinend, schon notwendig bestimmt, außerdem aber völlig frei, das ist: höchst problematisch sei.
Indessen muß man zugeben, seine Philosophie wirkt nun einmal auf den Menschen; und zwar meistens ganz anders als erhebend und befreiend – leider! Befreien gerade könnte sie, wie keine andere, wenn man, wie gesagt, sie wohl verstünde.
Er ist der größte innere Revolutionär der Welt. Ihre Nichtigkeit, ihr Leiden ist sein Problem. Er zeigt sie auf in ihrer ganzen Entsetzlichkeit in der Praxis, in ihrer leeren Eitelkeit in der Theorie. Aber dort gegen die Verzweiflung des bloß praktischen, wie hier gegen die des hauptsächlichen theoretischen Menschen gibt er ja ein mit Notwendigkeit zu denkendes, also unabweisbares, ganz einziges Rettungsmittel: Dem Herzen die Möglichkeit, sich von der bloß phänomenalen Welt, – dem Kopfe die Möglichkeit, sich von seinen das Wesen der Welt entstellenden und verhüllenden Formen der Zeit, des Raumes und der Kausalität zu befreien.
Der Optimist aber denkt, in seiner Ahnungslosigkeit von dem Ernste des (theoretischen) immanenten Nihilismus und Pessimismus, auf allerlei entweder sehr simpele oder sehr subtile Weise: des Menschen Engel sei die Zeit. In der Zeit, an der Hand der gutmütigen Kausalität, spaziert er höher und immer höher hinauf die unendliche Leiter der Entwickelung, ohne ein Ziel als eben dieses Höherklimmen. Singt nicht heimlich leise, im Grunde seines Herzens, auf jeder erklommenen Sprosse, eine Wahrheitsstimme: frustra! frustra!? Gerade dieses frustra! ist der Gipfelpunkt aller Entwickelung: von dem an hat sie ihr Ziel erreicht, ist sie nämlich erkannt in ihrer Eitelkeit, welches ein großer Schmerz ist.
Jetzt aber, um ihn nur los zu werden, damit er nicht zum Untergange der Kultur, Stagnation, Fatalismus und Selbstmord führe, tolldreist wie Nietzsche auf ein „umgekehrtes Ideal“ lossteuern – sich blindlings, um jeden Preis, an die Entwickelung festklammern, nur weil man, vor der Hand, kein anderes Heil gewahr wird und, wenn man jene aufgäbe, alles verloren glaubt: das ist, bei Licht besehen, blanke Feigheit und Verblendung; ja eine furchtbare Gefahr – nicht für die Kultur, welche ohne weiteres für das Ideal der Ideale genommen wird, sondern für das wahre Heil, wie es der Menschheit schon vor Jahrtausenden märchenhaft vorgeschwebt hat, und von Schopenhauer erstaunlich klar hingestellt ward. Diese Apotheose der Kultur erscheint jedem, der vor jenem frustra nicht mehr zu zittern den Mut hat, als tief beklagenswert, als der wahre, intellektuellste Sündenfall.
Ließen sich doch die Optimisten von Schopenhauer belehren!: „daß Jeder noch himmelweit von einer philosophischen Erkenntnis der Welt entfernt ist, der vermeint, das Wesen derselben, und sei es auch noch so fein bemäntelt, historisch fassen zu können; welches aber der Fall ist, sobald in seiner Ansicht des Wesens an sich der Welt irgend ein Werden, oder Gewordensein, oder Werdenwerden sich vorfindet, irgend ein Früher oder Später die mindeste Bedeutung hat“…. „Solches historisches Philosophieren liefert in den meisten Fällen eine Kosmogonie, die viele Varietäten zuläßt“…. „welches man übrigens am kürzesten abfertigt durch die Bemerkung, daß eine ganze Ewigkeit, d. h. eine unendliche Zeit, bis zum jetzigen Augenblicke bereits abgelaufen ist, weshalb alles, was da werden kann und soll, schon geworden sein muß“.
Weil es der Entwickelung, der Kultur, dieser trefflichen Gouvernante, welche hat aus Staub Pflanzen, aus diesen Tiere, aus diesen, näher aus Affen, Menschen gebildet, an den Kragen geht; der Kultur, die aus Menschen doch gewiß noch Engel, ja Götter und Übergötter züchten wird: darum Optimismus und gaudeamus! und hinc illae lacrymae über den die hoffnungsreiche Metamorphose so grausamlich sistierenden Schopenhauer und seinen das holde Spiel so gründlich verderbenden Pessimismus, der sogar einem Darwin zum Trotz, ganz unerschütterlich feststeht. Darwins Theorie kannte Schopenhauer wenigstens mittelbar. An Herrn von Doß schreibt er am 1. März 1860: „Aus Darwins Buch habe einen ausführlichen Auszug in der Times gelesen: Darnach ist es keineswegs meiner Theorie verwandt, sondern platter Empirismus, der in dieser Sache nicht ausreicht: ist eine Variation der Theorie de la Mark’s“.
„Es irrt der Mensch, so lang er strebt“; und sobald er nicht mehr irrt, sobald er klar sieht, strebt er auch nicht mehr, sondern hält einen anderen Monolog Hamlets: Welt oder Nichtwelt, das ist jetzt die Frage. – Ist keine Möglichkeit einer Flucht aus diesem Traumdasein für ein Gehirn in ein absolutes Für-sich-sein? ja dann lasciate ogni speranzal – Sors de l’enfance, ami, réveille-toi! (Jean Jacques Rousseau). Wache auf, lieber Optimismus, und lasse dich von Kant überzeugen, daß du nur träumst, und von Schopenhauer dich belehren, daß du auch wachen könntest, wenn du nicht mehr träumen wolltest, wenn du nichts mehr wolltest! – In dieser erscheinenden Welt ist eben nichts ernst; nichts ernst, wenn nicht eben der Gedanke, daß nichts ernst ist.
Nichtsdestoweniger erkennt Schopenhauer bewundernd an, wie unendlich schön die Welt ist; und hier beginnen die Optimisten wohl aufzumerken, und ihre Spürnasen wollen hier allerhand Unrat und Widerspruch und geheimen Optimismus wittern. – Schopenhauer zerspaltet bekanntlich unser Bewußtsein in Wille, mit dem wir uns ohnehin identisch fühlen; und Vorstellung, die uns a priori fremd ist, der wir jedoch, zur Herstellung eines wenigstens künstlichen Identitätsbewußtseins, wie er sich anstrengt zu beweisen, eben jenen Willen, „den Willen zum Leben“, als ihr eigentliches Wesen unterlegen können, ja müssen. Also der Wille ist ihm das Wesentliche, worauf die Vorstellung, um Wesen zu erhalten, zurückgeführt werden müsse, da sie sonst ein leeres Bild bliebe. An zahllosen Stellen hat er auf die sekundäre Natur des Intellektes sehr entschieden hingewiesen. Der Intellekt ist ihm stets nur Diener des Willens; auf den Willen kommt es ihm in der letzten Instanz an.
Diesem Grundsatz bleibt er auch stets getreu, solange er sich in bloß moralischem Gebiete bewegt. Wie erstaunt man aber, wenn er den ästhetischen Boden betritt und hier Willen und Intellekt völlig die Rollen wechseln läßt: so daß nun jener vom Intellekt, der doch vordem nur sein Frohnknecht zu sein schien, nun auf einmal vergewaltigt, gemeistert, ja vernichtet wird –!
Man sollte jedoch so lange wie irgend möglich zögern, ehe man sich entschlösse, einen echten Denker des Widerspruchs mit sich selbst zu zeihen, eines Verstoßes „gegen das simpelste aller logischen Gesetze“, wie Schopenhauer in einem seiner Briefe einmal sagt. Es ist a priori unwahrscheinlich, daß er, in einem Atem, den Intellekt erniedrigte und erhöhte.
Um es kurz zu machen: in der Ästhetik ist die Rede von einem Intellekt, der fast keiner mehr ist, denn alle seine Formen oder Funktionen hat er verloren – bis auf die eine, allerallgemeinste, des Subjektfür-ein-Objekt-seins überhaupt. Man ist vermöge seiner beinahe „alle Dinge“, beinahe die Welt selbst; deren innerstes Wesen war Wille: gerade dieser ist nun mächtiger als je, und der Intellekt, wie gesagt, fast keiner mehr.
Und allerdings ist, solange der Intellekt ein solcher bleibt, alle Bedürftigkeit, aller Mangel und Begierde aufgehoben, weil zu so etwas zwei gehören, eines, das begehrt, und eines, das begehrt wird: hier aber ist überhaupt nur eines: die Welt, im Medium des Intellektes schwebend, und mit einem Schlage dadurch eine Menge Eitelkeiten verschwunden: nämlich alles Zeitliche, Räumliche, Kausale; wie nachher noch näher gezeigt werden soll; so, daß man der Ansicht fast sein möchte: in diesen von Schopenhauer so hochgepriesenen stecke sein eigentlicher letzter Ernst; und vielleicht nur aus Furcht, sich in Widersprüche zu verwickeln, in einen Optimismus zu geraten und die unschätzbar wichtige Einheit seines Systemes zu gefährden, habe er auch zu diesem bon jeu mauvaise mine gemacht, und sich nicht an der schönen Welt permanent gelabt, sondern auch sie zu den Toten, will sagen den anderen Eitelkeiten geworfen, obgleich mit langem, langem, zögerndem Blick.
Aber ein Geist wie Schopenhauer sollte vor der Verdächtigung bewahrt bleiben, daß er, sophistischen Regungen zu Liebe, etwas anderes als die Wahrheit aussprechen könnte.
Der Genuß des Schönen ist zwar überaus wonnevoll und selig, aber, das
Finale einer Ethik abzugeben, doch untauglich; weil er zwar schon von vielen Eitelkeiten frei, aber mit der Eitelkeit
, lediglich phänomenal zu sein, durchaus behaftet ist; daher man bei ihm wohl auf Augenblicke, aber nicht endgiltig stehen bleiben wird.
Wie steht es nun um die innere Folgerichtigkeit der Metaphysik des Schönen? Als Lehre von den Ideen, diesen starren Repräsentanten der Spezies, wird sie durch sehr beachtenswerte Argumente vom Darwinismus angefochten.
Nach Schopenhauer ist die Skala der Wesen keine heulende, sondern eine Tonleiter, deren Stufen sich, deutlich unterschieden, voneinander absetzen. Jede dieser Stufen, welche eine nicht nur hohe, sondern auch breite Treppe bilden, repräsentiert ihm eine Idee: das ist keine zeitlich, räumlich und kausal verunreinigte, sondern eine adäquate Sichtbarkeit, Objektität des Willens, der der Welt Wesen ist. Dazu bemerkt nun Darwin: was ihr da, so deutlich voneinander gesondert, in erstarrten Formen vor euch sehet, das fließt vor der Jahrtausende als einen Augenblick umspannenden Wissenschaft in etwas recht elastisches, mit verwaschenen, sich verschiebenden, vermehrenden, vermindernden Grenzen ineinander.
Da scheint es denn schlimm bestellt mit den armen scharfumrissenen fixen Ideentypen. Es scheint nur Darwin hat Recht; nur, daß er, streng empirisch, in Zeit und Raum, in die Vorstellung verlegt, was im Willen wahr ist. Im Willen fließt alles verschiedene zusammen; im Willen sind auf einmal zahllose Wesensverschiedenheiten latent. In der Welt als Vorstellung ist jedes wohlgesondert. An sich gibt es keine Spezies, aber für das Gehirn. Die Möglichkeit zahlloser Wesen, welche im Willen liegt, äußert sich in der Erscheinungswelt als Auftreten neuer, Veränderung und Aussterben vorhandener Spezies. Jede dieser, wenn auch noch so flüchtig vorübergehenden Erscheinungen ist mit Recht eine Idee zu nennen, eine Offenbarung des ewigen Willens als Dinges an sich, dem es gleichgiltig ist, ob er als Krystall oder als Mensch erscheint: in jenem ist er so ungeteilt gegenwärtig wie in diesem. In jeder Gestalt also ist er eine Idee und in jeder ungeteilt mit Augen zu schauen, wenn die Schleier Zeit, Raum, Kausalität gelüftet sind, die ihn entstellen. Diese Entstellung, diese scheinbare Diversität, Zerstückelung, Flüchtigkeit, Veränderung, Entwickelung stellt sich Darwin als eine wesentliche vor, weil er eben rein empirisch anschaut und denkt. – Es bleibt also bei der Ideenlehre, auf der die Ästhetik, wie jetzt ausgeführt werden wird, sehr sicher beruht.
Schopenhauer unterscheidet mit wunderbarer Weisheit zwei gänzlich heterogene Arten der Erkenntnis: Wissenschaft und Kunst.
Die Wissenschaft sucht ein Ding zu ergründen, dadurch, daß sie seinen Konnex in Raum und Zeit, zumal den kausalen, mit anderen offenbart. Statt bei der Sache zu bleiben, geht sie von ihr zu anderen über in infinitum und merkt naiver Weise gar nicht, daß sie so an der Peripherie der Dinge entlang läuft, statt in den Wesenskern des einen, gerade zu ergründenden einzudringen. Von diesem einen gleitet sie ab zu anderen, von denen sie wieder abgleitet. Im Grunde ist ihr nicht die ganze Welt, sondern bloß der Stoff, die spezialisierte Materie, höchst problematisch; und so kann sie in der Tat vollauf befriedigt sein, wenn es ihr gelingt, sich Rechenschaft von seinem Werden und Vergehen zu geben. Vielleicht die einzige sie quälende Skrupel ist das Vorhandensein dieses Stoffes überhaupt; welches mit einem ignorabimus rasch abgetan wird.
Hingegen die Kunst hat das Ding in toto, die Welt, zu ihrem Probleme – also Materie, Zeit und Raum im Verein. Also nichts von diesen dreien darf der künstlerische Intellekt zurückbehalten, um mittelst dessen das andere zu erkennen, sondern er muß alles von sich abstreifen, um es zum Probleme selbst zu werfen; er bleibt also nichts als reines erkennendes Subjekt; welches nur möglich ist, wenn der individuelle Wille, in dessen Dienst er eigentlich steht, ihn freigibt. – Schopenhauer sagt nirgends, was aus diesem individuellen Willen unterdessen wird; indessen gehört er zweifellos mit zur Welt; oder vielmehr, bemächtigt sich nun nicht mehr als Individuum, sondern eben als Welt, in Gestalt irgend einer Idee, des Gehirnes; wonach dieses also nicht vom Willen überhaupt, sondern bloß vom individualisierten Willen frei wird.
Dieses Wunder, diese allerdings höchst paradoxe Erkl...