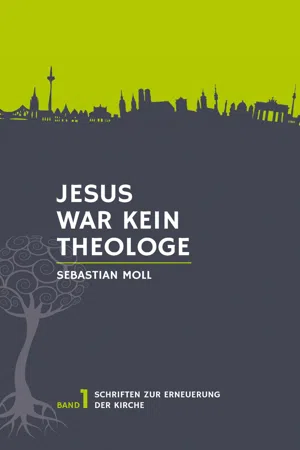
- 96 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Jesus war kein Theologe
Über dieses Buch
Das Christentum hat sich von einer einfachen und klaren Botschaft zu einem komplexen System entwickelt, das nur noch von Fachleuten zu verstehen ist. War dies im Sinne seines Begründers? Jesus war kein Theologe, kein Akademiker, kein Schriftgelehrter - und er wollte auch keiner sein! Dieses Buch versucht, den Gottessohn hinter den turmhohen Bibliothekswänden der Theologen hervorzuholen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Jesus war kein Theologe von Sebastian Moll im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Christentum. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kinder statt Gelehrte
Gelitten unter Pontius Pilatus – so hat es die frühe Christenheit in ihrem ersten Glaubensbekenntnis formuliert und damit dem römischen Statthalter zu unverhofftem Weltruhm verholfen. Obwohl Pilatus als letzte Instanz natürlich einen bedeutenden Gegenspieler Jesu darstellt, ist seine Rolle gemessen am Gesamtumfang der Evangelien eher klein. Fragt man, mit wem Jesus am häufigsten und heftigsten in Konflikt gerät, so tritt eine Gruppe ganz klar als Sieger hervor: die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer waren diese Leute? Sie bildeten die intellektuelle Elite des Judentums jener Zeit, sie waren Experten in der Auslegung der heiligen Texte, ihr Wort galt in religiösen Fragen als bindend. Wie aber kam es dann zu einem so scharfen Konflikt? Hätte sich Jesus nicht eigentlich mit diesen Experten der Frömmigkeit gut verstehen müssen? Neben der schon sprichwörtlichen Scheinheiligkeit der Pharisäer, die Jesus öffentlich anprangerte, sind uns zahlreiche Streitgespräche überliefert, in denen es um Themen wie Speisevorschriften oder die Sabbatheiligung geht. Die Fokussierung auf die inhaltlichen Differenzen zwischen Jesus und den Schriftgelehrten hat allerdings dazu geführt, dass diese Streitgespräche als ein spezielles Phänomen jener Zeit wahrgenommen wurden, das für unsere heutige Welt keinerlei Bedeutung mehr hat. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die eigentliche Ursache für den Dauerkonflikt nicht in bestimmten Inhalten, sondern in der radikal anderen Geisteshaltung Jesu liegt.
Als Jesus mit seiner Predigt an die Öffentlichkeit tritt, lauten die ersten Fragen der Gegenseite: „Ist das nicht der Zimmermann? Wie kann er die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein?“ Es ging also zunächst gar nicht um konkrete Themen, sondern um die Frage, warum man sich mit so jemandem überhaupt auf einen Streit einlassen sollte. Aus Sicht der jüdischen Bildungselite war Jesus ein Laie, dem die akademische Qualifikation fehlte, um mit ihnen auf Augenhöhe zu diskutieren. Ob er die Wahrheit sprach oder nicht, war im Grunde irrelevant, man brauchte ihm gar nicht erst zuzuhören. Die Schriftgelehrten hatten sich von den Menschen entfremdet und sich die Exklusivrechte für theologische Debatten gesichert. In einer Gesellschaft von Analphabeten war die Fähigkeit zu lesen ein unschätzbares Privileg, vor allem wenn man bedenkt, dass die heiligen Schriften in Hebräisch verfasst waren, nicht in Aramäisch, der gebräuchlichen Umgangssprache jener Zeit.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind nicht einfach historische Gestalten einer längst vergangenen Epoche, sondern repräsentieren einen bestimmten Menschentypus, der zu allen Zeiten auftritt. Doch wer entspricht in unserer heutigen Gesellschaft dem Klischee des biblischen Schriftgelehrten? Die Antwort fällt nicht schwer: Auf dem Thron der Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen die Theologieprofessoren und Kirchenräte! Sie beanspruchen die Deutungshoheit über die Bibel, und wenn nötig, schreiben sie die Texte nach ihren eigenen Vorstellungen um. In einem völlig unverständlichen Akademikerdeutsch verschließen sie ihre Ergebnisse vor dem Volk. Wer sie kritisiert, wird nicht etwa sachlich widerlegt, sondern für ungebildet oder rückständig erklärt. Sie glauben, sich Jesu bemächtigen zu können, aber er ist keiner von ihnen. Er hätte sich gegen sie gestellt, wie er sich gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit gestellt hat.
Jesus war allerdings keineswegs nur negativ. Er identifiziert nicht nur seine Gegner in aller Deutlichkeit, er nennt seinen Hörern auch die Vorbilder, an denen sie sich orientieren sollen. „Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“ Man vergleiche hiermit seine schroffe Anklage gegen die andere Gruppe: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ Das Reich Gottes ist den Schriftgelehrten verschlossen, den Kindern hingegen steht es weit offen. Deutlicher kann man die beiden unterschiedlichen Pole nicht benennen.
Nun kann man sich zu Recht fragen, warum Jesus ausgerechnet Kinder als Vorbilder hinstellt. Jeder, der schon einmal mit Kindern zu tun hatte, weiß, dass diese nicht nur über positive Eigenschaften verfügen. Im Gegenteil, Kinder können mit ihrer Art auch enorm anstrengend und nervtötend sein. Dennoch verfügen sie zweifellos auch über charakterliche Vorzüge. Um ebendiesem scheinbar widersprüchlichen Umstand gerecht zu werden, bietet die deutsche Sprache zwei unterschiedliche Adjektive an, um das Verhalten von Kindern zu beschreiben: kindisch und kindlich. Kindisch bezeichnet die negativen Eigenschaften, die typischerweise mit Kindern assoziiert werden: dickköpfiges Verhalten, mangelnde Einsicht, Egozentrik. Und siehe da: Diese kindischen Eigenschaften sind identisch mit den Eigenschaften der Pharisäer! Mit dem Wort kindlich hingegen werden positive Charakterzüge bezeichnet, die zumeist mit Kindern in Verbindung gebracht werden: kindliche Freude, Klarheit und Einfachheit im Denken sowie eine zuweilen unverschämte Ehrlichkeit. Und siehe da: Es sind exakt diese kindlichen Tugenden, mit denen Jesus seine kindischen Gegenspieler außer Gefecht setzt.
Einfachheit
Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Pharisäer gehörte es, Jesus mit Fangfragen in die Irre führen zu wollen. Diese Fangfragen sollten ihn in der einen oder anderen Weise als etwas entlarven, sei es als gefährlichen Zeloten oder als gottlosen Gesetzesbrecher. Selbstverständlich durchschaute Jesus jedes Mal die böse Absicht seiner Gegner und fiel nicht darauf herein. Aber nicht nur das, die Hinterhältigkeit der Pharisäer ging regelmäßig nach hinten los, denn Jesus bediente sich ihrer Fragen, um durch sie einen neuen Teil der göttlichen Wahrheit zu offenbaren.
Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.
Diese Worte Jesu bilden vielleicht seine größte gedankliche Leistung. Das ganze Gesetz und die Propheten, also das, was wir heute das Alte Testament nennen, alle diese Texte mit ihren unzähligen Regeln und Vorschriften in zwei Geboten zusammenzufassen, das will gekonnt sein! Aber Jesus macht nicht nur deutlich, dass sich letztlich alle Gebote in diesen beiden wiederfinden, sondern dass diese beiden Gebote im Grunde zwei Seiten derselben Medaille sind. In der Liebe zu Gott findet sich die Liebe zum Menschen und umgekehrt. Leider wird dieser Aspekt der Worte Jesu heutzutage allzu oft vernachlässigt. Stattdessen pflegt man schlicht von christlicher Nächstenliebe zu sprechen, um im Anschluss darauf hinzuweisen, dass alle Religionen das Gebot der Nächstenliebe kennen, weshalb es eigentlich keinen so großen Unterschied zwischen ihnen gebe. Besonders traurig ist es, wenn die Weisheit Jesu zu dem Motto „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“ erniedrigt wird. Wer das tut, begeht einen Frevel an der Tiefe und Schönheit des göttlichen Wortes.
Die Aussage „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu“ ist eine reine Negativvorschrift, sie fordert ausschließlich zum Unterlassen bestimmter Handlungen auf. Nach dem gleichen Prinzip ist beispielsweise unser Strafgesetzbuch aufgebaut. Es enthält keinerlei Handlungsanweisungen für ein gutes Leben, sondern ausschließlich Tatbestände (Mord, Diebstahl, Körperverletzung etc.), die es zu unterlassen gilt. Das ist auch völlig in Ordnung, niemand erwartet mehr von unserem Strafrecht. Aber gleichzeitig wird sich wohl kaum jemand schon allein deshalb geliebt fühlen, weil ein anderer ihn nicht verprügelt oder bestiehlt. Die Liebe, von der das Evangelium spricht, geht weit über das Vermeiden böswilliger Handlungen hinaus, sie meint den direkten Dienst am Nächsten. „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“, bringt es Jesus auf den Punkt. „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat“, lautet die prägnante Antwort des Neuen Testaments auf die offenbarte Gnade Gottes. Die Liebe der Christen untereinander soll die Liebe Gottes widerspiegeln, jene Liebe, die so groß war, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Diese unmittelbare Verbindung von Gottesliebe und Menschenliebe ist eine genuin christliche Vorstellung, die anderen Religionen völlig unbekannt ist. Die Inkarnation ist keine bloße Formel der Dogmatik, erst durch sie wird christliche Ethik überhaupt möglich. Der Islam beispielsweise lehnt die Vorstellung der Menschwerdung Gottes als blasphemisch ab, und durch ebendiese Ablehnung ist es dem Islam verwehrt geblieben, ein Menschenbild zu entwickeln, das dem christlichen ähnelt. Der Islam möchte das gesamte Leben der Gläubigen durch ein umfassendes Regelwerk kontrollieren. Aus diesen Zwängen hat Jesus die Christen befreit.
Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten; und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du: Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist! Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon.
Wieder einmal erleben wir das bereits bekannte Spiel. Die Pharisäer wollen Jesus mit einer Frage provozieren, diesmal gepaart mit einer besonders intensiven Form der geheuchelten Ehrerbietung. In diesem Fall erhoffen sie sich vermutlich, Jesus würde öffentlich die kaiserliche Steuer in Frage stellen, was wohl zu seiner unmittelbaren Verhaftung durch die römischen Behörden geführt hätte. Auf diese Weise wären ihn die Pharisäer losgeworden, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Doch Jesus fällt nicht nur nicht auf diesen plumpen Versuch herein, er erwidert auch mit erfrischender Spontaneität: Guckt doch hin, ihr Blinden! Wessen Bild ist auf der Münze? Anstatt sich also auf eine spitzfindige Diskussion über den Sinn und Zweck der kaiserlichen Steuergesetzgebung einzulassen, weist Jesus ganz einfach auf das hin, was vor Augen ist, auf das Offensichtliche.
Unter den modernen Denkern war es vor allem der jüdische Philosoph Hans Jona...
Inhaltsverzeichnis
- Motto
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder statt Gelehrte
- Kirche statt Hochschule
- Wahrheit statt Wissenschaft
- Ausblick
- Nachwort
- Impressum