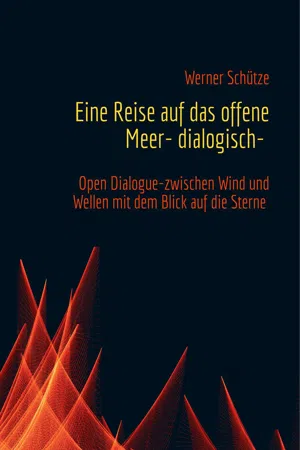
- 270 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Eine Reise auf das offene Meer- dialogisch-
Über dieses Buch
In dem Buch wird eine Workshopreihe dargestellt, die als Grundkurs zum Erlernen der Methode und der Haltung im Open Dialogue-Ansatz dient. Dabei handelt es sich um eine Methode, Menschen in psychischen Krisen wirksam in ihrem Umfeld unter Einbeziehung des natürlichen Netzwerkes zu unterstützen.Dabei spielt die Art des gemeinsamen Lehrens und Lernens voneinander als kollaboratives Lernen eine große Rolle.Zusätzliche Artikel und Tagungsberichte tragen dazu bei, den Blick vom Feld der Helfer auf die Gemeinde hin auszurichten.Das Buch eignet sich für alle an diesem Thema interessierten Menschen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Eine Reise auf das offene Meer- dialogisch- von Werner Schütze im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Medical Theory, Practice & Reference. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Vorwort zur 1. Auflage:
Diese Schrift ist zu einem Werkstattbericht geworden. Dabei wird beschrieben,wie sich ein Basis- Kurs zur Vermittlung der Grundlagen des Vorgehens im Open Dialogue- Ansatz zur Behandlung psychischer Krisen über 8 Workshops mit jeweils unterschiedlichn thematischen Schwerpunkten in einer ganz eigenen Weise entwickelt. Diesen Kurs hat es tatsächlich von 2014 bis 2015 in Krakow gegeben, wo er von der Trägerorganisation Leonardo da Vinci mit Mariusz Panek als Geschäftsführer organisiert worden war.
Die Idee zu diesem „Buch“ entstand nach und nach beim Schreiben von vielen kleinen Aufsätzen zu theoretischen Themen, angefangen bei den Grundlagen des Open Dialogue über die Bedeutung von Krisen bis hin zu den Überlegungen rund um das zirkuläre Fragen. Das waren jeweils 2, höchstens 4 Seiten zu einzelnen Themen, auf denen ich meine Gedanken geordnet habe, um sie dann ohne Manuskript vortragen zu können. Das lebendige Erzählen im direkten Kontakt mit den Zuhörern gehört für mich zu den wirkungsintensivsten Unterrichtsmitteln, kann man doch in keiner anderen Weise so direkt in die fragenden Augen der Menschen blicken oder etwas von der Atmosphäre aufnehmen und nutzen, die beim Sprechen entstehen kann.
Und auch die Diskussion um Manuale, Prinzipien und Elemente des Open Dialogue auf der Tagung des „International Network for the Treatment of Psychosis“ (INTP) 2014 in Roskilde, hat mich dazu angeregt, darüber nachzudenken, inwieweit sich auch in der Lehre diese Prinzipien wiederfinden müssen, um über die gelebte Erfahrung die Wirksamkeit erleben zu können. Schliesslich gelang es mir, die Formulierung zu finden- und sie gut zu finden- dass es um „bedürfnisangepasstes Lernen“ ginge. Das unterscheidet sich vom üblichen Unterricht nach Lehrplan insofern, als die Bedürfnisse oder die aktuellen Fragen der Teilnehmer explizit erfragt werden und mit den Mitteln der Methodik versucht wird, Antworten zu diesen Fragen nachzugehen. Das scheint für einen Gruppenprozess und den erwünschten Lerneffekt von hoher Bedeutung zu sein, da so meist Bedeutungsvolles zur Sprache kommt.
Ich mag einer Kodifizierung dieser Methode nicht das Wort reden, sehe aber im Versuch der Darstellung eines gemeinsamen- um das von Harlene Anderson geprägte Wort des „kollaborativen Lernens“ („collaborative learning“) zu benutzen- Lernprozesses eine Alternative zur Abfassung einer Lehrfibel, geschweige denn eines Lehrbuches, um das tatsächlich Besondere der Art von Vermittlung und gemeinsamem Erarbeiten der methodischen Besonderheiten bei der Entwicklung dialogisch- reflektierenden Vorgehens anschaulich zu machen. Ich habe auch überlegt, inwieweit es gut wäre, mehr Sichtweisen auf einzelne Themen zur Geltung zu bringen, z.B. die Co-Trainerin und auch die Dolmetscherin neben den Teilnehmern, die darüber hinaus noch wissenschaftlich begleitet wurden, um mögliche Effekte der Ausbildung zu erfassen, zu animieren, ihrerseits spezielle Erfahrungen und Sichtweisen auf einzelne Abschnitte einzubringen. Auch das schien sich entwickeln zu können. Es war ja nicht zu übersehen, dass sich in gewisser Weise Kulturen begegnen, die z. B. unterschiedliche Traditionen bei der Wissensvermittlung pflegen. So sind in der mehr westlich orientierten Tradition das „Mitdenken“ und „Fragen“ von hohem Stellenwert, während in der, man kann wohl sagen, post- sozialistisch geprägten Kultur , sowohl das öffentliche Fragenstellen als auch persönliche Bekenntnisse (öffentliches Ich vs. privates Ich) keine Tradition haben und erst ermöglicht werden müssen.
In Polen ist der traditionelle Ansatz des monologischen Frontalunterrichtskultiviert worden, der nicht nur nicht zum Nachfragen animiert, sondern dies durch die zugeordnete implizite Annahme, dadurch eine Kritik am Lehrer und seinen Vermittlungsfähigkeiten zu üben, unmöglich gemacht wird.
So war es nicht verwunderlich, dass die Co-Trainerin als Polin anfangs regelmäßig darüber irritiert war, dass ich selbst einem vorgeschlagenen Tagesplan wenig Bedeutung zumass, da in meiner Vorstellung sich der
Workshop hochwahrscheinlich auf eigene Weise entwickeln würde, nämlich im Rhythmus der Gruppe und den Bedürfnissen der Teilnehmer entsprechend.
Diese Zusammenhänge klärten sich dann im Laufe der Zeit, hier half die junge Dolmetscherin, die eine Vermittlungsfunktion zwischen den Welten einzunehmen begonnen hatte. Aber an dieser Stelle hat der nötige Aufwand, dann polnisch sprachige Originale ins Deutsche zu übertragen, den Ausschlag gegeben, auf eine tiefergehende Auseinandersetzung zu verzichten und es bei meiner Sichtweise zu belassen, die sich nach und nach durchsetzen konnte.
Die Bedeutung der Funktion einer Dolmetscherin wurde mir im Laufe der Zeit in mehrfacher Funktion deutlich. Sie verbindet mich sprachlich mit den Teilnehmern, ihrer Wortwahl bin ich ausgeliefert und muss ich mich unterwerfen bzw. überlassen. Das ist ein Mangel, der in der Tat schwer wiegt. So ist es schon eine besondere Situation, wenn ich Englisch spreche und dies der Gruppe übersetzt wird, und das Gesagte mir auch wiederum ins Englische übersetzt angeboten wird, was ich dann für mich in der Folge ins Deutsche übersetze.
Die Co- Trainerin spricht mit mir dagegen fliessend Deutsch, was die Dolmetscherin ihrerseits aber nicht beherrscht. So bedarf es besonderer Sorgfalt in der Verständigung untereinander.
Da es wenig nutzt, diesen Zustand zu beklagen, lag es schnell nahe, das„Beste“ daraus zu machen. Der Vorteil der Entschleunigung von Sprechen viel zuerst auf. Ich begrenze den Umfang der gesprochen Sätze, um der Dolmetscherin die nötige Gelegenheit zu geben, zu übersetzen. Das gibt mir Zeit, zu überlegen, was ich als Nächstes sagen möchte, kurz und möglichst präzise. Die Teilnehmer lernen ebenso langsamer zu sprechen und Pausen zu machen, was Allen zugute kommt. Daneben merke ich, wie ich mehr und mehr darauf achte, wie etwas gesagt wird, die Sprecher aufmerksam anschaue und in mir bewege, was sie mit dem Gesagten auch noch zum Ausdruck bringen möchten. Die Begleitung bei der Arbeit in kleinen Gruppen habe ich nach und nach aufgegeben, denn die mitlaufende Übersetzung wird dort doch auch als störend erlebt, sodass diese Arbeit der Co- Trainerin vorbehalten bleibt.
Umso wichtiger wurde für mich das anschliessende Austauschen der Erfahrungen in der grossen Gruppe, um etwas von dem, was die Teilnehmer bewegt, zu erfahren.
Aber es hat sich auch erwiesen, das eben dies die Kohäsion der Gruppe fördert und die Bereitschaft stützt, Persönliches einzubringen und somit die Bewegung hin zur Gruppe als „sicherer Ort“ gefördert wird.
Den Ausschlag, diese anspruchsvolle und aufwändige Arbeit am Buch parallel zum Kurs zu machen, gab dann der Ablauf des ersten Workshops, in dem 13 der vorgesehenen Teilnehmer anwesend sein konnten und die Intensität der Begegnungen von Anbeginn mich so bewegt haben, dass der Entschluss feststand, diese Entwicklung ausführlicher beschreiben zu wollen.
Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass ich einen eigenen Schreib-und Sprachstil habe, der im Schriftlichen manchmal als ungewöhnlich wahrgenommen wird. Aber da ich ein möglichst nahes Bild von dem, was passiert ist, und wie ich es wahrgenommen habe, zeichnen wollte, bin ich diesem Stil treu geblieben.
Ich habe alles, was passiert ist, während der Workshops in meinen „freien Zeiten“ und zeitlich dicht darum herum aufgeschrieben. Dabei ist es mir dann auch nicht um Vollständigkeit gegangen, sondern um das, was mir wichtig erschien. Das mag für den einen oder anderen Leser dann immerwieder einmal sprung- oder lückenhaft wirken. Ich erkläre auch nicht jeden Schritt oder jede Übung ausführlich. Da mache sich jeder ein eigenes Bild.
Besonders ist auch, dass ich in Bemerkungen zum „Dazwischen“ Ideen und Aufsätze oder Vorträge einfüge, die ich andernorts entwickelt oder gehalten habe. Das soll auch meinen eigenen Weg und Einflüsse, die im Kurs zur Geltung kommen, deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass sich nur die Teilnehmer weiterentwickeln, sondern ich selbst bin es ja auch. Aber wo wird das jemals in einer Beschreibung eines Ausbildungskurses dargestellt?
Bevor wir angefangen haben, diese Art der Basisweiterbildung in Polen anzubieten, haben wir ein Curriculum erstellt, in dem für die 8 Workshops die Themen festgelegt wurden. Dabei durfte ich mich daran orientieren, was Volkmar Aderhold in seinen Kursen mit anfangs 15 und sp.ter 7 Workshops für essentiell hielt. Ihm bin ich zu ausserordentlichem Dank verpflichtet, da er mir nicht nur freundschaftlich mit Rat und Tat zur Seite stand, sondern auch ohne mit der Wimper zu zucken, mir alle seine Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, an denen ich mich reichlich bedient habe. Natürlich musste ich mir diese Dinge für meine Zwecke erarbeiten um sie entsprechend zu „besitzen“.
Ich möchte den weiteren Ausführungen eine kurze Beschreibung der einzelnen Workshops voranstellen, um den Überblick zu erleichtern: Diese Beschreibung dient lediglich der Orientierung:
Workshop I: Wer wir sind und wie wir arbeiten wollen
Der erste Workshop steht ganz im Zeichen des Kennenlernens, sowohl untereinander, als auch der Methode. Es gibt eine Einführung in die Geschichte, Methodik und Grundlagen des Open Dialogue, in der vor allem die Prinzipien der Umorganisation wie auch die Haltungsfragen erläutert werden. Das wird verbunden mit Übungen zum Zuhören, dessen Bedeutung frühzeitig herausgestellt wird. Ein wichtiges Ziel ist es, für die Gruppe einen sicheren Ort zu schaffen, an dem jeder gehört wird, jede Stimme zu Wort kommen kann und nach Möglichkeit beantwortet wird. So gibt es Übungen zu Zweit, in kleinen Gruppen und nach jeder Übung das Mitteilen der gemachten Erfahrungen in der Grossgruppe. Im zweiten Teil geht es um die Einführung des Reflektierenden Teams in die Arbeit durch eine Einführung mit anschliessender Übung.
Workshop II: Reflektierende Prozesse und das Netzwerk
Hier beginnt eine Serie von Übungen zum “Umgang mit Gefühlen”, die in Abwandlungen in den nächsten Workshops wiederholt wird. Danach erfolgt eine Erläuterung der 10 möglichen Grundregeln des Reflektierens mit weiteren Übungen. Im Anschluss daran wird die Bedeutung des sozialen Netzwerks für uns Menschen erläutert und die Netzwerkkarte als Werkzeug eingeführt. In einer Übung erstellt Jeder seine eigene Netzwerkkarte und bespricht sie mit einem Partner/ Partnerin mit anschliessendem Austausch in der Grossgruppe.
Workshop III : Krisen und Krisenpläne
Neben der Fortführung der Übung “Umgang mit Gefühlen- Einlegen einer Schweigepause” steht in diesem Workshop das Erarbeiten des Verständnisses dessen, was “Krise” bedeuten kann, im Vordergrund. Neben einer theoretischen Einführung gibt es Übungen zu eigenen Krisen und dem, was in Krisen hilfreich war. Der Krisenplan(KP) wird eingeführt, und jeder Teilnehmer füllt seinen KP aus, der dann in einer Kleingruppe besprochen wird (mit anschliessendem Erfahrungsaustauch in der Grossgruppe).
Workshop IV: Arbeit im Netzwerk
Fortführung der Übung zum “Umgang mit Gefühlen- Akzeptanz” sowie Fortführung des Themas “Netzwerkarbeit”. Dazu gibt es theoretische Erläuterungen, Übungen, Rollenspiele und eine spezielle Übung zur optimalen Nutzung des Dialogs.
Workshop V: Das Genogramm
Fortführung der “Übung zum Umgang mit Gefühlen- Achtsamkeit”. Danach steht das Genogramm im Mittelpunkt. Auf eine Einführung gibt es Zeit für jeden, sein eigenes Genogramm zu erstellen, in der Kleingruppe zu besprechen und sich anschliessend in der Grossgruppe miteinander auszutauschen. Die Erfahrungen aus der Beschäftigung mit dem eigenen Genogramm werden für weitere Übungen genutzt.
Workshop VI: Leben mit dem Trauma
Fortführung der Übung zum “Umgang mit Gefühlen- Gefühlswellen” Danach steht die Erarbeitung eines Verständnisses von Traumatisierung und deren Folgen im Mittelpunkt. Dazu erfolgt eine ausführliche Einführung in das Thema: “Trauma, Traumafolgen und spezifische Behandlung.
Anschliessend wird das Traumamapping erläutert. Jeder erstellt seinen eigenen Traumabogen, bespricht diesen mit einem Partner, und wir tauschen uns anschließend über Erfahrungen aus. Daraus ergeben sich zu vertiefende Aspekte.
Workshop VII: Reframing und zirkuläres Fragen
Fortführung der “Übung zum Umgang mit Gefühlen- Mitgefühl” Die Bedeutung des Reframing wird erläutert und in Kleingruppen geübt. Das zirkuläre Fragen in seinen unterschiedlichen Varianten wird dargestellt und geübt. Spezielle Fragen der Teilnehmer werden aufgegriffen und in Übungen vertieft.
Workshop VIII: ... und was ich unbedingt noch wissen wollte
Fortführung der Übung “Umgang mit Gefühlen- Einfühlen und bewusstes Spüren”
Dieser letzte Workshop ist völlig offen für die Gestaltung durch die Teilnehmer. Für das, was sie an Fragen mitbringen, was sie vertiefen oder wiederholen möchten. Breiten Raum nimmt – zunächst in Kleingruppen - die Frage ein: “Was habe ich für mich, für meinen Beruf gelernt?” Anschliessend erfolgt eine Auswertung/ Evaluation in der Gro.gruppe. Zum Abschluss findet eine achtsame und ausführliche Verabschiedung statt.
Kapitel 1
Workshop I - Wer wir sind und wie wir arbeiten wollen
2014
Nun zum praktischen Teil. Am Beginn jedes einzelnen Workshops steht das gegenseitige Kennenlernen in unterschiedlicher Form. Wir beginnen damit, dass sich jeder vorstellt mit seinem Namen, seinem beruflichen Tätigkeitsfeld und den damit verbundenen Erfahrungen sowie den Erwartungen an den ganzen Kurs oder auch an diesen speziellen Workshop. Sehr angenehm, dass es „nur“ 13 Teilnehmer sind, sodass viel Zeit für diese erste Begegnung bleibt. Die Gruppe ist von den Berufsgruppen her durchaus gemischt, sodass erfahrene PsychiaterInnen neben jungen Ergotherapeutinnen und Krankenschwestern sitzen. Auch Lehrerinnen und eine Angehörige eines psychisch kranken Familienmitglieds gehören zu uns, was es im Hinblick auf unterschiedliche Perspektiven interessant macht.
Nach einer Pause beginne ich mit einer Einführung , in der ich darüber spreche, was das Ziel des Kurses sein kann und erwähne dabei, dass es mir nicht nur darum ginge, Ihnen das Handwerkszeug zur Moderation von Netzwerktreffen beizubringen, sondern es mir genauso wichtig erscheint, sie darin zu unterstützen, über die zu machenden Erfahrungen eine Entscheidung für sich treffen zu können, ob sie mit dieser Methode und Haltung weiter arbeiten möchten. Ich ginge nicht davon aus, dass dies ein Weg für Alle sei, sondern zöge durchaus in Betracht, dass es auch andere Wege gäbe, die zu dem Ziel einer anderen Begegnungsform führen können.
Dann leite ich über zur Beantwortung der Frage: Was verstehen wir unter „Open Dialogue“? Ich spreche über
- die Methode als solche und ihre organisatorischen Inhalte und
- die damit verbundene Haltung
Jeder soll am Ende wissen, wie die Methode in der gemeindepsychiatrischen Arbeit genutzt werden kann und das n.tige Handwerkszeug erwerben, um ein Netzwerkgespräch durchführen zu können. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, sich persönlich mit der Methode auseinandersetzen zu können, um für sich eine Entscheidung zu treffen, ob ihm die Methode liegt und er sie sich zu eigen machen will.
Beide Ziele haben sich für mich bei der Gestaltung der ersten Kurse in Warszawa und Wroclaw, die Ende 2012 begannen und im Oktober 2014 endeten, entwickelt. Geprägt von meinen Vorerfahrungen aus der klinischen Arbeit, in der Verantwortung für vielerlei Mitarbeiter und beseelt von dem Wunsch, das psychiatrische Versorgungssystem einer Region zu verändern oder zu entwickeln, stand die Befähigung der Teilnehmer zu eigenständigem, therapeutischen Handeln ganz im Vordergrund. Die Situation der polnischen Teilnehmer an den Kursen hat mich diese Zielsetzung überdenken lassen. Es gibt zwar ein großes Interesse an einer Haltung in der psychotherapeutischen Arbeit oder Zusammenarbeit mit psychisch Kranken, die sich jenseits der sozialen, fachlichen(biol...
Inhaltsverzeichnis
- Widmung
- Über das Buch
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur 2. Auflage
- Vorwort zur 1. Auflage
- Liste der Workshops
- Kapitel 1: Workshop I - Wer wir sind und wie wir arbeiten wollen
- Kapitel 2: Workshop II - Reflektierende Prozesse und das Netzwer
- Kapitel 3: Workshop III - Krisen- und Krisenpläne
- Kapitel 4: Workshop IV - Arbeit im Netzwerk
- Kapitel 5: Workshop V - Das Genogramm
- Kapitel 6: Workshop VI - Mit dem Trauma leben
- Kapitel 7: Workshop VII - Reframing und zirkuläres Fragen
- Kapitel 8: Workshop VIII - Und was ich noch alles wissen wollte
- Kapitel 9: Nachlese und Anhang
- Anhang
- Die Bedeutung des Dialoges für die Begegnung
- 7. Netzwerktreffen Hometreatment in Stuttgart
- 8. Netzwerktreffen Hometreatment in Köln
- 21. International Network Meeting for the Treatment of Psychosis
- Das Psychiatrische Krankenhaus im Übergang
- Entdecken in Trieste
- Der gegenwärtige Moment
- John Shotter: Ontologische Risiken und Ängstlichkeit in der Kommunikation, wenn wir betrachten Was und Wer wir aus der Sicht Anderer sein dürfen. (Übersetzung durch den Autor) Jahrestagung 2016 der Deutsch- Polnischen Gesellschaft für Seelische Gesundheit in Berlin
- Verschiedene Poster
- Impressum