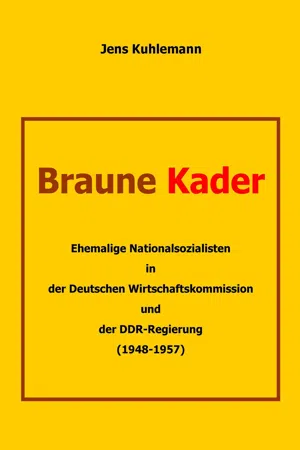![]()
1 Vorgeschichte sowie gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen
Die folgenden Kapitel behandeln Voraussetzungen, die für den Untersuchungsgegenstand grundlegend sind. Sie beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung wie auch auf die Institution der Deutschen Wirtschaftskommission bzw. der DDR-Regierung. Dazu gehört die Theorie der Gesetze und Richtlinien, die dann mit der realen Umsetzung kontrastiert wird. Von besonderem Interesse ist hierbei die Phase der Entnazifizierung, nach deren Abschluss weitere Säuberungen folgten. Dies schließt einen genaueren Blick auf die sozialen Konflikte ein, die sich aus der Ausgrenzung ehemaliger Nationalsozialisten ergaben.
1.1 Entnazifizierung und Säuberung, Gesetze und Richtlinien
Die Grundlagen der Bestrafung und personellen Bereinigung Deutschlands von Nationalsozialisten und ihren Zuträgern gingen auf die Außenministerkonferenz in Moskau 1943, das Treffen von Roosevelt, Stalin und Churchill im selben Jahr in Teheran sowie die Beschlüsse von Jalta und Potsdam 1945 zurück.89 Erklärtermaßen galt es, den deutschen Militarismus und Nazismus zu zerstören und sicherzustellen, dass Deutschland nie wieder in der Lage sein werde, den Weltfrieden zu stören. In der deutschen Nachkriegsverwaltung waren demnach alle nazistischen Staatsbediensteten zu entfernen und durch demokratische Kräfte zu ersetzen. Es sollte sich bald herausstellen, dass die Westmächte und die Sowjetunion verschiedene Faschismus- und Demokratiebegriffe propagierten.90 Die Alliierten unterschieden davon unabhängig frühzeitig zwischen Kriegsverbrechern und aktivistischen Nationalsozialisten einerseits sowie den Mitläufern und der schweigenden Mehrheit des deutschen Volkes andererseits. Nach der deutschen Kapitulation übernahmen die Siegermächte offiziell die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Für die Entnazifizierung von Bedeutung waren die Aufteilung des Landes in vier Besatzungszonen und die Bestimmung, dass die einzelnen Befehlshaber in ihren Zonen die Entscheidungshoheit ausübten. Berlin erhielt einen Sonderstatus und wurde analog in vier Sektoren aufgeteilt.91 Dieses Prinzip begünstigte eine uneinheitliche Durchführung der politischen Säuberung.
Auch die KPD/SED und der Block der Parteien in der sowjetischen Besatzungszone sprachen sich ab 1945 bei verschiedenen Gelegenheiten dafür aus, zwischen der Masse der ehemaligen NSDAP-Mitglieder, die nach einer Umerziehung wiedereingegliedert werden sollten, und den für Faschismus und Krieg verantwortlichen Naziverbrechern zu trennen. Als aktivistisch galt, wer in der NSDAP oder einer anderen NS-Organisation ein Amt mit politischer Verantwortung bekleidet oder sich anderweitig als Träger der NS-Politik betätigt hatte. Die übrigen „nominellen“ NSDAP-Mitglieder sollten nach Meinung der deutschen Parteien von einer Bestrafung ausgenommen und als Staatsbürger anerkannt werden. Dabei sprachen sie die Erwartung aus, dass die Pgs. mit ihrer politischen Vergangenheit vollkommen brechen und sich tatkräftig am Wiederaufbau beteiligen. Sie sollten jedoch in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben nur dann eine Beschäftigung finden, wenn andere Bewerber gleicher Eignung nicht vorhanden waren.92
Die Entnazifizierung auf dem Gebiet der SBZ verlief in den ersten Wochen nach Einmarsch der Besatzungstruppen zunächst spontan und improvisiert. Örtliche Militärkommandeure bedienten sich dabei neu entstandener deutscher Antifa-Ausschüsse. In Zusammenarbeit mit ihnen wurden von April 1945 bis zur Einsetzung der Landes- und Provinzialverwaltungen im Juli 1945 erste Säuberungsmaßnahmen vorgenommen, besonders bei Schlüsselpositionen.93 Dieser Phase folgte eine Reihe von verschiedenen Ländergesetzen und –verordnungen. Die Bedeutung der bestehenden Säuberungsausschüsse ging zugunsten der Landesinnenministerien zurück. Auch die Länder standen aber natürlich weiterhin unter der Aufsicht der sowjetischen Militärregierung, die das letzte Wort hatte.94 Allerdings besaß die SMAD keine eigenen, über die eingangs erklärten Grundsätze hinausgehenden elaborierten Entnazifizierungsrichtlinien. Daher sollten die Länder entsprechende Bestimmungen erarbeiten.95 Nicht alle unterschieden anschließend gleichermaßen zwischen aktiven und nominellen NSDAP-Mitgliedern. Am strengsten verfuhren Mecklenburg und Brandenburg. Am tolerantesten gebar sich Thüringen. Dort wie auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt fanden Belastungskataloge Anwendung, die sich weitgehend auf Eintrittsdaten, Ämter und Funktionen stützten. Sie ermöglichten mal mehr, mal weniger eine Weiterbeschäftigung und eine Abstufung von Bestrafungen.96 Trotz aller Schwierigkeiten, zwischen aktiv und nominell zu trennen, erhielt der Großteil der ehemaligen Pgs. im öffentlichen Dienst bis zu dieser Zeit die Entlassung, vor allem im Fall leitender Funktionen.97 Der größte Teil des Verwaltungspersonals wurde dennoch übernommen.98 Gleichzeitig führten Fachkräftemangel und Versorgungsnöte zu Umgehungen der Entlassungsbestimmungen und zumindest zu temporären Weiterbeschäftigungen.99 Die Länder verabschiedeten darüber hinaus per Gesetz eine Jugendamnestie. Sie gestand all denen, die nach dem 1. Januar 1919 geboren waren und der NSDAP oder ihren Gliederungen nur nominell angehört hatten, die vollen staatsbürgerlichen Rechte zu. Entnazifizierungsverfahren waren bei diesem Personenkreis nicht mehr anzuwenden. Bestimmte Berufe blieben ihnen jedoch trotzdem vorenthalten. Die Jugendamnestie begründete keine Ausnahmen von den späteren SMAD-Befehlen 201, 204 und 35 sowie den Gleichstellungsgesetzen.100
Neben der Verfolgung der hauptverantwortlichen NS-Täter mit Hilfe des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 und der Kontrollratsdirektive 38 erlangte schließlich die Direktive 24 besondere Bedeutung.101 Sie trug das Datum vom 12. Januar 1946, wurde aber in der SBZ erst Monate später bekannt und kam dort etwa ab Dezember 1946 zoneneinheitlich voll zum Tragen.102 Mit der Direktive 24 beschlossen die Siegermächte erstmalig eine für ganz Deutschland geltende, sehr detail- und definitionsreiche Entnazifizierungsrichtlinie. Sie bezog sich neben den aktivistischen auch auf die Masse derjenigen NS-Belasteten, die gemeinhin als Nominelle angesehen wurden. Betroffen waren Unterstützer, Angehörige und Funktionsträger der NSDAP, von NS-Organisationen, der Justiz und Wirtschaft sowie des Staatsapparates. Die zwangsläufig oder nach Ermessen zu verhängenden Entlassungen und Ausschlüsse waren nach Organen, Positionshöhen, Zugehörigkeitszeiten und Aktivitäten in der NS-Ära gestaffelt. Im Vergleich zu den bis dato maßgeblichen Länderregelungen in der SBZ ging mit der Direktive 24 eine Verschärfung der Säuberungsbestimmungen einher.103 Ihre Anwendung in der SBZ wurde wahrscheinlich aus innenpolitischen Gründen verzögert, weil die Ausweitung des Betroffenenkreises zu vermehrten Spannungen führte. Sie kam dann aber aus außenpolitischen Gründen doch noch zur Ausführung. So konnten die Sowjets im März 1947 gestärkt in die Moskauer Außenministerkonferenz gehen. Denn sie boten den Westalliierten weniger Angriffsfläche wegen einer vermeintlich zu nachlässigen Säuberung.104 Tatsächlich wollte die SMAD der sich abzeichnenden Tendenz zur Wiedereinstellung von Pgs. entgegentreten. In der Praxis kam es allerdings erneut zu Unklarheiten und unterschiedlichen Auslegungen der Direktive 24.105
Die Entnazifizierung in (Ost-)Berlin vollzog sich aufgrund des besonderen Status der Stadt etwas anders als in der SBZ. Eine Verfügung Marschall Shukows vom 30. Juni 1945 verschärfte dort die begonnene Entnazifizierung. Sie beinhaltete, alle NSDAP-Mitglieder ausnahmslos und umgehend aus den Diensten des Berliner Magistrats zu entlassen. Für Personalfragen waren beim Magistrat, wie fast überall in wichtigen Organen der SBZ/DDR, politisch zuverlässige KPD/SED-Mitglieder zuständig. Für ehemalige Pgs. bestand eine Pflicht zur Registrierung und zu Sonderarbeitseinsätzen. Zur Umsetzung der Direktive 24 erließ die Alliierte Kommandantur die Anordnung Nr. 101a vom 26. Februar 1946. Sie sah ein System aus diversen Entnazifizierungs- und Berufungskommissionen vor, die sich aus Deutschen mit antifaschistischer Reputation zusammensetzten. Das letzte Wort lag in den einzelnen Stadtsektoren bei der jeweiligen Besatzungsmacht.106 Bis zum 30. September 1947 lag die Quote der Antragsbefürwortung, d.h. einer Entscheidung zugunsten der Pgs., bei zwei Dritteln aller behandelten Fälle. Über die Hälfte aller gestellten Anträge war zu diesem Zeitpunkt aber noch unbearbeitet.107 Das Berliner Verfahren galt als schwerfällig. Die SED war mit den Säuberungserfolgen dennoch relativ zufrieden.108 Im Nachgang zur Entwicklung in der SBZ lösten sich die berufsspezifischen Entnazifizierungskommissionen dann zum 1. Januar 1949 auf bzw. unterhielten nur noch Abwicklungsstellen.109 Am 23. Februar 1949 beschloss der Magistrat schließlich einstimmig den allgemeinen und sofortigen Abschluss der Entnazifizierung im Ostsektor Berlins. Die verbliebenen Entnazifizierungskommissionen stellten ihre Arbeit endgültig zum 28. Februar 1949 ein. Die Berufungskommission beendete ihre Tätigkeit zum 31. März 1949. Bis zu diesen Terminen sollten sämtliche Anträge dahingehend überprüft werden, ob Anhaltspunkte vorliegen, wonach die Appellanten sich eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, den Frieden, die Sicherheit anderer Völker oder das deutsche Volk schuldig gemacht hatten. Diese Fälle waren dem Generalstaatsanwalt beim Kammergericht zu übergeben. Alle anderen laufenden Verfahren – also die weitaus meisten – wurden eingestellt.110 Auch in West-Berlin erließen die alliierten Kommandanten im Februar 1949 den Befehl zur Beendigung der Entnazifizierung.111
In der SBZ fand die Entnazifizierung bereits ein Jahr früher ihr Ende. Es wurde eingeleitet durch den Befehl Nr. 201 der SMAD vom 16. August 1947.112 Die Gründe für den Erlass des Befehls waren außenpolitischer und mehr noch innenpolitischer Natur. Der Ost-West-Gegensatz verschärfte sich. Eine einheitliche Linie im Alliierten Kontrollrat in der Frage der Entnazifizierung war nicht zu erreichen und die schlechte Versorgungslage in der SBZ hatte sich durch Demontagen, Enteignungen und Entlassungen weiter zugespitzt. Die Machthaber mussten daher gesellschaftliche Spannungen abbauen, um die Lage zu konsolidieren. Die Entnazifizierung war hierbei ein wesentlicher Ansatzpunkt. Die Pgs. erhofften sich erneut eine Rehabilitierung und die Rückkehr in die alten beruflichen Positionen. Außer den Nazi- und Kriegsverbrechern gewährte der Befehl 201 allen ehemaligen NSDAP-Mitgliedern neben dem aktiven das passive Wahlrecht. Sein Erlass sollte die bis dahin auf Grundlage der Direktiven 24 und 38 unzureichend beachtete Differenzierung der praktizierten Säuberung überwinden und die Nominellen, Minderbelasteten und NS-Verbrecher stärker voneinander trennen.113 Eine allgemeine gerichtliche Belangung der Nominellen wurde für unzulässig erklärt. Die übrigen Entnazifizierungsverfahren sollten beschleunigt werden. Innerhalb von drei Monaten waren alle NS-Aktivisten aus öffentlichen und halböffentlichen Posten sowie den jeweiligen Stellen in der Wirtschaft zu entfernen. Wegen der Vielzahl der zu behandelnden Fälle ließ sich diese Frist jedoch nicht einhalten.114 Parallel zu SMAD-Befehl 201 ermöglichte der Befehl 204 vom 23. August 1947 ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, wieder im unteren und mittleren Justizdienst tätig zu werden. Die Posten der Richter und Staatsanwälte blieben weiterhin ausgenommen.115
Mit dem SMAD-Befehl Nr. 35 vom 26. Februar 1948 fand die Entnazifizierung in der SBZ schließlich endgültig ihren offiziellen Abschluss. Die erfolgte Entmachtung der „Inspiratoren des deutschen Faschismus und Militarismus“ durch Entzug aller politischen und wirtschaftlichen Positionen ...