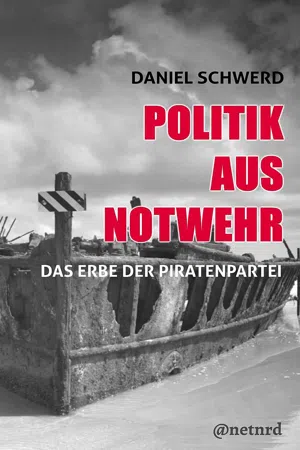![]()
2013
Die Stiefgroßeltern führten für jedes Jahr ein Fotoalbum, in das sie Zeitungsberichte und Fotos einklebten, und mit kurzen Sätzen die Ereignisse der Zeit beschrieben. Die Alben stehen noch heute im Haus. Jeder Gast, der kam, wurde ebenfalls fotografiert, und konnte sich im nächsten Jahr selbst im Album ansehen. Es war ein festes Ritual, das Foto gemeinsam vor der Abfahrt vor dem Haus aufzunehmen.
Manchmal holten die „Alten“ auch ein altes Fotoalbum heraus, und erzählten Anekdoten. Manche Geschichten wurden alle paar Jahre wieder hervorgeholt und neu erzählt, sie veränderten sich nie.
Die beiden hatten schon früher in ihrer Studentenzeit in Italien gelebt. Während des zweiten Weltkrieges war er als Studentenvertreter im Diplomatischen Dienst nach Italien entsandt worden. Besonders gerne und häufig erzählte er die Anekdote, wie er auf einem Staatsempfang beim Kronprinzen und späteren König Umberto II. zusammen mit all den wichtigen Männern auf den Balkon des Palastes in Siena gespült wurde und dem Volk unter ihnen huldvoll zuwinkte. Aber über Nationalsozialismus, Faschismus oder Krieg sprach der „Alte“ nicht.
Der Gaza-Streifen ist kein Konzentrationslager
Am Volkstrauertag im November 2012 nahm mein damaliger Fraktionskollege Dietmar Schulz an einer Gedenkveranstaltung auf einem jüdischen Friedhof teil. In dieser Zeit war der Nahost-Konflikt gerade wieder eskaliert, Raketen wurden von Gaza aus nach Israel abgeschossen, und Israels Luftwaffe bombardierte die Stellungen der Hamas im dicht besiedelten Gazastreifen. Dietmar setzte den folgenden, denkwürdigen Tweet ab: „Grotesk: Gedenken der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg auf jüdischem Friedhof während Israel bombt was das Zeug hält – Volkstrauertag“. Die Verbindung zwischen dem Holocaust einerseits und dem Nahostkrieg andererseits, die er da hergestellt hat, war ausgesprochen dumm und unpassend. Dietmar hat sich (allerdings erst nach einem gründlich misslungenen Rechtfertigungsanlauf) dafür öffentlich entschuldigt.
Dabei gibt es in Israel genug zu kritisieren, ohne dass man zu Dämonisierung oder zu Vergleichen mit dem Dritten Reich greifen muss: Die rechtsgerichtete Regierung. Die fortgesetzte Landnahme und Vertreibung durch die katastrophale Siedlungspolitik. Bevorzugung orthodoxer Gruppen. Probleme der Pressefreiheit. Überzogene Härte von Militär und Polizei. Benachteiligung der arabischen Minderheit im Land.
Die humanitäre Situation in Gaza ist erbarmungswürdig. Die Menschen leben in Not und struktureller Gewalt, Israel trägt zu diesen Zuständen bei. Das ist alles legitime Kritik, die man auch unter Freunden äußern kann und muss. Man sollte Israel in diesen Punkten eben nicht anders behandeln als irgendeinen anderen Staat in der Welt, weder im Guten noch im Schlechten.
Es muss aber möglich sein, Kritik an den Zuständen im Nahen Osten auch ohne Nationalsozialismus-Vergleiche zu äußern, und ohne Israel das Existenzrecht abzusprechen – genauso, wie Palästinenser selbstverständlich jedes Recht haben, in einem Staat friedlich und selbstbestimmt zusammenzuleben. Es muss möglich sein, Kritik an Israel, seiner Regierung und seiner Politik nicht zu einer Diskriminierung von Juden und damit zu Antisemitismus werden zu lassen.
Deutschland hat aus dem zweiten Weltkrieg für sich die folgende Lehre zu ziehen: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Militarismus!“ Israel hingegen hat eine ganz andere Lehre gezogen, sie heißt: „So etwas darf uns nie wieder passieren! Nie wieder wehrlos!“ Und ich finde das vollkommen nachvollziehbar: Aus gutem Grund, aus eigener Verantwortung sollten wir uns mit einer Verurteilung dieser Haltung sehr zurückhalten. Es sollte unsere Aufgabe sein, Israel aus seiner Vorwärtsverteidigungs-Haltung durch unsere verlässliche Solidarität herauszuhelfen, ohne dabei die Palästinenser zu benachteiligen. Die Gewalt von beiden Seiten, sowohl die Raketen der Hamas als auch die Bombenangriffe der israelischen Armee sorgen jedenfalls nur für Leid und Tod, niemals für Frieden.
Insgesamt aber haben wir wohl sehr viel weniger Einfluss als wir meinen, der Nahostkonflikt geht uns letztlich ganz genauso viel an wie jeder andere Konflikt auf dieser Welt. Aber wir sollten die Augen sehr offen halten, wenn es in unserem eigenen Land um die drei D's des modernen Antisemitismus antiisraelischer Prägung geht: Dämonisierung, Doppelstandards, Delegitimation.
P. ist Islamwissenschaftlerin und ehemaliges SPDMitglied. Aufgrund der unentschlossenen Haltung der Sozialdemokraten zu ihrem Genossen Thilo Sarrazin war sie aus der SPD ausgetreten. Seit April 2013 war sie Mitglied der Kölner Piraten. Ihr Lieblingsthema: Der Nahost-Konflikt, dessen Verantwortung sie allerdings einzig und allein Israel zuschob. Auf den Piraten-Diskussionslisten, auf denen sie außerordentlich umtriebig war, nahm sie Dietmars Äußerung natürlich sofort in Schutz. Mehr noch: Es folgten zahlreiche antisemitisch zu empfindende oder holocaustrelativierende Sprüche, wie etwa, dass der Gaza-Streifen ein Konzentrationslager sei. Zionismus könne man mit Nationalsozialismus vergleichen und außerdem strebe er nach der Weltherrschaft, sagte sie.
Ihre Sprüche zogen innerparteiliche, später auch mediale Kreise. Auf Versuche, sie intern zur Mäßigung und Rücknahme ihrer Ausfälle zu bewegen, reagierte sie bockig. Eine Distanzierung und eine sichtbare Maßnahme mussten also her. Und der Kölner Vorstand als Leitung der zuständigen Gliederung war dafür verantwortlich.
Im Dezember hatte der Kreisvorstand deswegen mehrere stundenlange Vorstandstagungen. Ich wollte die Mailinglisten von Köln auf moderiert stellen, also jeden neuen Beitrag vor der Veröffentlichung zunächst prüfen und freischalten lassen, um eine weitere Eskalation der Angelegenheit und Verbreitung der Auseinandersetzungen zu verhindern, sowie um die kritischen Aussagen offline zu nehmen – und erhielt mit Verweis auf die Meinungsfreiheit keine Mehrheit für eine solche Maßnahme im Vorstand. Immerhin beschlossen wir, parteiordnende Schritte als Vorstand beim zuständigen NRW-Schiedsgericht des Landesverbandes zu beantragen. Wegen Privatsphären- und Datenschutz-Argumenten war es aber nicht möglich, diesen Umstand innerhalb der Partei bekanntzugeben. Prompt fand ich mich selbst mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert, denn ich würde als zuständiger Vorsitzender nichts unternehmen, hieß es. Diese Zerreißprobe machte mich auch körperlich fertig, ich erlitt einen Hörsturz, einen Bandscheibenvorfall und hatte wochenlang mit Infektionen zu kämpfen. Noch über ein Jahr später erfuhr ich, dass mein spezieller Kölner Parteikollege A. mich als „P.-Beschützer“ bezeichnete und damit in die Nähe von Antisemitismus rückte.
Angesichts der Machtlosigkeit in meinem eigenen Vorstand und meiner eigenen Betroffenheit in der Sache ließ ich mein Amt als Vorsitzender zunächst ruhen. Für den kommenden Kreisparteitag, der am 14. Januar angesetzt war, stellte ich entsprechende Anträge, die eine deutliche Distanzierung vom Inhalt der Aussagen und der Person zum Ziel hatten.
Der Parteitag war der bestbesuchte Kölner Parteitag aller Zeiten. Die vorangegangenen Auseinandersetzungen hatten viele externe Besucher angelockt. Zu Beginn las der Kölner Journalist und Pirat Peter Finkelgruen, selbst als Kind verfolgter Juden auf der Flucht vor den Nazis in der Diaspora geboren, einen Text vor, in dem er sein Entsetzen über die Aussagen P.s zum Ausdruck brachte. Seine Erschütterung anzusehen ist der schmerzlichste Moment meiner Parteierinnerungen. Ihm standen die Tränen in den Augen.
Als es um die Vorstellung meiner Anträge ging, erzählte ich von eigener Familiengeschichte und Betroffenheit. Peter Finkelgruen hatte den Eindruck gewonnen, dass die Stimmung sich in diesem Moment gegen mich wandte, so sagte er später in einem Interview – Ich selbst kann das nicht so genau sagen.
Die Abstimmungen zu meinen Anträgen fanden dann nicht öffentlich statt. Es gelang mir zwar, eine Distanzierung vom Inhalt der Aussagen mehrheitlich feststellen zu lassen. Als es aber darum ging, durch die Versammlung den Antrag auf Parteiausschluss von P. zu beschließen, gab es einen Eklat: Dafür fand sich keine Mehrheit. Das Hauptargument war, dass wir keine juristische Bewertung treffen sollten, auch das Argument der Unschuldsvermutung wurde vorgebracht. Zudem seien solche Parteiordnungsmaßnahmen Privatangelegenheiten der Gemaßregelten, und daher nicht öffentlich zu diskutieren. Ich wurde teils heftig beschimpft. Schließlich hieß es sogar, ich würde den Kreisverband erpressen.
Das ist auf mehreren Ebenen unsinnig.
Ein Parteiausschluss ist eine parteiordnende Maßnahme. Sie soll eine Wirkung auf die Ordnung der Partei haben. Das kann sie aber nicht, wenn sie geheim ist. Zudem geht es letztlich nicht um eine juristische Einschätzung, sondern um eine politische. Natürlich haben wir die Aussagen von P. als Partei politisch zu bewerten: Ob sie mit unseren Zielen und Grundsätzen in Übereinstimmung sind oder eben nicht. Und das müssen wir selbst tun, das kann nicht irgendein Richter anhand von strafrechtlichen Kriterien für uns erledigen. Und von Unschuldsvermutung zu sprechen ist unsinnig, wenn die Aussagen unwidersprochen und wiederholt, für alle Augen sichtbar sind.
Dieser Vorgang beleuchtet die extreme Rechtsgläubigkeit und den Jurismus sowie die grundsätzlich unpolitische Haltung der Piraten. Eine vernünftige Abgrenzung, die Erstellung und Schärfung eines Profils kann so nicht gelingen. Und zu allem Überfluss wurden die Gefühle von Juden dabei erheblich verletzt.
Ich bin eine Woche später von meinem Vorsitz zurückgetreten, und habe mich aus dem Kreisverband Köln zurückgezogen. Am Wochenende nach dem Parteitag war die Landtagswahl in Niedersachsen, aus Rücksicht auf die Wahlkämpfer in dieser Landtagswahl habe ich mit dem Rücktritt bis danach gewartet, um ihnen negative Presse so kurz vor der Wahl zu ersparen. Noch eine geraume Zeit musste ich mit „Nestbeschmutzer“-Vorwürfen leben. Dass der Rücktritt als Zeichen aber nicht vollkommen falsch war, bewies mir ein Dankesbrief der jüdischen Gemeinde Köln, den ich erhielt, und der mich sehr froh gemacht hat. P. wurde später erfolgreich aus der Partei ausgeschlossen, arbeitet sich aber bis heute gerne mit Verschwörungstheorien in Blogposts und auf Twitter an mir und an anderen beteiligten Personen ab. Ihr Lieblingsvorwurf: Wir seien alle Antideutsche und von Israel, wahlweise durch die Likud-Partei, gesteuert.
Irgendwie jüdisch-sein
Ich bin nicht religiös. Ich bin weder getauft noch gehöre ich einer Glaubensgemeinschaft an. Erzogen worden bin ich humanistisch, früher hätte man das als „gute Kinderstube“ bezeichnet. Am Religionsunterricht in der Schule habe ich nicht teilgenommen. Für meine Mutter war es schwierig, einen Kindergarten und eine Grundschule zu finden, die konfessionslose Kinder aufnahm – in den 1960er Jahren war das noch eine absolute Ausnahme. Letztlich musste man mich täglich zu einem Kindergarten der Quäker bringen, die so pazifistisch eingestellt waren, dass sie den Kindern an Karneval die Cowboy-Pistolen abnahmen.
Unsere Mutter hat meinem Bruder und mir einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn eingepflanzt. Natürlich wurde uns unsere Familiengeschichte erzählt: Die Eltern meiner Mutter galten im dritten Reich als „gemischtrassiges Paar“, da meine Großmutter mütterlicherseits – obgleich christlich getauft, und nie jüdischen Glauben praktizierend – als Jüdin galt. Wir wussten von der Verfolgung und Emigration der Eltern und Geschwister meiner Großmutter, welche diese auch nach dem Krieg niemals wieder gesehen hatte. Auch vom Untertauchen meiner Großmutter mit meiner 1943 geborenen Mutter, sowie der Haft meines Großvaters, weil er sie nicht verraten wollte, wussten wir.
„Mischehen“ fühlten sich im dritten Reich lange Zeit noch einigermaßen geschützt, doch nahm der Verfolgungsdruck während des Krieges immer weiter zu, und schließlich gab es auch in diesen Fällen Deportationen in Vernichtungslager. Seit 1942 wurde immer wieder über Zwangsehescheidungen diskutiert. Letztlich ist es nur einer unfassbaren Kette von Glücksfällen zu verdanken, dass meine Mutter und Großmutter im Rheinland untergetaucht überleben konnten.
Dennoch: Das Judentum spielte bei uns Zuhause keine Rolle, und eine Verbindung zum jüdischen Volk gab es nicht. Nach der rechtlichen Auslegung der jüdischen Überlieferung, der Halacha, gilt als Jude derjenige, der eine jüdische Mutter hat: Obwohl ich also nach dieser rekursiven Definition selbst ein Jude bin, fühlte ich mich nicht als einer.
Das hat sich in den letzten Jahren gerade aufgrund meiner Erlebnisse in der Piratenpartei, meiner Konfrontation mit dem Antisemitismus dort und im Netz sehr geändert. Meine Auseinandersetzung damit, gerade auch der Streit darum hat meine Einstellung dazu gewandelt. Ich bin immer noch nicht religiös oder gläubig, noch folge ich dem strengen jüdischen Traditionskodex. Ich war bis heute noch nicht in Israel zu Besuch. Dennoch identifiziere ich mich mittlerweile ein Stück weit mit dieser Wurzel, die da in mir ist: Ich würde mich nach wie vor nicht als Jude bezeichnen, das fände ich anmaßend, aber ein irgendwie gearteter jüdischer Mensch bin ich, trotzdem. Das ist eine der spannendsten Entwicklungen, die ich in meiner Zeit in der Piratenpartei an mir habe feststellen können. Das macht mir das Leben ganz sicher nicht gerade einfacher, aber andererseits muss ich womöglich ausgerechnet dafür den antisemitischen Angreifern dankbar sein, dass sie mir diesen Umstand des „irgendwie“-jüdisch-Seins vor meine eigenen Augen geführt haben.
Aufstellung in der Pampa
Nach dem Wahlerfolg in Berlin und Saarland und unserem Einzug in Nordrhein-Westfalen folgte noch die erfolgreiche Wahl in Schleswig-Holstein, welches dann die letzte Landtagswahl des Jahres 2012 gewesen ist. Doch die erste Landtagswahl 2013 etwa ein halbes Jahr später in Niedersachsen war für Piraten eine heftige Klatsche. Nachdem Piratenfraktionen triumphal in vier Landesparlamente eingezogen sind, gab es hier nur noch 2,1% der Wählerstimmen. Eigentlich hätte das der Partei zu denken geben müssen, dass es so wohl nicht weitergehen konnte. Doch eine Aufarbeitung gab es nie.
Unbeirrt wurden Kandidaten für die im Jahr 2013 anstehende Bundestagswahl aufgestellt. Die Listen wurden jeweils bundeslandweise gewählt, es folgte eine Reihe von Aufstellungsparteitagen mit personellen Entscheidungen der Länder, mit denen andere Piraten bisweilen öffentlich haderten. In Nordrhein-Westfalen wählten wir am 26. und 27. Januar 2013 in Meinerzhagen – ein eher abgelegener, mit öffentlichen Verkehrsmitteln etwas schwierig zu erreichender Ort. Die NRW-Piraten gaben der Aufstellungsversammlung deshalb den Twitter-Hashtag „#AVPampa“.
Auf die Listen wurde eine ganze Reihe von Neupiraten gewählt, die von anderen Piraten wiederum oft als Trittbrettfahrer empfunden wurden, die aber offenbar ganze Landesverbände überzeugten. Das galt auch für NRW; die Motivation, für solche Leute Bundestagswahlkampf zu machen, war dann verständlicherweise höchst unterschiedlich stark ausgeprägt.
Piraten wendeten ausgesprochen viel Energie dafür auf, Parteitage und deren Form und Fristen peinlich zu überprüfen. Es wurde stets versucht, Parteitage im Nachhinein vor den Schiedsgerichten anzufechten: Würde ihre Ungültigkeit festgestellt werden, wären auch alle ihre Beschlüsse hinfällig. Das war ein beliebtes Instrument, mit dem man unerwünschte Beschlüsse nachträglich zu torpedieren versuchte – allerdings meist erfolglos.
Ob die Einladung zur Aufstellungsversammlung in Meinerzhagen fristgerecht erfolgte, wurde ebenfalls bezweifelt, nachdem der damalige politische Geschäftsführer Alexander Reintzsch die Einladungen terminlich auf den letzten Drücker aussendete, diese aber aufgrund von Serverproblemen erst mit Verzögerung weitergeleitet wurden. Erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist der Aufstellungsversammlung stellte sich heraus, dass der nordrheinwestfälische Landesvorstand schon nach der verspäteten Einladung ein rechtliches Gutachten hatte einholen lassen, welches einen Verstoß gegen die Form und Fristen konstatierte. Dieses Gutachten hatte man dann aber aktiv unter Verschluss gehalten, bis schließlich die Einspruchsfrist des Parteitages verstrichen war. Das war besonders pikant, weil mehrere Landesvorstandsmitglieder selbst auf der Bundestagsliste standen, Reintzsch sogar auf einem der vorderen Plätze. Das war ein Super-Gau, was Forderungen nach Transparenz angeht, wie sie die Piraten in politischen Prozessen stets formulierten: Im Landtag beispielsweise forderte die Piratenpartei die Offenlegung aller Gutachten und Studien der Landesregierung, selbst aber wurde hier durch die Partei ein unangenehmes Gutachten unterdrückt. Leider war dies nicht der einzige Fall von Transparenz-Bigotterie: Wenn es um eigene Belange ging, waren Piraten oft sehr selektiv. Die Piratenfraktion NRW beispielsweise beschloss, Angebote für Dienstleistungen auszuschreiben und zu veröffentlichen – führte das dann später aber nicht durch.
Erst nach erheblichen Protesten traten die Vorstandsmitglieder von ihren Listenpositionen zurück. Der Schaden an der Glaubwürdigkeit war aber angerichtet worden und blieb bestehen.
Summer of Love
Trotz meines etwas getrübten Verhältnisses zum Kölner Kreisverband versuchte ich die Aktionen, die im Sommer 2013 auf der Tagesordnung standen, zu unterstützen.
Die traditionelle Demonstration in Köln anlässlich des Christopher Street Day fand am 7. Juli 2013 statt. In Köln ist das ein Großereignis mit nahezu einer Millionen Zuschauern – Piraten organisierten ebenfalls einen Wagen, in jenem Jahr den Piraten-Doppeldeckerbus mit „Cabrio“-Dach, welches wir dann geöffnet hatten. Auch in den Vorjahren hatte ich an den Umzügen teilgenommen – ich fühlte mich in der Pflicht, als lokal zuständiger Abgeordneter der Piratenpartei weiter anwesend zu sein. Natürlich machte es Spaß, die Stimmung aber war sehr viel angestrengter als im Vorj...