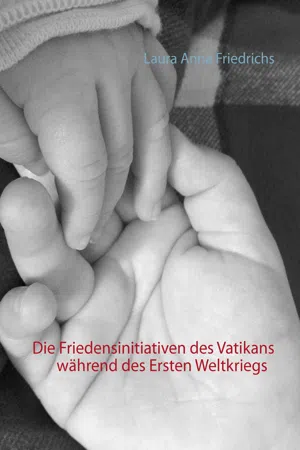![]()
V. Hauptteil: Die Friedensinitiativen des Vatikans 1914 - 1918
V.1. Enzykliken, Mahnrufe und Benedikts „Friedensgebet“
„Seitdem Wir durch Gottes geheimnisvollen Ratschluß auf den apostolischen Stuhl erhoben wurden, haben Wir während der ganzen Kriegsdauer nie aufgehört Unsere ganze Kraft dafür einzusetzen, daß alle Völker der Erde sobald als möglich den gegenseitigen, friedlichen Verkehr wieder aufnehmen möchten: daher ließen Wir nicht ab durch inständige Bitten, wiederholte Mahnungen, Vorschläge zu Friedensvorverhandlungen einen gerechten und dauerhaften Frieden mit Gottes Hilfe zu vermitteln. Bis dieser zustande käme, gaben Wir in väterlicher Liebe Uns alle Mühe, die großen Leiden und Nöten aller Art, diese unmittelbaren Folgen eines so schrecklichen Krieges, einigermaßen zu lindern.“169
Papst Benedikt XV. erteilt mit dieser Enzyklika am 23. Mai 1920 während der Pfingst-Feierlichkeiten in Rom dem Klerus und den Gläubigen den apostolischen Segen. Aber er erinnert auch an den Ersten Weltkrieg, das Leid der Menschen, die Machtlosigkeit des Heiligen Stuhls und die Friedensbemühungen seitens des Papstes. Benedikt blickt zurück auf vier Jahre, in denen er unablässig für Frieden gekämpft hat und mit seinen unzähligen Hilfsmaßnahmen die Kriegsleiden versucht hat zu lindern. Nun ist fast ein Jahr vergangen seitdem in Versailles der Friede unterzeichnet wurde. Mit diesem Rundschreiben greift der Pontifex noch einmal die für ihn wichtigen Punkte aus vorangegangenen Enzykliken, Mahnrufen und Gebeten auf. So postulierte Benedikt unter anderem in seiner Friedensnote vom 1. August 1917 einen „gerechten und dauerhaften Frieden“170 Dass dieser Friede nicht vollends eingetreten ist, wird im einleitenden Teil der Enzyklika deutlich, in dem Benedikt die immer noch vorhandenen „Bitterkeiten“ und „Keime der alten Feindseligkeiten“171 bedauert.
„Mit der Friedensenzyklika Pacem Dei munus172 vom 23. Mai 1920, die die päpstliche Position und seine Erfahrung im Kontext der Friedenssicherung der ersten Nachkriegsmonate zusammenfassend widerspiegelt, schloß der Hl. Stuhl gewissermaßen die Kriegs- und Konferenzära inhaltlich und programmatisch ab“173, resümiert Stefan Samerski. Die Enzyklika hebe zwar die Idee einer alle Staaten umfassenden Konföderation zur Sicherung und Aufrechterhaltung sowohl der internationalen Ordnung als auch der persönlichen Freiheit eines jeden Bürgers hervor; „doch [würden] […] besondere, vom Papst hervorgehobene Merkmale eine direkte Identifizierung mit dem Völkerbund [verbieten]. Eine solche Konföderation solle nämlich der allgemeinen Notwendigkeit entsprechen, den Frieden durch Abrüstung und Garantie der Unabhängigkeit des Volkes sowie der Integrität seines staatlichen Territoriums zu sichern.“174
Der Heilige Stuhl wurde nicht Mitglied im Völkerbund – im Gegensatz zu Deutschland, das am 10. September 1926 als neues Mitglied begrüßt wurde.
Im Folgenden soll ausschließlich ein Überblick über die zahlreichen, aber leider wenig erfolgreichen Enzykliken, Mahnrufe und Gebete gegeben werden, welche bereits kurz nach dem Amtsantritt Benedikts den päpstlichen Alltag maßgeblich mitbestimmt haben. Am 8. September 1914, also nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt, erging vom Heiligen Stuhl der erste Friedensappell Papst Benedikts XV. anlässlich seines Regierungsantritts („Ad universos orbis catholicos hortatio“ – „Mahnruf an alle Katholiken des Erdkreises“175). Diese Hortatio176 markiert den ersten konkreten Friedensappell des neuen Pontifex. Sie berichtet vom „entsetzlichen Kriegsschauspiel[…]“, das die Kurie mit einem „unbeschreibliche[n] Schrecken und große[r] Bitternis“ erfülle. Der Krieg habe „einen so großen Teil Europas durch Feuer und Schwert verwüstet und mit Christenblut [ge]rötet.“ Der Papst habe von daher den „feste[n] Entschluß“, dass er „nichts […] unterlassen“ werde „um das Ende des Unglücks zu beschleunigen“. Auch verweist die Apostolische Mahnung auf den Appell des Vorgängers vom 2. August 1914 zum Frieden. Auch Pius X. hatte bereits zur Wiederherstellung des Friedens gemahnt.177 Beide Appelle, vom 2. August und 8. September, waren an „alle Katholiken des Erdkreises“ gerichtet. Pius wandte sich zudem an den Klerus und Benedikt richtete seinen Appell sowohl an „die Diener des Herrn“ als auch im letzten Abschnitt seines Appells an „jene, welche die Geschicke der Völker leiten“. Beide Päpste beschwörten und ermahnten insbesondere den Klerus zu Gott zu beten, damit dieser „die Geißel seines Zornes […] niederlegt“178 und somit „die Fackel des Krieges lösche“179 Über den „barmherzige[n] Gott“ sollen die „Lenker[…] der Staaten“ wieder „Gedanken des Friedens“ fassen.180 Benedikt dagegen ermahnt die Regierenden direkt, sie mögen „um des Wohles der menschlichen Gesellschaft willen die Zwietracht beiseite setzen, […] und sich die Hand reichen.“ Wenn sie dazu bereit seien, dann werden sie sich „hohe Verdienste um die Zivilisation erwerben.“ In der Friedensnote vom August 1917 wird dieser Passus am Ende in ähnlicher Form erneut auftauchen.181
Keine acht Wochen später publizierte der Vatikan ein auf den 1. November 1914 datiertes apostolisches Sendschreiben des Papstes („Ad beatissimi Apostolorum Principis“).182 Benedikt bekräftigt auch hier – wie in seiner Antritts-Hortatio183 –, dass 1. sein „Blick voll Wohlwollen und Liebe […] alle Menschen […]umfasst.“ Und 2., dass er den „unsagbare[n] Drang von Verlangen und Liebe [habe], aller Menschen Heil zu Wirken.“ Auch hier beklagt der Pontifex erneut den „tief traurige[n] Zustand der menschlichen Gesellschaft“, der sein „Herz“ mit „herbe[m] Schmerz“ getroffen habe. Obwohl die Worte variieren, bleibt doch die Kernaussage erhalten: der Wunsch nach Frieden und der Appell diesen Zustand schnellst möglich wieder herbeizuführen.
„Seit Menschengedenken“ habe es nichts „schrecklicher[es] und trauriger[es]“ gegeben als diesen Krieg. Der Krieg beschäftige die Menschen in all ihrem Tun und Handeln und „überall [gäbe es hier nur noch] Tod und Zerstörung.“ Mit sehr deutlichen Worten blickt Benedikt in die Zukunft und verdeutlicht wie verheerend jeder weitere Kriegstag werden könnte. Erneut wiederholt er die Pius-Worte vom 2. August und „beschwör[t] […] diejenigen, welche das Zepter führen und die Staaten beherrschen […] sich zu beeilen den Völkern die erhabenen Segnungen des Friedens wiederzugeben.“ Er erbittet sich die Hilfe Gottes und das Gehör derer, „in deren Händen die Geschicke der Völker ruhen.“ Obgleich in allen schon verfassten Schreiben und ebenso in allen noch folgenden die Grundgedanken stets dieselben zu sein scheinen, wird doch eine Steigerung in der Wortwahl und Konkretisierung deutlich: In diesem Zusammenhang ist der nächste Satz des Sendschreibens von größter Wichtigkeit: „Es stehen ja ganz andere Wege offen, es gibt andere Mittel, verletzte Rechte wiederherzustellen.“ Benedikt erkennt gewissermaßen unterschwellig an, dass Unrecht begangen wurde, an wem und durch wen lässt er indessen offen. Aber er betont auch, dass nicht der Kampf mit der Waffe dazu geeignet ist dieses Unrecht wieder gut zu machen! Der Papst appelliert konkret an die Vernunft der Staatsoberhäupter, sich nicht mit Rache- oder Revanchegedanken auf das Schlachtfeld zu begeben, sondern friedlich zu verhandeln „und unterdessen die Waffen ruhen [zu] lassen!“
In der zweiten Hälfte seines Sendschreibens spricht der Pontifex über „ein anderes schreckliches Übel“, was er „als die wahre Ursache dieses entsetzlichen Krieges betrachtet“: Die Abkehr von der christlichen Lehre in den Verfassungen der Staaten führe zwangsläufig zu einer „Verwirrung der Geister und Verwilderung der Sitten.“ Die christliche Lehre sei „die sicherste Bürgschaft für Festigkeit und Bestand der staatlichen Ordnung“; ohne sie seien „die Staaten notwendigerweise selbst in ihren Grundfesten erschüttert worden und ins Wanken gekommen.“ Auf welche Weise dies genau geschehen ist, führt der Papst weiter aus, darunter z.B.: Missachtung von Autoritäten und ungerechter Stände- und Klassenkampf sowie Gier und Mangel an Liebe. Nur wenn „den Grundsätzen des Christentums aufs neue Geltung“ verschafft werde und damit diese Übel ausgerottet sind, könne der Frieden wieder hergestellt werden.
Abschließend erfleht Benedikt erneut „ein baldiges Ende dieses so unheilvollen Krieges“, betont aber auch, dass es die Kirche schwer habe, da sie „schon seit langem […] nicht mehr die volle Freiheit [genieße], deren sie bedarf […].“ Als „Schutzmittel“ für die päpstliche Freiheit führt Benedikt die Freiheit des Papstes gegenüber dem „Einflusse irdischer Machthaber“ an. Um so „wahrhaft frei [zu] sein und durchaus frei vor aller Welt [zu] erscheine[n].“
So schließt Benedikt sein Sendschreiben mit zwei Wünschen: 1., „daß die Völker möglichst bald miteinander Frieden schließen“ und 2., „daß für das Haupt der Kirche jene unnatürliche Lage aufhöre, die dem Frieden der Völker aus vielen Gründen so großen Schaden zufügt.“
Damit stellt dieses apostolische Schreiben – neben der Friedensnote von 1917 – den größten päpstlichen Eingriff in politische Belange dar; es geht hierbei nicht nur um die Erflehung des Friedens und um eine mehr oder weniger direkte Mahnung an die Regierenden, sondern es werden auch konkrete politische Ziele des Apostolischen Stuhls angesprochen: die Lösung der Römischen Frage.
Am 10. Januar des folgenden Jahres veröffentlichte der Heilige Stuhl ein vom Papst persönlich verfasstes und verordnetes Friedensgebet184 der katholischen Kirche während des Weltkriegs. Das Friedensgebet war mit einem päpstlichen Erlass „über die Feier eines allgemeinen Sühn- und Bittages zur Erflehung des Friedens“185 verbunden. Der „Gott der Barmherzigkeit“, der „Friedenskönig“ wird angefleht „diese schreckliche Geißel“ des Krieges abzuwenden und „den ersehnten Frieden“ zu erreichen. Mit diesem Gebet erflehen die Menschen die göttliche Barmherzigkeit, damit sie ihnen „auch in dieser Stunde, […] mit ihrem verhängnisvollen Hasse und dem entsetzlichen Blutvergießen“ beistehe und sich ihrer „erbarme“ – „so vieler Mütter“, „so vieler Familien“ und „des unglücklichen Europa[s]“. Zum Ende folgt die Bitte, Gott möge „den Herrschern und auch den Völkern Gedanken des Friedens ein[geben]“, so dass der „Streit, der die Nationen entzweit“ aufhöre und sich alle Menschen – da sie Brüder seien! – wieder „in Liebe“ zusammenfinden. Gott möge der „stürmisch bewegten Welt wieder Ruhe und Frieden“ geben und die „allerseligste Jungfrau“ die Menschen „beschütze[n]“ „und rette[n]“. Um diese Barmherzigkeit Gottes zu erreichen und damit auch den Frieden gab der Papst am 10. Januar durch Staatssekretär Gasparri einen „Erlaß über die Feier eines allgemeinen Sühn- und Bittages zur Erflehung des Friedens“186 heraus. Es sollen „Werke der Buße“ verrichtet werden „um die Sünden zu sühnen“. Dafür sollen „in der ganzen katholischen Welt […] inständige Gebete verrichtet werden, um von Gottes Barmherzigkeit den ersehnten Frieden zu erlangen.“187, dazu zählt auch das Friedensgebet, „das der Heilige Vater eigens verfaßt hat, um den Frieden zu erflehen.“188
Die erste direkte „Apostolische Mahnung an die kriegführenden Völker und ihre Oberhäupter“189 erließ Papst Benedikt schließlich am 28. Juli 1915, als äußerer Anlass diente der erste Jahrestag der österreichisch-ungarischen Kriegserklärung an Serbien.
Benedikt führt direkt zu Beginn seiner Mahnung den Grund des frühen Todes seines Vorgängers – Pius X. – auf den „Schmerz über den kurz vorher in Europa entflammten Bruderkrieg“ zurück. Er selbst empfinde „den Schmerz eines Vaters, der sein Haus verwüstet und öde gemacht sieht von einem wütenden Wettersturm“, wenn er seinen „Blick auf die blutgetränkten Schlachtfelder“ richtet. Wie in seinen vorherigen Äußerungen spart auch hier der Heilige Vater nicht mit deutlichen Worten um den Krieg zu beschreiben. Mit seiner Mahnung will er zudem all der Gefallenen des letzten Jahres gedenken und an den Schmerz der Hinterbliebenen erinnern, darum fasst er (alle apostolischen Schreiben und Kundgebungen sind in der ersten Person Plural verfasst!) „in Anteilnahme an Angst und Weh unzähliger Familien und im Vollbewußtsein der gebieterischen Pflichten der Sendung des Friedens und der Liebe […] den festen Entschluß, […] [seine] ganze Tatkraft und […] [seine] ganze Macht der Versöhnung der kriegführenden Völker zu weihen […].“ So waren „Worte des Friedens und der Liebe […] die ersten Worte“, die er „an di...