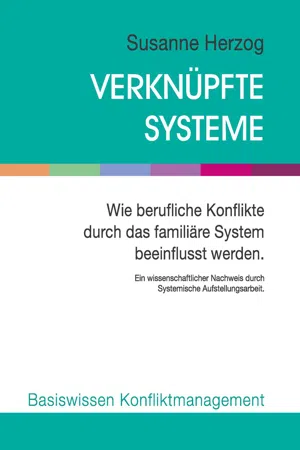![]()
1 EINLEITUNG
Der Mensch als Individuum ist Teil eines komplexen sozialen Gefüges. Er wird in ein Familiensystem hineingeboren, und die Familie trägt unter Einfluss kultureller Gegebenheiten wesentlich zu seiner Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation bei. Personen erfahren und lernen im familiären System und weiteren Institutionen bestimmte Bindungsstile, Verhaltensweisen, Rollen, Denkmodelle, Werthaltungen und Kommunikationsmuster kennen, die ihre weitere Entwicklung beeinflussen.
Der Mensch bewegt sich in seinen unterschiedlichen Lebensrollen als Kind, Schüler, Elternteil, Erwachsener, Berufstätiger, usw. in verschiedenen komplexen sozialen Systemen und steht mit anderen Systemmitgliedern in Verbindung und Interaktion. Unterschiedliche Persönlichkeits- und Motivstrukturen, divergierende Sichtweisen und persönliche Wahrheiten führen zu Spannungsfeldern zwischen Individuen. Beziehungskonflikte sind im menschlichen Zusammenleben üblich und bieten Chancen zur Veränderung und Weiterentwicklung. Eskalierende Konflikte führen zu Dynamiken und Verhaltensmustern, die von den Beteiligten nicht bewusst wahrgenommen werden. Lebensqualität und Qualität der Beziehung im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz erfahren Einbußen.
Arbeitsplatz und Entlohnung garantieren dem Individuum und der Gesamtgesellschaft Existenzsicherung und Erfüllung grundlegender materieller Bedürfnisse. Dabei sind in der modernen Gesellschaft Spezialisierung und Zusammenarbeit zwingend notwendig. Menschen erweitern durch ihre Arbeitstätigkeit ihr soziales Umfeld und ihren Horizont, entwickeln über das Berufsbild soziale Identität und erfahren unter sicheren Bedingungen Stabilität, die sie in das private Umfeld mitnehmen.
Unternehmen erzielen in der postindustriellen Gesellschaft Wettbewerbsvorteile durch Informations- und Wissenssicherung über Bildung und konstruktive Kommunikation. Durch ein funktionierendes Zusammenspiel von Individuen in Familie, Bildungseinrichtungen, Wirtschaft mit ihren Institutionen und existenzsichernden Unternehmen, durch sozial- und gesellschaftspolitische Maßnahmen und Investitionen in Entwicklung, Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Kultur wird die Basis für friedvolle gesellschaftliche Strukturen geschaffen. Eine Gesellschaft ist geprägt durch psychische, emotionale und soziale Intelligenz, Stabilität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder. Diese Kompetenzen und Fähigkeiten werden durch die Gesellschaft im Sozialisationsprozess vermittelt und erworben.
Unternehmen bieten in ihrer Rolle als Arbeitgeber Möglichkeiten formeller und informeller sozialer Beziehungen und gruppendynamischer Prozesse. Diese tragen wesentlich zum tertiären Sozialisationsprozess bei und ermöglichen Aktualisierungen bisher erworbener Strukturen und Erfahrungen von Menschen.
Eine Unternehmenskultur, die bei anhaltenden Kommunikationsschwierigkeiten, belastenden Spannungsfeldern oder andauernden Konflikten komplexe professionelle Konfliktbearbeitung bzw. Mediationsverfahren umsetzt, nimmt soziale Verantwortung wahr und trägt zur Sicherung des Unternehmenserfolgs und der Unternehmensressourcen bei.
1.1 Problemstellung
Organisationen und Unternehmen sind in der wissensintensiven Gesellschaft zunehmend auf die Ressource Mensch angewiesen. Die humane Arbeitskraft stellt einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Wissen und Information wird über Kommunikation weitergegeben, Kommunikation setzt soziale Beziehung voraus. Unternehmensstruktur und Systemordnung, Unternehmensziel, Firmenphilosophie, Führungsverhalten, gruppendynamische Prozesse und der Mensch als Individuum mit seinen Prägungen und Erfahrungen bieten Potenzial für Spannungsfelder und Konflikte. Konflikte sind sozial, da sie aus Kommunikation entstehen.
Resiliente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte greifen in Veränderungssituationen und informellen Spannungsfeldern auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zurück und nutzen ihr Konfliktlösungspotenzial, soweit die Unternehmensstrukturen dies zulassen. Das Konfliktverhalten kann nicht mehr konstruktiv gesteuert werden, wenn
- diese Ressourcen fehlen oder blockiert sind,
- destruktive Verhaltensweisen präsent sind,
- implizite Verhaltensdynamiken aus dem Familiensystem unbewusst ein Gegenüber im beruflichen System finden,
- unbewusste destruktive Glaubenssätze Verhalten und Kommunikation beeinflussen,
- Übertragungen aus dem Familiensystem stattfinden,
- die berufliche Systemordnung Störfaktoren aufweist,
- gruppendynamische Prozesse undurchschaubar werden,
- Konflikte eskalieren und zu Veränderung der Perzeption führen.
Fortdauernde und ungelöste Konflikte beeinträchtigen psychosoziale Fähigkeiten und seelisches Befinden der Beteiligten und tragen wechselwirkend zur Eskalation oder Fixierung bei. Die Interventionen in der Konfliktbearbeitung hängen vom Eskalationsgrad und von der Art der Beziehungen zwischen den Parteien ab.
Nachhaltige Wirkungen werden dann erreicht, wenn der Konfliktkern (das, worum es wirklich geht) erkannt wird, wenn den Beteiligten Unbewusstes bewusst wird, wenn Haltung und Verhalten verändert werden, und bereits stattgefundene seelische Beeinträchtigungen heilen dürfen.
1.2 Ziel und Zweck der Arbeit
Ziel der Arbeit ist festzustellen, ob Systemische Aufstellungsarbeit die komplexe Dynamik von Beziehungskonflikten am Arbeitsplatz und deren Ursprung sichtbar macht, wenn dieser im familiären System zumindest einer bzw. eines Konfliktbeteiligten liegt. Die Aufstellungsarbeit erfolgt als Anliegen aus der Sicht einer bzw. eines Konfliktbeteiligten (Klientin, Klient), weitere Beteiligte werden mittels Repräsentantinnen und Repräsentanten vertreten. Die erforschten Phänomene lösungsfokussierter Systemischer Aufstellungsarbeit werden dabei genutzt. Es soll festgestellt werden, ob die belastende Dynamik mit Beteiligten am Arbeitsplatz ident ist mit der Dynamik zu Mitgliedern aus der Herkunftsfamilie oder Gemeinsamkeiten aufweist, ob übernommene Glaubenssätze aus dem Familiensystem im beruflichen System präsent sind, bzw. ob es weitere Übereinstimmungen der Dynamik des familiären Systems oder Verhaltensweisen aus dem familiären System mit dem beruflichen gibt.
Dabei sind die Entwicklung des Individuums im Sozialisationsprozess mit relevanten Einflussfaktoren auf seine Persönlichkeit, Verhalten, Kommunikation und Kommunikationsstile, das Rollenverständnis des Menschen und seine Interaktionsmuster in Konfliktsituationen in sozialen Systemen zu betrachten.
Die theoretische und wissenschaftliche Darstellung aus den Disziplinen Psychologie, Soziologie, Neurowissenschaften, Kommunikationsforschung, Konfliktforschung und Systemtheorie sollen einerseits einen fundierten Einblick in menschliche Verhaltensweisen und deren Entstehen geben. Andererseits soll ein Einblick in die Komplexität von Kommunikation und Verhalten beim Zusammentreffen mehrerer Individuen geschaffen werden und die Bedeutung der systemischen Sichtweise integriert werden.
Praktische und theoretische Erkenntnisse aus Erfahrungen namhafter Vertreterinnen und Vertreter Systemischer Aufstellungsarbeit untermauern die Anwendungs- und Interventionsmöglichkeiten Systemischer Aufstellungsarbeit.
Beobachtung und Schlussfolgerungen qualitativer empirischer Sozialforschung in Form von videodokumentierten Fallstudien aus Systemischer Aufstellungsarbeit mit Klientinnen und Klienten in beruflichen Konfliktsituationen sollen Zusammenhänge zwischen dem beruflichen und familiären System darstellen. Sie sollen verdeutlichen, dass Konfliktbearbeitung dann nachhaltig wirkt, wenn den Konfliktbeteiligten Ursprung und Dynamik ihres Verhaltens und ihre individuelle Wahrnehmung und Sichtweise bewusst werden, um diese im nächsten Schritt verändern zu können.
1.3 Hypothese
Aufgrund der Problemstellung wird folgende Hypothese formuliert:
Durch Systemische Aufstellungsarbeit wird sichtbar gemacht, dass Beziehungskonflikte am Arbeitsplatz ihren Ursprung im familiären System haben.
Die Hypothese wird durch Literaturrecherche und qualitative empirische Sozialforschung untermauert.
1.4 Aufbau der Arbeit
Der erste Teil der Arbeit gibt in Kapitel eins einen Überblick über die Entwicklung und Prägung des Individuums in komplexen sozialen Systemen. Es beschreibt die Notwendigkeit einer komplexen Betrachtungsweise in Konfliktsituationen und den gesellschaftspolitischen Aspekt der Konfliktbearbeitung in Unternehmen.
In den theoretischen Grundlagen in Kapitel zwei werden die in der Hypothese verwendeten Begriffe definiert. Damit werden ihre unterschiedlichen Verwendungsformen dargestellt und die Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit festgelegt und abgegrenzt.
Kapitel drei befasst sich mit der Bedeutung der Familie für das Individuum als biologischer Notwendigkeit zur Existenzsicherung und der persönlichen Entwicklung. Dabei werden die verschiedenen Bindungsarten, prägende Störfaktoren, deren Einfluss auf die neuronalen Strukturen und auf menschliche Verhaltensweisen dargestellt.
Kapitel vier stellt ergänzend die weitere Sozialisation des Menschen als Drei-Phasen-Modell dar und nimmt themenübergreifend Bezug auf Kommunikations- und Beziehungsdynamiken. Der Begriff der seelischen Axiome wird erläutert.
In Kapitel fünf werden komplexe soziale Systeme mit ihren wesentlichen Eigenschaften dargestellt und auf systemtheoretische Grundlagen eingegangen.
Die Spannungsfelder am Arbeitsplatz im Hinblick auf Beziehungskonflikte werden in Kapitel sechs behandelt. Dabei wird auf gruppendynamische Prozesse, unterschiedliche Konfliktarten und deren Folgen eingegangen. Die stufenweise Eskalation von Konflikten wird beschrieben.
Kapitel sieben gibt einen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Systemischen Aufstellungsarbeit und stellt bekannte Vertreterinnen und Vertreter und relevante unterschiedliche Methoden und Anwendungsformen dar.
Kapitel acht stellt die Möglichkeiten eines Perspektivenwechsels dar und beschreibt, wie Bilder in unserem Kopf entstehen, welche Fehlerquellen die menschliche Wahrnehmung birgt, und aus welcher Motivation heraus Menschen versuchen, ihre Probleme zu lösen.
Kapitel neun beschäftigt sich mit der Auswahl und Rechtfertigung des Forschungsdesigns und Systemischer Aufstellungsarbeit am Feld. Die Beobachtungen Systemischer Aufstellungsarbeit in Beziehungskonflikten am Arbeitsplatz werden in Form von Einzelfallstudien dargestellt. Im Anschluss daran erfolgen in Kapitel zehn Erkenntnisse der Forschungsarbeit, Schlussfolgerungen und die Überprüfung der Hypothese.
![]()
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Die theoretischen Grundlagen dienen als Arbeitsbasis. Unterschiedliche Bedeutungsmöglichkeiten der in der These verwendeten Begriffe werden dargestellt und auf ihre Anwendung im Bezug zur wissenschaftlichen Arbeit abgegrenzt.
2.1 Begriff: Ursprung
Das Nominalpräfix Ur- bezeichnet „[…] jemanden oder etwas als Ausgangspunkt, als weit zurückliegend, am Anfang liegend […] etwas als das Erste“1. Damit wird bereits mit der Vorsilbe ein Anfang, eine Abfolge oder ein am Beginn liegender Sachverhalt benannt.
In der Mathematik ist der Ursprung „[..] der Schnittpunkt der Koordinaten-Achsen in einem geradlinigen (im Originaltext farbig und unterstrichen), d.h. kartesischen (im Originaltext farbig und unterstrichen) (rechtwinkeligen) oder schiefwinkeligen (im Originaltext farbig und unterstrichen) Koordinatensystem. Die Werte seiner Koordinaten sind Null.“2. Der Ursprung ist jener Punkt im Koordinatensystem, an dem die Koordinaten den Wert Null annehmen.
Der Begriff Ursprung entstammt dem mittelhochdeutschen (mhd.) ursprunc, und dem althochdeutschen (ahd.) urspring. „Das Wort bedeutet zunächst ’Quelle’ (im eigentlichen Sinne) und gehört als alte Nominalbildung zu erspringen (im Originaltext kursiv), für das wir heute entspringen (im Originaltext kursiv) sagen.“3 Im allgemeinen Sprachgebrauch entspringt ein Fluss an einer Quelle (Ursprung), er nimmt seinen Ausgangspunkt dort, wo das Gewässer erstmals an die Erdoberfläche tritt und eine fortlaufende Fließstrecke bildet. Ursprung definiert somit einen Zeitpunkt, einen Ort oder einen Umstand, aus dem etwas hervorgeht.
Der Ursprung ist abzugrenzen vom Synonym Ursache als „etwas (Sachverhalt, Vorgang, Geschehen), was eine Erscheinung, eine Handlung oder einen Zustand bewirkt, veranlasst […]“4, somit als Anlass, Grund, Auslöser, Kausalität.
Ursprung ist als Beginn, Anfangs- und Entstehungszeitraum, Zeitraum der Herausbildung zu verstehen. Er stellt keine sichtbare sondern eine bewusste oder unbewusste Kognition im Sinne mentaler Prozesse und Strukturen, Wahrnehmungen und Handlungsmuster in der Vergangenheit dar.
2.2 Begriff: Sichtbar machen/visualisieren
Das englische Verb visualize wird im Deutschen mit veranschaulichen, visualisieren, sich vorstellen, sichtbar machen, sich vor Augen führen, sich ein Bild machen von, und aus dem Lateinischen visus (gesehen, Anblick), spätlateinisch visualis (zum Sehen gehörend) übersetzt. Sichtbar bedeutet „[..] mit den Augen wahrnehmbar, erkennbar [..] deu...