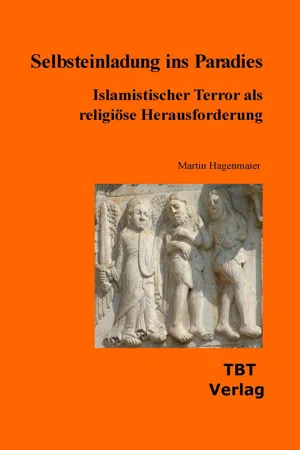![]() Perspektiven zum islamistischen Terrorismus
Perspektiven zum islamistischen Terrorismus![]()
1 Fundamentalismus und religiöser Wahn
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und ihre Folgetaten haben nicht nur die politische Welt in Aufruhr versetzt und verändert. Sie brachten etwas mit sich, was die Wahnerkrankungen nie oder jedenfalls ganz selten erzeugen: Sie schufen auch für die Religionen einen neuen Bezugsrahmen, dessen sich die wenigsten richtig bewusst geworden sind. Vielfach wurde dieser Bezugsrahmen einfach abgelehnt, weil Religion ‚nichts mit Gewalt zu tun’ habe. Es ist aber nicht mehr möglich, ohne diesen Bezugsrahmen über Religion zu sprechen. „Sind Religionen gefährlich?“ fragte der evangelische Theologe Rolf Schieder (mit etwas Verzögerung) aus Sicht der christlichen Theologie.33 Sogar ein Buchtitel wie „Gewalt als Gottesdienst“34 oder die Formulierung „Gewaltmystik“35 sind möglich.
Christliche Theologie und Kirchen beschäftigten sich zunächst im Wesentlichen mit den nahe liegenden Fragen vom Kriegseinsatz gegen Terroristen, gegen den Irak und andere. Wenige protestierten gegen den Einsatz von Waffen gegen das terroristische Netzwerk, sehr viele intensiv gegen den Irakkrieg. Der Paradigmenwechsel ging im Irakkrieg nahezu unter, weil sich hier alles scheinbar auf die Frage von ‚Macht ist gleich Recht’ reduzierte. Nur Jürgen Moltmann brachte den Perspektivwechsel im Jahre 2001 sofort auf eine griffige und allgemein geltende Formel: „Religion ist nicht länger ‚Privatsache’, Religion ist Terror oder Glaube.”36 Die Terroranschläge und ihre begleitenden Verlautbarungen, die Gottesdienste danach überall auf der Welt, stellten die Frage nach Religion und ihrem ‚Wesen’ ganz allgemein und ganz zentral. Von Jürgen Habermas konnte man lesen: „Aber auch uns, den universalen Augenzeugen des „apokalyptischen“ Geschehens am Fernsehschirm, drängten sich biblische Bilder auf. Und die Sprache der Vergeltung, in der nicht nur der amerikanische Präsident zunächst – ich sage zunächst – auf das Unfassbare reagierte, erhielt einen alttestamentarischen Klang. Als hätte das verblendete Attentat im Innersten der säkularen Gesellschaft eine religiöse Saite in Schwingung versetzt, füllten sich überall die Synagogen, die Kirchen und die Moscheen.“ 37
Islamistische Weltdeutung, islamistischer Herrschaftsanspruch legten und legen immer wieder eine Grundausrichtung jeglicher Religion bloß, die in den säkularisierten Zusammenhängen (Europas) immer stärker verschwunden schien: die Neigung, sich als Gesamtdeutung der Welt und damit als Herrschaftskonstrukt zu verstehen. Autoren aus Philosophie und Soziologie beschäftigten sich (wieder) mit der Religion.38 Im Anspruch der Kirchen auf ungefragte Mitwirkung in der politischen Auseinandersetzung und auf grundlegende Aussagen im Bereich ethischer Fragen kommt diese Neigung kaum wahrnehmbar immer noch zur Wirkung. Auch der messianische Aspekt der USA – Gesellschaft ist säkularisierter Ausweis davon. Es gibt messianische Elemente im „amerikanischen Traum“ und folglich auch in der amerikanischen Politik. Das Siegel der USA und jede Ein-Dollar-Note tragen die Verheißung „Novus Ordo Seculorum” (die neue Weltordnung). Damit wird nicht nur eine, sondern die neue Weltordnung proklamiert.39 Die Art und Weise, in der der amerikanische Präsident George W. Bush seinen Krieg gegen den Irak begründete, legt dann von dieser messianischen Einstellung Zeugnis ab.
Es nützt wenig, gefragt und ungefragt zu betonen, es sei nicht „der Islam”, schon gar nicht „die Religion”, was in Terroranschlägen zum Ausdruck kommt. Die Frage, was jeweils das Ureigenste einer Religion sei, wird immer im jeweiligen Kontext beantwortet. Die dazugehörige historisch – kritische Forschung liegt für den Islam beispielsweise bei der Autorin Fatima Mernissi vor.40 Vielmehr gilt es den Blick darauf zu lenken, welche religiösen Traditionen und Grundmotive sich in dieser Form der Gewalt Bahn brechen und was das für den Umgang mit dem Glauben bedeutet.41 Der prominente islamische Autor Salman Rushdie wird folgendermaßen zitiert: „Es habe keinen Zweck, immer beschönigend darauf hinzuweisen, dass der Koran die Liebe zu Gott und den Mitmenschen in den Mittelpunkt stelle. Fanatische Richtungen im Islam seien die am schnellsten wachsende Strömung innerhalb der Religion, und ihnen gehe es nicht um eine theologisch korrekte Auslegung des Korans. ‚Für eine beträchtliche Zahl 'gläubiger' muslimischer Männer steht der Islam in einer zusammengewürfelten, kaum durchdachten Weise nicht allein für Gottesfurcht, sondern für eine Kombination von Sitten, Meinungen und Vorurteilen.’ Diese Islamisten machten die ‚Ungläubigen’ für alle Probleme muslimischer Gesellschaften verantwortlich.”42 Auch Ghaffar Hussain, ein ‚Aussteiger’ aus der islamistischen Szene spricht im Spiegel-Interview vom Islamismus als ‚moderner Ansicht’43.
Aggression und Gewalt findet sich auch in den Gottes- und Menschenbildern besonders des Alten Testaments in reichem Maße. Jan Assmann stellt eine unmittelbare Verbindung her, wenn er sagt, es seien heute „ganz eindeutig die islamischen fundamentalistischen Bewegungen, die im Banne einer politischen Theologie der Gewalt stehen, wie sie in (...) biblischen Texten vorgezeichnet ist“.44 Im Christentum hat sich trotz der eindeutigen Versöhnungsbotschaft Jesu erst nach langer und teils blutiger Geschichte der versöhnende Aspekt in den Vordergrund geschoben.45 Einen Grund dafür beschreibt Steven Pinker in seinem Werk mit dem Titel ‚Gewalt’. :„Die Empfindlichkeit gegenüber der Gewalt hat sich so stark verändert, dass religiöse Menschen ihre Einstellung zur Bibel heute unterteilen. Sie legen Lippenbekenntnisse für die Bibel als Symbol der Moral ab, beziehen ihre Moral aber in Wirklichkeit aus modernen Prinzipien.“46 Diese Aussage verkennt, wie stark die Interpretation der Bibel inzwischen Gott für den (liebevollen) Garanten des Individuums hält. Sie erkennt diesen Grundgedanken in allen Teilen der Bibel, in der es um die Auseinandersetzung der Menschen mit ihrem Gottesbild geht, nicht um historische Belege, was Gott gesagt und getan hat. Im Übrigen legt sich Pinker auch in seiner weiteren Interpretation der Bibel beim Zeichen des Kreuzes auf die Interpretation des Opfers für unsere Sünden fest.47 Dass man den Kreuzestod Jesu auch so interpretieren könnte, dass hier unübersehbar gezeigt wird, was der Mensch dem Menschen antut, dass Jesus also Opfer der Menschen geworden ist und sie sich jeden Tag an diese Geschichte erinnern, damit sie sich besinnen und umkehren – das würde doch einen ganz anderen Aspekt des Kreuzzeichens hervortreten lassen.
Der religiösen Tiefe und Inbrunst hat das nicht geholfen – im Gegenteil. Es fragt sich sogar, ob die milde Form des heutigen Protestantismus etwa noch eine Ahnung davon hat, wie viele psychische Energien ambivalent im Glauben gebunden sind und ob dieses „Vergessen” nicht am Ende das Wiedererstarken der aggressiven Seiten fördert. Ulrich Beck stellt dazu lapidar fest, dass der Protestantismus als europäisch und darin national konstituiert und konstruiert der eigentliche Verlierer der kosmopolitischen Konstellation sei.48 Er verliert mit und in Säkularität und Gewaltfreiheit. Es ist das Verdienst der Aufklärung, auf den Zusammenhang zwischen (damals kirchenförmiger) Religion und Gewalt aufmerksam gemacht zu haben. So lässt Friedrich Schiller seine Elisabeth in ‚Maria Stuart’ sagen: „Die Sankt Barthelemi sei meine Schule! / Was ist mir Blutsverwandtschaft, Völkerrecht? / Die Kirche trennet aller Pflichten Band, / Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord, / Ich übe nur, was Eure Priester lehren. ... Gewalt ist nur die einz'ge Sicherheit, / Kein Bündnis ist mit dem Gezücht der Schlangen.“49
Als „religiöser Wahn” wurde der Paradigmenwechsel nach den Terroranschlägen vom 11. September ein echtes Menschheitsthema. Wenn schon die Selbstmordattentäter mit umgebundenen Sprengsätzen in Israel und anderswo die Frage aufwarfen (und aufwerfen), warum solches Gewalthandeln mit religiösen Gedanken begründet werden kann, dann erst recht die Selbstmordattentäter von New York und Washington. Ihre Taten waren Massenmorde sondergleichen. Sie veranlassten Entsetzen und regten Medien und andere dazu an, die Geschichte des religiösen Wahns50 breit und ausführlich zu beschreiben und als Kennzeichen und Möglichkeit aller Religion sichtbar zu machen. Wie bei allen kleinen und großen Katastrophen folgte dem Entsetzen die Frage, warum das sein kann und wer das zulässt. Nach einiger Zeit rückte der militärische Kampf in Afghanistan in den Mittelpunkt des Interesses, bei dem ein merkwürdig schneller Sieg über die Taliban durch vorher schwache Kräfte der Nordallianz eintrat, ohne dass die Terrorstrukturen wirklich bloßgelegt werden konnten. Der damalige ‚Führer’ der Terroristen, Bin Laden, gab bekannt, dass er sich lieber von seinen Getreuen erschießen lassen wollte, als in die Hand des Feindes zu geraten und bewies damit zwei Dinge: Er stand in der Tat in religiösen Traditionen und er widersprach seinen eigenen Lehren. Die religiöse Tradition, dass man sich nicht in die Hände seiner Feinde begibt, findet sich beim Selbstmord des ersten Königs der Israeliten, Saul. Wer will, kann auch die Übergabe der Städte in Afghanistan aus dieser Geschichte lesen.
”Die Philister aber stritten wider Israel; und die Männer von Israel flohen vor den Philistern, und Erschlagene fielen auf dem Gebirge Gilboa. 2 Und die Philister setzten Saul und seinen Söhnen hart nach; und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malkischua, die Söhne Sauls. 3 Und der Streit wurde heftig wider Saul und es erreichten ihn die Schützen, Männer mit dem Bogen; und es wurde ihm sehr angst vor den Schützen. 4 Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Ziehe dein Schwert und durchbohre mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich durchbohren und mich mißhandeln! Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich darein. 5 Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, da stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger, auch alle seine Männer am selbigem Tage zugleich. 7 Und als die Männer von Israel, die diesseits des Tales und diesseits des Jordan waren, sahen, dass die Männer von Israel geflohen, und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen; und die Philister kamen und wohnten darin.” (1. Sam. 31,1-8)
Die von Bin Ladens Anhängern und anderen benutzte Waffe des Selbstmordattentats als Kampfmittel im Heiligen Krieg kann für keinen religiösen Menschen, auch nicht für einen Moslem gelten. Die Ankündigung jedoch, nicht in die Hände der ungläubigen Feinde fallen zu wollen, gehört offenbar zu den religiösen Überlieferungen. Die Ankündigung des Terroristenführers könnte ein Teil der Wirkungsgeschichte dieser Tradition sein, die im Christentum nicht fortlebte. Die Tradition des jüdischen und des christlichen Glaubens hat aus dem „Bilanz- und Angstselbstmord” Sauls nie ein religiöses Problem gemacht. Die religiöse Seite des Terrorismus kam schon wenige Wochen nach den Attentaten wieder aus dem Blickfeld, obwohl sie als tragende Grundidee für die politische Entwicklung größte Beachtung in dieser Auseinandersetzung verdient. Diese wird aber immer noch mit Vorurteilen und beleidigten Zurückweisungsgefühlen geführt.
”Die Vernichtung von fünf- bis sechstausend hilflosen und ahnungslosen Menschen in den entführten Flugzeugen und den beiden Türmen ist Massenmord gewesen. Gründe, Erklärungen, Entschuldigungen dafür zu suchen, das absolute Verbot des Massenmords zu relativieren, das ist ein intellektueller Fehler, ein mehr oder weniger naives Echo der rechtsradikalen und der linksradikalen Feinde der Demokratie. Ein Fehler lässt sich auf vielerlei Weise erklären und entschuldigen, das menschheitsfeindliche Verbrechen nicht.”51
Wer sich mit den Hintergründen der Terroristen auseinandersetzt, betreibt keinen intellektuellen Fehler, sondern versucht, die Frage der terroristischen Gewalt einem Verständnis näher zu bringen, das eine zukünftige „Bekämpfung“ leichter machen soll. Es scheint so, als sei vergessen, dass der Fundamentalismus zuletzt in den achtziger Jahren beispielsweise unter den Konservativen in den USA großen politischen Einfluss gewann. Die christlichen Kirchen wurden von fundamentalistischen Bewegungen zeitweise regelrecht in die Zange genommen. Erklärungen darüber, welchen Faktoren der Fundamentalismus entspringt und warum die religiösen Überlieferungen dabei eine große Rolle zumindest als Formulierungs- und Motivierungshilfe spielen, geraten eher oberflächlich. Die Bezeichnungen „religiöser Wahn“, Terrorismus und Fundamentalismus werden nahezu synonym gebraucht. Eine gelegentliche Übereinstimmung von Wahn, Terrorismus und Fundamentalismus bedeutet nicht, dass es sich um verschiedene Worte für das gleiche handelt. Bassam Tibi warnt ausdrücklich vor der Vermischung von religiösem und politischen Fundamentalismus. ”Beim religiösen Fundamentalismus handelt es sich um eine politische Ideologie, die seit dem Ende des 20. Jahrhunderts in fast allen Weltreligionen vorzufinden ist, aber hier in Deutschland als eine zeitgenössische Erscheinung sehr wenig verstanden wird. Auf diese Weise konnte der Fundamentalismus zu einem unspezifischen Schlagwort werden. In seiner allgemein gebräuchlichen falschen Handhabung wird das Wort willkürlich sowohl auf das Phänomen wachsender Religiosität als auch auf den politischen Extremismus bezogen. Religiöser Glaube und politische Bewegungen werden somit durcheinandergebracht.”52 Es gibt Fundamentalismus, der sich nicht terroristisch entwickelt, sondern nur als politische Ideologie fungiert, dann jedoch von terroristisch gestimmten Menschen missbraucht wird wie viele ideologische Lehren. Terrorismus muss nicht immer fundamentalistisch begründet sein, sondern kann rein kriminelle Ursachen haben. Wenn Fundamentalismus und Wahn zusammenkommen, kann das monströse terroristische Folgen haben, kann aber auch im Wahn versinken oder zur innengewendeten Sekte verkommen. Immer ist das Gemisch der drei seelisch-geistigen Zustände sehr brisant.
Auch aus der Sicht jenseits der Ereignisse gibt es zwischen dem Fundamentalismus und dem religiösen Wahn Berührungspunkte. „Fundamentalismus“ bezeichnet als unscharfer Begriff im christlichen Bereich die Bewegungen im 19. und 20. Jahrhundert, welche die Unfehlbarkeit der Schrift (im wörtlichen Schriftverständnis), die Ablehnung moderner Bibelauslegung und die Überzeugung betonen, dass alle, die etwas anderes denken oder sagen, keine echten Christen sind. Die Wurzeln dieser Glaubenshaltung liegen in einer Reaktion auf Rationalität und Aufklärung, besonders aber auf den Liberalismus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Aus der politischen Erfahrung ist bekannt, dass fundamentalistisch motivierte Proteste gegen Abtreibung in den USA in Mordanschlägen gipfelten. Neben der Gegnerschaft gegen die Abtreibung konnte aus dieser Sicht auch für die Todesstrafe votiert werden, was die fundamentalistische Politik aus christlicher und islamischer Quelle übrigens gemeinsam haben (siehe Iran und USA). Die Thesen von Charles Dar...