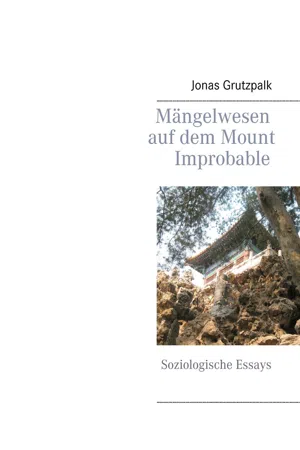
- 104 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Als ich zum Professor für Soziologie berufen wurde, beschlich mich schon bald eine fundamentale Sorge: ob ich ehrlich und mit gutem Gewissen Soziologie lehren könnte. Ich kam mir vor, wie ein Theologe, der nach langem Studium nun endlich seine ersehnte Pfarrstelle antritt und plötzlich feststellt, dass er an der Existenz Gottes zweifelt. Denn: Kann ich als Soziologe guten Gewissens behaupten, die Mängelwesen-Anthropologie sei "Fakt"? Weiß die Broken-Windows-Theorie eigentlich, was sie aussagen will? Warum geht die Soziologie mit Parsons davon aus, dass soziales Handeln in erster Linie rational gesteuert wird? Und was genau meinen Soziologen eigentlich, wenn sie "Gesellschaft" sagen?
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Mängelwesen auf dem Mount Improbable von Jonas Grutzpalk im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Soziologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
„There is no such thing“ – Soziologie ohne Gesellschaft
Soziologen sprechen zwar von Gesellschaft und malen sie bei ihren Vorträgen häufig mit kreisförmigen Handbewegungen in die Luft (Latour 2005, S. 186), doch ist die Frage nicht von der Hand zu weisen, dass sie schwer zu packen ist: auf die Frage, was Gesellschaft genau ist, kriegen wir einen bunten Strauß an Antworten:
„Die Leitfrage ‚In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?’ beantworten (…) Soziologen (…) mit verschiedenen Gesellschaftskonzepten (…). Demnach leben wir in der ‚Risikogesellschaft’ oder in der ‚Erlebnisgesellschaft’ oder in der ‚Postmoderne’ oder in der ‚Informations- und Wissensgesellschaft’ oder in der ‚Mediengesellschaft’; in der ‚Massengesellschaft’ oder in der ‚Konsumgesellschaft’ oder in der ‚Beschleunigungsgesellschaft’, in der ‚Ironiegesellschaft’ oder in der ‚Verantwortungsgesellschaft’ oder in der ‚zweiten bzw. reflexiven Moderne’, wie Ulrich Beck behauptet, und ihm geht es darum, (so sagt er) ‚die grundstürzend sich wandelnde, unbekannte Gesellschaft, in der wir leben’, auf den Begriff zu bringen“ (Fischer 2008).
Die Frage nach der Identität von Gesellschaften erschwert sich noch dadurch, dass sie einen fortlaufenden Zu- und Abgang ihrer Mitglieder zu verzeichnen haben. Zygmunt Bauman (2000; S. 315f.) vergleicht sie deswegen mit einem Wasserwirbel in einem Fluss "Der Wirbel scheint eine feststehende Gestalt zu besitzen und deswegen (…) seine 'Identität' zu bewahren - trotzdem kann er (…) kein einziges Wassermolekül länger als ein paar Sekunden behalten."
Margaret Thatcher (1987) hätte, wenn sie Soziologin gewesen wäre, diese Diskussion um das Wesen der Gesellschaft sicherlich mit ihrem folgenden Statement bedeutend bereichern können:
„Who is society? There is no such thing! There are individual men and women and there are families“.
Aber könnte die Soziologie überhaupt fortbestehen, wenn man mit Margaret Thatcher annehmen müsste, dass es gar keine Gesellschaft gibt? In diesem Text will ich kurz darlegen, wie die Soziologie die Gesellschaft für sich entdeckte, wie ihr Gesellschaftsbegriff sich entwickelte, welche Konsequenzen dieser Gesellschaftsbegriff für ihre Evolution hatte und was passieren würde, wenn man davon ausgehen müsste, dass Margaret Thatcher am Ende Recht hat und es Gesellschaft im soziologischen Sinne gar nicht gibt. Etsi non daretur societas.
1. Soziologie mit Gesellschaft
Die Herkunft des Begriffes zeigt, dass lange Zeit niemand „die Gesellschaft“ als eigenständiges Forschungsobjekt erkennen wollte. In einigen Sprachen gab es überhaupt nicht das passende Wort dafür und musste erst mit Einführung der Soziologie als akademischem Fach entwickelt werden (Ishida 2008; S. 73–81).
Das deutsche Wort „Gesellschaft“ kommt von „Geselle“, was wiederum die gleiche Wortwurzel wie „Saal“ hat. Gemeint ist mit dem Wort also ursprünglich lediglich, dass Menschen, die nicht blutsverwandt miteinander sind, zusammen unter einem Dach wohnen (Kluge 1989; S. 262). Ähnlich verhält es sich mit den modernen Ableitungen vom lateinischen „societas“ – also z.B. „society“ im Englischen oder „société“ im Französischen. Das Wort lässt sich vom Begriff „socius“ = Verbündeter herleiten (Robert 1993; S. 2439; Pianigiani 1988; S. 1299). Auch hier spielt der Gedanke eine tragende Rolle, dass kein blutsverwandtschaftliches Verhältnis zwischen den Beteiligten besteht. Die vom Protosoziologen Ibn Khaldun (1332–1406) vorgeschlagene Unterscheidung zwischen Asabiya und Umma beschreibt in etwa das, was die deutsche und die französische Sprache hier sagen wollen (Grutzpalk 2007).
Einer der Gründerväter der Soziologie in Deutschland, Ferdinand Tönnies, hat in seinem Buch „Gemeinschaft und Gesellschaft“ 1887 auch noch diese Unterscheidung hervorgehoben: Gemeinschaft äußert sich für ihn in erster Linie als „Gemeinschaft des Blutes,“, die sich wiederum „zur Gemeinschaft des Ortes besondert (…) und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes “ (Tönnies 1922;; S. 14). Gesellschaft wiederum beschreibt Tönnies (1922; S. 51) „als eine Menge von natürlichen und künstlichen Individuen, deren Willen und Gebiete in zahlreichen Beziehungen zueinander und in zahlreichen Verbindungen miteinander stehen und doch voneinander unabhängig und ohne gegenseitige innere Einwirkungen bleiben." Die Beziehungen zwischen den Menschen werden hier durch Geld, Verträge und Arbeit bestimmt. Allerdings war für Tönnies „Gesellschaft“ ein „fiktives und nominelles Gedankenspiel“, das „in der Luft“ schwebe. Er hielt Gesellschaft also eher für eine folgenschwere Idee als für eine empirische Wirklichkeit (Tönnies 1922; S. 51).
1.1. Die Entdeckung der Gesellschaft im „Durchschnitt einer großen Zahl“
Gesellschaft als Forschungsobjekt wurde erst langsam und durch statistische Verfahren sichtbar gemacht, die sich ab dem 17 Jahrhundert in Europa durchsetzten. Die Soziologie ist historisch gesehen ein Kind der Sozialstatistik, die ihrerseits ein Kind der öffentlichen Verwaltung ist. Seit der Entwicklung der Schrift war es Verwaltungen möglich, alle möglichen Daten festzuhalten: z.B. wie viele Untertanen in einem Reich lebten, wer wie viele Steuern zu zahlen hatte, welche Waren mit welchen Nachbarstaaten ausgetauscht wurden (Goudsblom 1979; S. 40f.). Aber erst ab dem 17. Jahrhundert wurden solche öffentlich gesammelten Daten zusammenhängend ausgewertet. So erforschte der Brite John Graunt 1665 anhand des Londoner Sterberegisters die in seiner Zeit hauptsächlich vorkommenden Todesursachen (Landwehr 2011; S. 22). Es ist aus Sicht der Soziologie bemerkenswert, dass bis zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch niemand auf die Idee gekommen war, behördlich gesammelte Einzeldaten so zusammenzufassen, dass Informationen über einen „Durchschnitt einer großen Zahl von Menschen“ erhoben wurden (Doyle 2012; S. 84).
Man schien nun mit der Sozialstatistik Mittel an der Hand zu haben, Aussagen über den "Zustand des Kollektivgeistes“ (Durkheim 1984; S. 110) machen zu können. Die Hoffnung machte sich breit, „dass nur eine geschickte Handhabung der verfügbaren Daten die fundamentalen ‚Gesetze’ des sozialen Universums schon offenbaren würde“ (Goudsblom 1979; S. 45). Der erste Autor, der von einer Wissenschaft namens Soziologie sprach, war Auguste Comte (1798–1857), der sich von diesem Fach nicht weniger als die rationale Steuerung gesellschaftlicher Prozesse erhoffte. Er formulierte eine Faustformel, an der sich die Soziologie lange Zeit orientierte: wahre (soziologische) Wissenschaft bestehe darin, anhand verfügbarer Daten neues Wissen zu produzieren, das wiederum dazu diene, Entwicklungen vorherzusehen, was dann ermögliche, effektiv zu handeln (kurz: „Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir“) (zit. nach Schluchter 2005; S. 108). Dieses Konzept war erfolgreich: schon 1843 hielt das Wort "scoiology" Einzug in die englische Sprache (Hendrickson 2004; S. 673).
Die Entstehung der Soziologie hängt also eng mit dem zusammen, was Lucian Hölscher (1999) die „Entdeckung der Zukunft“ genannt hat: die Abkehr von der mittelalterlichen Vorstellung, dass die Zukunft Gottes Willen unterworfen sei, und dem Aufkommen der Idee planbarer Zukunft. Es ist kein Zufall, dass die Soziologie zeitgleich mit einer modernen Vorstellung von Verwaltung das Licht der Welt erblickte, deren Aufgabe u.a. in der „Abwendung der (…) bevorstehenden Gefahren“ gesehen wurde (Preußisches Allgemeines Landrecht 1794). Beide: Soziologie und moderne Verwaltung haben die Absicht, die Zukunft gesellschaftlicher Entwicklungen vorauszusehen und planvoll darauf einzugehen, was da auf einen zukommt. Statistik wurde als die Methode angesehen, wie ein gestaltender Blick in die Zukunft möglich sein könnte.
1.2. Was ist Gesellschaft? Die Antwort einiger soziologischen Riesen
„Ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? Nach der Statistik ist jeder vierte Mensch ein Chinese. Aber hier spielt gar kein Chinese mit.“ (zit. nach Zeigler 2009; S. 239)
Sportreporter Werner Hansch hat mit diesem launigen Kommentar - wohl unbeabsichtigt - eine wichtige Frage der Soziologie angesprochen: spiegelt die Sozialstatistik überhaupt eine gesellschaftliche Realität? Wie ließe sich diese Realität genauer erkennen und beschreiben? Und woran erkenne ich überhaupt Gesellschaft? Insbesondere diese letzte Frage hat drei der „Riesen“ der Soziologie, Karl Marx, Emile Durkheim und Max Weber (Merton 1993), nachhaltig beschäftigt. Ihre Antworten fallen unterschiedlich aus, aber gemeinsam haben sie die Entwicklung der Soziologie als Wissenschaft stark geprägt:
Emile Durkheim beschreibt die Gesellschaft als „chose“ (franz. = Ding), also als etwas, was man sichtbar machen kann. Man hat diesen Ansatz deswegen auch „Chosisme“ genannt. Dabei ist es nicht die Gesellschaft selbst, die wir sehen können, sondern die Spuren, die sie in den Erwartungen ihrer Mitglieder hinterlässt. Der soziale Tatbestand (fait social) ist nun das, was die Soziologie zu ermitteln in der Lage ist. Er ist das, was der Mensch nicht aus sich heraus, sondern als Antwort auf die Erwartungen der Gesellschaft hin tut:
„Wenn ich meine Pflichten als Bruder, Gatte oder Bürger erfülle (…), so gehorche ich damit Pflichten, die außerhalb meiner Person und der Sphäre meines Willens im Recht und in der Sitte begründet sind.“ (Durkheim 1984; S. 105)
Der soziale Tatbestand ist also Ausdruck des sozialen Lebens, das mehr ist als die Summe der Einzeltätigkeiten. Er ist eine eigenständige Realität („sui generis“). Er wirkt 1. von außen, hat 2. zwingenden Charakter und gilt 3. universell (Durkheim 1984; S. 105ff.). Der Mensch in der Gesellschaft ist soziales Wesen aufgrund seiner moralischen Bindungen. Sobald er einer sozialen Pflicht nachkommt, geschieht das unter Ei...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Mängelwesen from outer space. Gedanken zur soziologischen Anthropologie
- Empörung und Integration. Peter Sloterdijk als Soziologe
- Soweit ich die Akteurs-Netzwerk-Theorie (ANT) verstanden habe
- Nachahmung. Zur Aktualität der Soziologie Gabriel Tardes
- „There is no such thing“ – Soziologie ohne Gesellschaft
- Impressum