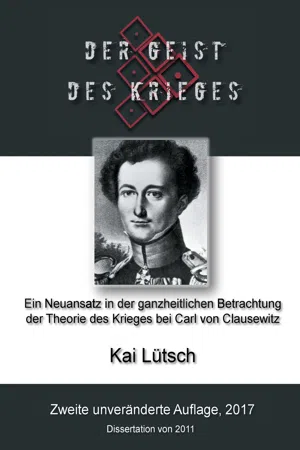![]()
V. STRATEGISCHE DIMENSION: EFFIZIENZ DER KRÄFTE
1. EINLEITUNG
Mit der strategischen Dimension des Krieges betrachten wir nun hauptthematisch dasjenige Handlungsfeld der Theorie des Krieges, welches für Clausewitz das ursprüngliche Hauptaugenmerk seines Werkes war. Diese Tatsache, dass nämlich Clausewitz in erster Linie über „die Theorie des großen Krieges oder die sogenannte Strategie“1360 schreiben wollte, wird in diesbezüglicher Sekundärliteratur gerne übersehen. Ihm ging es vordergründig darum zu analysieren, wie die Kräfte, die durch die Politik zur Führung des Krieges bestimmt wurden, idealerweise eingesetzt werden.
In der bisher betrachteten politischen Ebene haben wir in diesem Zusammenhang noch keine präzisen Vorstellungen entwickelt. Im Handlungsfeld der Politik lag die Bestimmung, ob Krieg geführt wird oder nicht und wenn ja, mit wie vielen Kräften. Die mit diesen Bestimmungen zusammenhängenden Entscheidungen sind für Clausewitz jedoch etwas dem Kriegführen im engeren Sinne äußeres. Dezidiert weist er darauf hin, dass die Kriegstheorie bei der Entscheidungsfindung auf der politischen Ebene keine Forderung zu stellen hat. Die einzige Maßgabe ist, dass die Politik das Instrument, welches sie anwenden will, kennt und es folglich nicht entgegen dessen Natur einsetzt.1361 „Dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering“1362. Die Politik soll sich also der Kriegstheorie bewusst sein, das daraus resultierende Wissen in ihre Überlegungen mit einschließen und ihre Absichten entsprechend modifizieren. Dennoch trifft die Kriegstheorie selbst keine politischen Aussagen, weil sie sich der Tatsache bewusst ist, dass sie nur ein Aspekt unter vielen ist, welche es auf der politischen Ebene gegeneinander abzuwägen gilt.1363 Clausewitz hütet sich anders als anderen Kriegstheoretiker und Militärstrategen davor, den Wirksamkeiten des Krieges per se eine höhere Bedeutung zuzumessen als anderen Interessen, Meinungen und Absichten oder gar generell von einer existenziellen Bedeutung auszugehen. Im Gegenteil stellt er fest, dass der Krieg „mit seinem Resultat nie etwas Absolutes“1364 ist.
Clausewitz-Interpreten wie z.B. Creveld, der in seinem Werk hauptsächlich zu beantworten sucht, wer warum, wozu und worum Krieg führt1365 und somit im Wesentlichen Fragen erörtert, die der politischen Dimension des Krieges zuzuordnen sind, sehen in der fehlenden normativen Aussagekraft Clausewitz‘ auf politischer Ebene eine Schwäche der Theorie. Creveld findet, dass sich in diesen Betrachtungen nur beliebige, abgedroschene Phrasen finden.1366 Andere Interpreten analysieren vordergrundig „das ‚Philosophische‘ an Clausewitz mittels der Gedanken von Denkern des 19. Jahrhunderts wie Hegel und Kiesewetter“1367, oder stellen ihn in eine Reihe mit Platon und Hobbes1368 oder Marx, Engels und Lenin1369 usw. Ich will nicht die Fruchtbarkeit der verschiedenen Analysen in Frage stellen, es gilt aber darauf hinweisen, dass der Zweck der Clausewitz’schen politischen Betrachtungen ein ganz anderer war. Ihm ging es keineswegs um die Auswirkungen des Krieges auf die Politik, sondern allein um die Auswirkungen der Politik auf den Krieg. Die gesamte Kriegstheorie ist also keineswegs daran ausgerichtet, politischen Entscheidungsträgern Richtungspunkte zu geben oder ihnen zu gutem oder gerechtem Handeln zu verhelfen. Die politischen Betrachtungen dienen vielmehr allein dazu, der Kriegsführung im engeren Sinne, d.h. der Strategie und der Taktik, eine Orientierung zu geben und ihnen zu vermitteln, wie sie das sein können was sie sein sollen, namentlich ein adäquates politisches Instrument.
Indem wir uns nun also der strategischen Ebene zuwenden, stoßen wir auf den Schwerpunkt des Clausewitz’schen Denkens, gleichwohl aber nur auf ein Nebengebiet der bisherigen Clausewitz-Interpretation. Tatsächlich gibt es vor allem im deutschen Sprachraum bisher kaum Abhandlungen, die sich mit den strategischen Ansätzen Clausewitz‘ auseinander setzen. Nur ältere Werke, insbesondere die um Moltke und Delbrück, befassen sich mit strategischen Aspekten; sie tun dies aber weniger vor einem wissenschaftlichen Hintergrund. Vielmehr suchen die Clausewitz Rezensenten des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ihre eigene Position in der Strategiedebatte1370 zu stärken, indem sie sich auf Clausewitz berufen. Vor allem beziehen sie sich im Kern auf die entsprechenden Bücher in ihrer Originalfassung, ohne diese in Zusammenhang mit den im ersten und achten Buch sich abzeichnenden Entwicklungen der Theorie zu setzen. Den frühen Rezensenten fehlt es also oftmals noch an einer tiefgreifenden Berücksichtigung der politischen Dimension des Krieges, die stets Auswirkungen auf die strategische und schließlich taktische Ebene haben muss.
Die Stratege ist die analytische Ebene, auf welcher die einzelnen Gefechte geplant, d.h. nach Ziel, Kräften, Raum und Zeit bestimmt werden. Die Taktik, welche die Lehre des Gebrauchs oder der Aufstellung von Streitkräften innerhalb eines Gefechtes umschreibt, befasst sich mit der eigentlichen Wirksamkeit der Streitkräfte. Die Strategie jedoch setzt die Kombination verschiedener Wirkungen erst in einen sinnvollen Gesamtkontext und bildet so das Bindeglied zwischen der Gewaltanwendung auf taktischer Ebene und dem Zweck des Krieges auf politischer Ebene, welchen die erstere erfüllen soll. Auf den folgenden Seiten werden wir die einzelnen Aspekte und die damit verbundenen Schwierigkeiten Schritt für Schritt kennenlernen.
2. DAS GEFECHT ALS EINZIG WIRKSAMES MITTEL DER STRATEGIE
Während andere Darstellungen und Überlegungen, wie z.B. der Zusammenhang zwischen Krieg und Politik, in der wissenschaftlichen Literatur über Clausewitz zu erheblichen Auseinandersetzungen und verschiedensten Interpretationen führten, ist die Clausewitz’sche Idee vom Gefecht sowie dessen Nutzen für die Strategie bemerkenswert wenig behandelt und beachtet worden. Selbst Titel, die aus einer recht militärischen Perspektive verfasst sind, hinterfragen den Begriff des Gefechts nicht weiter.1371 Dies mag einerseits daran liegen, dass das mit „das Gefecht“ betitelte vierte Buch seines Werkes eines der ältesten ist und diesem daher ein älteres Gedankengut unterstellt wird, welches noch den absoluten Krieg als anzustrebendes Ideal betrachtet und sämtliche behutsamer geführten Kriege mehr oder weniger fehlerhaft nennt und auf einen Mangel an Energie und Willen zurückführt.1372 Die geringe Beachtung mag andererseits daraus entspringen, dass die unkommentierte Übernahme der im vierten Buch verfasst Aussagen recht bequem erscheint. Ist dort doch allein und ausschließlich vom Kampf von Streitkräften gegen Streitkräfte die Rede und dies doch, normativ gemessen am Kriegsvölkerrecht, der Ausdruck einer absolut ‚sauberen‘, unschuldigen, ja nahezu ritterlichen Kriegsführung. Es findet sich dort, zumindest auf den ersten Blick, nichts über Rauben, Morden und Brandschatzen und der Leser liest an diesen Stellen so recht nichts, woran er sich vom ethischen Standpunkt aus reiben könnte. Der dritte Grund für die geringe Beachtung des Gefechts scheint mir, dass die Wissenschaft selbst dieses Thema nicht für sonderlich fruchtbar hält, da es doch eher dem Bereich der militärischen Lehre zuzuordnen zu sein scheint, als dem geisteswissenschaftlichen Bereich der politischen Theorien.
Wie aber kann der Krieg und insbesondere die Clausewitz’sche Kriegstheorie verstanden werden, ohne dass das Gefecht und dessen Nutzen für die Strategie näher analysiert wurde? Und wie könnte dies erst recht in Anbetracht der Aussage vertreten werden, dass das Gefecht [...] die einzige Wirksamkeit im Kriege“1373 ist?
Das konkrete und richtige Verständnis des Gefechts ist somit von zentraler Bedeutung für die Clausewitz’sche Kriegstheorie; die alleinige Diskussion um Oberhoheit der Politik wäre ohne das konkrete Verständnis vom Gefecht vollkommen sinnentleert oder, von einem anderen Standpunkt aus argumentiert, es muss nicht nur die Kriegsführung die Politik verstehen und berücksichtigen, um den Krieg in ihrem Sinne zu führen, sondern es muss auch die Politik den Krieg verstehen, insofern sie von ihm Gebrauch machen will oder muss. Wenn aber der Krieg in erster Linie über das Gefecht definiert ist, so wissen wir noch nichts über das eigentliche Wesen des Krieges, solange wir nicht das Wesen des Gefechts kennen.
Ich will mich also in diesem Kapitel näher mit dem Gefecht und dessen Nutzen für die Strategie auseinandersetzen. Dies soll einen ersten Eindruck vom Gefecht geben, ohne dabei allzu intensiv auf die Führung des Gefechts einzugehen, denn dies gehört der taktischen Dimension des Krieges an, mit welcher ich mich im VI. Teil dieser Arbeit befassen werden.
2.1. BEGRIFF DES GEFECHTS UND DESSEN ENTSCHEIDUNG
Das Gefecht ist der Kampf zwischen zwei Streitkräften, d.h. „bewaffnete Menschen“1374 befinden sich im unmittelbaren, kollektiven Zweikampf gegeneinander. Aus dieser Duellsituation ergibt sich zwangsweise die Notwenigkeit, den Gegner zu vernichten, allein schon, um nicht selbst vernichtet zu werden.1375 Dass dem Kampf ausgewichen werden kann, dass er gemieden werden kann und dass damit ganz andere Zwecke verfolgt werden können als die Vernichtung des Gegners sei hiervon vollkommen unbenommen. Zunächst ist die Vernichtung des Gegners das einzige und nächste, was bewaffnete Menschen im Kampf tun können und müssen.1376 Diese Wechselwirkung des Kampfes muss logisch betrachtet solange fortgesetzt werden, bis eine der beiden Parteien a) vollständig vernichtet ist, b) sich ergibt, d.h. die Waffen niederlegt und ergo wehrlos ist oder c) die Flucht ergreift. Allein, wir haben hier nur den Kampf betrachtet, nicht aber den Begriff des Gefechts. Das Gefecht ist für Clausewitz nämlich nur vordergründig mit dem Kampf verbunden, das eigentliche Wesen des Gefechts ist durch die Krise definiert. Dazu einige Erläuterungen:
Die gegenseitige Gewalt im Gefecht richtet sich nicht nur unmittelbar gegen die physischen Kräfte, sondern auch mittelbar gegen die moralischen. Eine Streitkraft hat in ihrem üblichen Zustand, d.h. außerhalb des Gefechts, eine mehr oder weniger gewohnte Ordnung. Diese mehr oder weniger durchdachte und planvolle Aufstellung1377 gibt ihr ein gewisses Maß an Sicherheit und Überschaubarkeit. In dieser Ordnung „reiht sich die Zahl der Kämpfer zu immer neuen Einheiten zusammen, die Glieder einer höheren Ordnung bilden.“1378 Eine Streitkraft wird hierdurch zu einem organischen Ganzen und in diesem Sinne überhaupt erst führbar. Die Ordnung und der Zusammenhang einer Streitkräfte und die übrigen moralischen Größen stehen in einem engen Wechselverhältnis zueinander. So sind es moralische Größen wie Mut und Vertrauen1379, vor allem aber die kriegerisch...