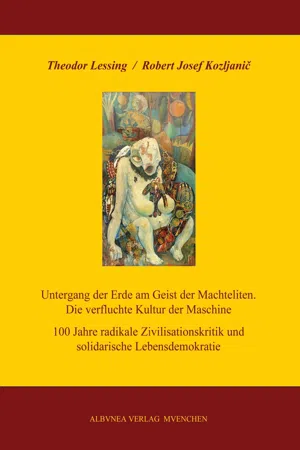![]() Robert Josef Kozljanič: 100 Jahre radikale Zivilisationskritik und solidarische Lebensdemokratie
Robert Josef Kozljanič: 100 Jahre radikale Zivilisationskritik und solidarische Lebensdemokratie![]()
Robert Josef Kozljanič: 100 Jahre radikale Zivilisationskritik und solidarische Lebensdemokratie
Dieser Essay geht in seinem Kernbestand auf meinen Vortrag „Radikale Zivilisationskritik 100 Jahre nach Ludwig Klages’ ‚Mensch und Erde’: Zum Beispiel Derrick Jensen“ zurück. Ich sollte diesen Vortrag zum 100-jährigen Bestehen des freideutschen Jugendtreffens am Hohen Meißner (auf der beigeordneten Tagung der Ludwig-Klages-Gesellschaft) im Rahmen der „Meißnerwochen“ halten. Durch Krankheit wurde ich daran gehindert, so dass der Vortragstext am 29. 9. 2013 im Berggasthof Ahrenberg nur vorgelesen werden konnte. – Ich widme diesen Text allen Ausgebeuteten dieser Erde und der ausgebeuteten Erde selbst. ‚Ausgebeutete aller Länder: solidarisiert euch!’
I. Positivismus, Industrialisierung, Kapitalismus bis 1900
Auguste Comte (1798-1857) gilt als der Begründer des Positivismus. In seinem sechsbändigen Hauptwerk „Cours de la philosophie positive“ (1830-42) plädiert er dafür, allen überkommenen mythischen, theologischen und metaphysischen Weltbildern abzusagen und ein ganz neues, naturwissenschaftlich durchrationalisiertes28 Weltbild zu etablieren. Ein solches Weltbild fand nun in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach und nach Verbreitung. Damit hub eine neue Welle rationalistischer Aufklärung und Entzauberung der Welt an.
Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, dass es nicht das Programm einer ganzheitlichen Aufklärung, sondern eine zweckrationalistisch und ideologisch verengte Schrumpfform von Aufklärung war, die hier einmal wieder zum Zuge kam. Ging es doch weniger um die vollsinnliche und vernünftig-integrale Erhellung und Befreiung von Mensch, Welt und Natur, mehr jedoch um deren Funktionalisierung und Quantifizierung, um deren Berechen- und Beherrschbar-Machung vermittels Mathematik, Naturwissenschaft, Technik. Wie es Galileo Galilei (1564-1642) schon formulierte: „alles rechenbar zu machen und was sich nicht rechenbar machen läßt, nicht berücksichtigen.“ Berechenbar-Machen wurde dabei mit Wissen bzw. Herrschaftswissen gleichgesetzt. Auch dieser Punkt war im 19. Jahrhundert nichts Neues. Thomas Hobbes (1588-1679) hatte ihn 200 Jahre vorher schon ausgesprochen: Ein Ding zu kennen, heißt „zu wissen, was wir mit einer Sache machen können, wenn wir sie haben“; („to know what we can do with it when we have it“).29 Freilich kann man/frau sich fragen, ob diese Schrumpfform überhaupt den Namen Aufklärung verdient. Treffend hat Karl Jaspers in Bezug auf solche Verkümmerungsformen nicht von Aufklärung, sondern von „Aufkläricht“ gesprochen.30
Wie dem auch sei. Die neue aufklärerische Quantifizierungs-und Machbarkeits-Welle war jedenfalls engstens mit dem Prozess der Industrialisierung verbunden. Ja, genau betrachtet, waren es weniger die „positiven“, d. h. experimentell gewonnenen und mathematisch darstellbaren naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die dem comteschen Positivismus zum Durchbruch verhalfen, als vielmehr die gleichzeitigen technischen und industriellen Nutzanwendungen und ‚Revolutionen’ derselben sowie, nicht zum geringsten Teil, die zivilisatorischen Zukunftshoffnungen, die sich mit diesen industriellen Umwälzungen verbanden. Diese Zukunftshoffnungen gipfelten in einer Fortschrittsideologie, die mit den Schlagworten „Naturwissenschaft“, „Technik“, „Fortschritt“ operierte.
Die Industrialisierung brachte die moderne technologische Zivilisation mit ihren neuen kapitalistischen Gewinnern hervor: den (meist großbürgerlichen) Fabrik- und Bankbesitzern, den pfiffigen Ingenieuren und gerissenen Unternehmern, den Industriemagnaten und Konzernchefs. Die ersten Nutznießer dieses neuen Systems waren all diejenigen, die es sich leisten konnten, Konsumenten zu sein. Doch das galt zunächst nur für wenige. Groß dagegen war die Zahl der neuen Verlierer: die im 19. Jahrhundert maßlos ausgebeuteten Arbeiter/innen (und ihre Kinder), die ebenfalls großer Willkür ausgesetzten niederen Angestellten und, man/frau vergisst und verdrängt das zu gern, die unzähligen und ungezählten unterdrückten, ausgeplünderten, ganz oder halb ausgemerzten ‚Kolonialvölker’ – und mit ihnen die ‚kolonialisierte’ Natur.
Die neue kapitalistische Machtelite wusste sich, polit-ideologisch geschickt, der Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809-1882) zu bedienen. Die etwas einseitigen, letztlich aber doch recht grundlegenden und genialen Entdeckungen, die Darwin in seiner Schrift „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“ (1859) in Bezug auf die Stammesgeschichte der Lebewesen (Phylogenese) präsentiert hatte, wurden vorschnell auch auf die Gebiete von Wirtschaft, Industrie, Technik und Politik übertragen. Evolution wurde mit Fortschritt, Fortschritt mit Industrialisierung, Industrialisierung mit Kapitalisierung gleichgesetzt. Ausbeutung und Unterdrückung, Kolonialisierung und Naturbeherrschung, Machtpolitik und Eroberungskriege wurden nun nicht mehr (wie früher) christlich-klerikal-feudal gerechtfertigt, sondern sozialdarwinistisch und damit quasi naturwissenschaftlich-positivistisch. Im „struggle for existence“ („Kampf um’s Dasein“), so propagierte man/frau, überlebe gemäß dem Prinzip des „survival of the fittest“ („Überleben der Tauglichsten, der am besten Angepassten“) eben nur der „Stärkere“ bzw. „Mächtige“ – also der finanziell, strategisch, machtpolitisch, technisch und militärisch Fortgeschrittenere. Auguste Comtes fortschrittsideologisch verfasster Positivismus wurde so, nach und nach, zu einer machtpolitischkapitalistisch verfassten Fortschrittsideologie.
II. Lebensreform, Fortschritts- und Zivilisationskritik um 1900
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – als schließlich auch in Deutschland die menschenverächterischen und naturzerstörerischen Folgen von Technisierung, Industrialisierung und Kapitalisierung durchschlugen – machten sich kritische Stimmen bemerkbar. Ob aus den Kreisen des Natur- und Heimatschutzes oder den Kreisen der Arbeiter-, Gewerkschafts- und Frauenbewegung; ob aus den Kreisen der konservativen Technik- und Zivilisationskritik oder den Kreisen sozialdemokratischer und kommunistischer Kapitalismuskritik: Man/frau begab sich – nicht nur in der Jugend-, Wandervogel- oder Lebensreformbewegung – auf die Suche nach Alternativen. Man/frau machte sich auf, alte vergessene Wege zu prüfen, neue zu beschreiten. Auf dem Boden der Lebensphilosophie und in ästhetischen Zirkeln und Künstler- und Aussteiger-Kolonien (George-Kreis, Schwabinger Kosmiker, Monte Verità, Künstler-Kolonien Worpswede, Dachau, Barbizon, Münter-Kreis in Murnau) besann man/frau sich auf Altes, ersann zugleich Neues.31 Einzelne, radikalere Geister und Künstler wie Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913) und Gusto Gräser (1879-1958) stiegen (zeitweilig) komplett aus, zogen langhaarig und barfuß durch die Landschaft, lebten in Steinbrüchen und Höhlen, ernährten sich vegetarisch und agierten als Natur- und Friedenspropheten.32
Jedenfalls waren viele definitiv nicht mehr gewillt, im Chor der Fortschrittsjünger mitzusingen. Man/frau berief sich auf Rousseaus „Zurück zur Natur“, floh „aus grauer Städte Mauern“, suchte und fand Natur und naturnahe Gemeinschaft, naturnahe Ideale. Man/frau genoss wandernd, singend und zeltend Natur- wie Kulturlandschaft. Man/frau zog an den Stadtrand, auf’s Land, gründete Siedlerkolonien und Gartenstädte, entwickelte, produzierte und vertrieb Reformkost. (Namen wie Reformkost und Reformhaus gehen ja selbst auf die Lebensreformbewegung zurück). Auch die Gründung der Klein- oder Schrebergärten, der Gartenkolonien fällt in die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Berühmt ist die 1893 gegründete, heute noch bestehende Obstbausiedlung Eden, in Berlin-Oranienburg.33 Die Produkte der Firma Eden, die bis heute in jedem Reformhaus zu finden sind, haben ihren Ursprung in der Obstbausiedlung Eden.34
Die Lebensreformbewegung hat sich auch auf dem Gebiet Schule und Bildung ausgewirkt. Und zwar unter dem Namen „Reformpädagogik“. Eines der wichtigsten reformpädagogischen Schulprojekte war die von Gustav Wynecken gegründete und anfangs geleitete „Freie Schulgemeinde Wickersdorf“, die mit wechselndem Schicksal von 1906 bis 1991 Bestand hatte.35 (Wynecken hatte auch beim Meißner-Treffen 1913, auf das ich gleich zurückkommen werde, eine Schlüsselrolle inne.) Ebenfalls dem Nährboden der Reformpädagogik entsprungen sind zwei weitere, wesentlich bekanntere Schulmodelle: das von Maria Montessori (1870-1952) entwickelte Modell (Montessoripädagogik, Montessorischulen) und das von Rudolf Steiner (1861-1925) entwickelte Modell (Waldorfpädagogik, Waldorfschulen, Rudolf-Steiner-Schulen). Beide Modelle zählen bis heute zu den alternativen pädagogischen Modellen schlechthin, weltweit. Sowohl Maria Montessori als auch Rudolf Steiner haben mit der Unterrichtung der sozial Benachteiligten, nämlich der Arbeiterkinder, begonnen, Montessori in Rom, Steiner in Stuttgart. Erziehung zum Kind-Sein-Dürfen, zur Individualität, zur Naturverbundenheit, zur Kreativität und zum Verantwortungs-Übernehmen: das stand und steht bei allen reformpädagogischen Ansätzen im Vordergrund; auch bei der heutigen Erlebnispädagogik, bei der die Reformpädagogik ebenfalls Pate stand.36
Natürlich gäbe es zur Lebensreform- und Jugendbewegung weit mehr zu sagen. Ich möchte es aber mit dieser Kurzdarstellung gut sein lassen. Sie genügt, um zu sehen: dass und wie man/frau auf der Basis all dieser Natur- und Gemeinschaftserfahrungen ein neues Lebens- und Naturgefühl gewann, dass und wie man/frau sich kritisch gegen Fortschrittsideologie und Kapitalismus, gegen Mechanisierung und Entfremdung, gegen Ausbeutung und Naturzerstörung wandte.
III. Zivilisationskritik 1913: Ludwig Klages’ „Mensch und Erde“
Ein aufschlussreiches Zeugnis dieser Zeit ist Ludwig Klages’ (1872-1956) Schrift „Mensch und Erde“. In Klages (und genauso in Theodor Lessing, s. u.) berühren und verschlingen sich manche der soeben genannten Kreise: Er war Teil der Schwabinger Künstler- und Philosophenszene um Stefan George, war ‚Jugendbewegter’ und ‚Jugendbewegender’, Naturschützer, Technikkritiker, v. a. aber Lebensphilosoph. Seine programmatische Schrift „Mensch und Erde“ hat Klages anlässlich des ersten Jugendtreffens am Hohen Meißner 1913 verfasst. Während des Meißner-Treffens schlossen sich 13 Verbände zur „freideutschen Jugend“ zusammen, formulierten die sogenannte „Meißner-Formel“37 und gaben eine Festschrift heraus. Klages’ Aufsatz erschien in dieser Festschrift. Er prangert darin die technologische Zivilisation an, Alles und Jedes dem finanziellen Kalkül sowie egozentrischen Machtinteressen unterworfen zu haben:
„Auch wem die furchtbaren Folgen noch fremd geblieben, die der Leitgedanke des ‚Fortschritts‘ gezeitigt hat, müßte angesichts jener Gründe stutzig werden. Dem antiken Hellenen war Höchsterwünschtes die ‚Kalokagathie‘, das ist die innere und äußere Menschenschönheit, die er im Bilde der Olympier sah; dem Mittelalter das ‚Heil der Seele‘, worunter es die geistige Erhebung zu Gott verstand; dem Goetheschen Menschen die Vollkommenheit der Haltung, die ‚Meisterschaft‘ im Wechsel der Geschicke; und, wie verschieden solche Ziele, wir verstehen ohne weiteres das tiefe Glück in der Erreichung eines jeden. Worauf aber der Fortschrittler stolz ist, sind bloße Erfolge, sind Machtzuwachse der Menschheit, die er gedankenlos mit Wertzuwachsen verwechselt, und wir müssen bezweifeln, ob er ein Glück zu würdigen fähig sei und nicht vielmehr nur die leere Befriedigung kenne, die das Bewußtsein der Herrschaft gibt. Macht allein ist blind gegen alle Werte, blind gegen Wahrheit und Recht und, wo sie diese noch zulassen muß, ganz gewiß blind gegen Schönheit und Leben.“38
Um die zerstörerische Seite einer auf Fortschrittsideologie fußenden technologischen Zivilisation zu zeigen, listet Klages unzählige ausgerottete oder vom Aussterben bedrohte Tierarten auf, weist auf zerstörte oder verunstaltete Kulturund Naturlandschaften hin, erwähnt die Zivilisierungs- und Vernichtungstaktiken, mit denen ‚Naturvölker’ ausgemerzt werden, weist auf Auswirkungen zunehmender Industrialisierung wie Luftverschmutzung, Lärmbelästigung, Verstädterung und Naturentfremdung hin. Sein Resümee:
„Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menschheit ergriffen, die ‚Zivilisation‘ trägt die Züge entfesselter Mordsucht, und die Fülle der Erde verdorrt vor ihrem giftigen Anhauch.“39 „Wir täuschten uns nicht, als wir den ‚Fortschritt‘ leerer Machtgelüste verdächtig fanden, und wir sehen, daß Methode im Wahnwitz der Zerstörung steckt. Unter den Vorwänden von ‚Nutzen‘, ‚wirtschaftlicher Entwicklung‘, ‚Kultur‘ geht er in Wahrheit auf Vernichtung des Lebens aus. Er trifft es in allen seinen Erscheinungsformen, rodet Wälder, streicht die Tiergeschlechter, löscht die ursprünglichen Völker aus, überklebt und verunstaltet mit dem Firnis der Gewerblichkeit die Landschaft und entwürdigt, was er von Lebewesen noch überläßt, gleich dem ‚Schlachtvieh‘ zur bloßen Ware, zum vogelfreien Gegenstande eines schrankenlosen Beutehungers. In seinem Dienste aber steht die gesamte Technik und in deren Dienste wieder die weitaus größte Domäne der Wissenschaft.“40
IV. Zivilisationskritik 1914: Theodor Lessings „Europa und Asien“
Ein Jahr nach Klages’ „Mensch und Erde“, 1914, hielt Theodor Lessing einen Vortrag zum Thema „Europa und Asien“. Aus diesem Vortrag ist ein gleichnamiges Buch hervorgegangen, das in seinen Grundzügen 1914/1915 verfasst wurde, dessen Veröffentlichung 1915 aber von der deutschen Militärzensur unterdrückt wurde und das deshalb erst 1918, nach dem ersten Weltkrieg, ersche...