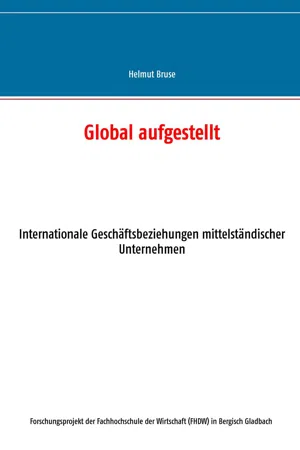![]()
Das Phänomen der Globalisierung bestimmt heute den Alltag, ausländische Produkte begleiten uns den ganzen Tag und sind uns selbstverständlich geworden. Seit 1990 hat sich die weltwirtschaftliche Verflechtung stark intensiviert. Globalisierung gilt als einer der wichtigsten ökonomischen (und gesellschaftlichen) Trends im ausklingenden 20. Jahrhundert. Unternehmen stehen im Spannungsfeld der Globalisierung, sie sind sowohl Treiber als auch Getriebene der Globalisierung (Bruse 2011). Die weltwirtschaftliche Entwicklung betrifft nicht nur Großunternehmen. Durch die steigende Globalisierung der Märkte und den Wettbewerb im Rahmen der internationalen Konkurrenz verstärkt sich auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Druck international zu agieren. Unter ihnen gibt es Nischenmarktführer (Hidden Champions), aber auch andere Firmen, die weltweit tätig sind und ihre Zuliefer- und Abnehmernetze weltweit steuern. Sie alle sind in diverse Unternehmensnetzwerke eingebunden, die unterschiedlich ausgestaltet sind.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Forschungsprojekt „Internationale Unternehmensnetzwerke von Mittelständischen Unternehmen“ initiiert, das sich mit den internationalen Geschäftsbeziehungen von mittelständischen Unternehmen innerhalb ihrer Wertschöpfungskette befasst. Es betrifft auf der einen Seite die Untersuchung von mittelständischen Unternehmen, auf der anderen Seite die Thematik des internationalen Managements. Unter dem zweiten Aspekt geht es speziell um die Charakteristika von internationalen Geschäftsbeziehungen. Gegenstand einer derartigen Fragestellung sind die Erfassung der Komplexität der internationalen Geschäftsbeziehungen, Effekte, Erfolgsfaktoren sowie Risiken, die sich aus den verschiedenen charakteristischen Typen ergeben, und die Auswirkungen von unterschiedlichen Typen und Strukturen komplexer Geschäftsbeziehungen auf die Wettbewerbsfähigkeit. Damit ist das Projekt thematisch an der Schnittstelle von internationalem Management und KMU anzusiedeln.
Dyadische Beziehungen und netzwerkartige Strukturen haben in jüngster Zeit eine hohe wissenschaftliche Beachtung gefunden, wobei die Aussage aus dem Jahre 2005 von Frau Wittig, die für Deutschland eine Untersuchung der Netzwerkbildung bei Logistikdienstleistern durchgeführt hat, zu den vorhandenen Defiziten der Netzwerkforschung immer noch Gültigkeit hat (Wittig 2005). Neben dieser Analyse zu Logistikbeziehungen sind (im deutschsprachigen Raum) für derartige Beziehungen vor allem die Arbeiten von Rogge 2012 und Kayser 2013 zu nennen, die sich mit internationalen Informationsbeziehungen / Netzwerken befassen.
In dieser Untersuchung stehen – quasi als Ergänzung – die internationalen Geschäftsbeziehungen innerhalb der Wertschöpfungskette im Fokus. Zunächst werden nochmals die Ergebnisse der Erarbeitung des theoretischen Rahmens für das Forschungsprojekt kurz dargelegt (eine ausführliche Erörterung findet man bei Bruse 2015). Unter diesem Aspekt werden zunächst Ansätze zur Erklärung von internationalen Geschäftsbeziehungen, speziell die Gestaltung der Kernprozesse Supply- Chain und Marktbearbeitung, erläutert (2. Abschnitt). Nach der Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes in Form einer Befragung (3.Abschnitt) werden die gewonnenen empirischen Ergebnisse dargestellt (4. Abschnitt). Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Fazit und Ausblick.
![]()
Zunächst steht die Frage nach Ansätzen zur Erklärung von internationalen Geschäftsbeziehungen, der Entstehungsweise und Rationalität von Kunden- und Zulieferbeziehungen sowie der Internationalisierung von Unternehmen im Vordergrund. Es ist die Frage zu beantworten, wie das Zustandekommen von Beziehungen zwischen Unternehmen theoretisch begründet und erklärt werden kann (zu einer ausführlicheren Diskussion siehe Bruse 2015 und die dort zitierte Literatur; diese Überlegungen werden nachstehend dargestellt bzw. übernommen ohne jeweils im Einzelnen konkret darauf zu verweisen).
Knappheit bildet eine grundlegende Ursache für ökonomische Phänomene wie Tausch, Arbeitsteilung, Märkte, Unternehmen oder Wettbewerb. Wirtschaften bedeutet, rationale Entscheidungen über die Verwendung knapper Ressourcen zur Erfüllung gegebener Zwecke zu treffen. Der Zweck von Unternehmen besteht in diesem Zusammenhang in der wirtschaftlichen Wertschöpfung.
Den größten Beitrag zur Minderung der Knappheit leisten Arbeitsteilung und Spezialisierung. Diese Aktivitäten sind verbunden mit den Aufgaben von Abstimmung und Tausch. Es entstehen Koordinationsprobleme (d.h. Probleme der Information, des Nichtwissens) und Motivationsprobleme bzw. Interessenkonflikte (z.B. ein Akteur verfolgt andere Ziele als der Auftraggeber oder Probleme des Nichtwollens). Damit gewinnen Abstimmungs- und Koordinationsprobleme an Bedeutung; es ist das Organisationproblem zu lösen. Als Kernaufgabe der Unternehmensführung kann man dementsprechend die Unternehmens-Umwelt-Koordination bezeichnen.
Im Rahmen einer Fundierung des Verhaltens von Unternehmen und der Ausgestaltung der Unternehmensführung können organisationstheoretische Erklärungsansätze herangezogen werden. Eine Basis bildet hier u.a. die „Neue Institutionenökonomie“, deren Ziel darin besteht, effiziente institutionelle Regelungen zur Organisation des Austauschs von ökonomischen Leistungen abzuleiten. Institutionenökonomische Ansätze liefern eine Begründung der Existenz und der Effizienz von Organisationen. Im Zusammenhang mit der Unternehmens-Umwelt-Koordination interessiert hier speziell die Marktorganisation bzw. Marktstruktur. Erklärungsansätze hierzu liefert die Transaktionskostentheorie bzw. unter deren Anwendung die Internalisierungstheorie.
Die Basisfrage des Transaktionskostenansatzes lautet: Warum werden nicht alle ökonomischen Transaktionen über den Markt abgewickelt? Transaktionen sind – entgegen der Auffassung der klassischen Wirtschaftstheorie – nicht kostenlos, man kann bestimmte Transaktionen effizienter organisationsintern, d.h. innerhalb der Unternehmung, durchführen. Die drei charakteristischen Koordinationsformen Hierarchie, Markt und Hybridform (mehr oder minder langfristige Geschäftsbeziehungen, die zwischen Markt und Hierarchie angesiedelt sind) weisen in Abhängigkeit von Spezifität und Unsicherheit unterschiedlich hohe Transaktionskosten auf. Dies ist die zentrale Aussage der Transaktionskostentheorie.
Die Kosten der Marktlösung lassen sich nach ex-ante- und ex-post-Transaktionskosten unterscheiden.
Zu den ex-ante-Transaktionskosten zählen:
- Suchkosten (z.B. Informationskosten, Kosten der Lokalisierung von möglichen Vertragspartnern),
- Anbahnungskosten (z.B. Recherche, Reisen, Beratung),
- Kosten der Vereinbarung (z.B. Verhandlung, Vertragsformulierung, Rechtsabteilung, Einigung).
Als ex-post-Transaktionskosten gelten:
- Abwicklungskosten (z.B. Prozesssteuerung in Form von Tauschkosten, Abwicklungsgebühren),
- Kosten der Steuerung und Kontrolle (z.B. Qualitäts- und Terminüberwachung, Absicherung der Vertragsbedingungen, Einklagung von Leistungen),
- Anpassungskosten (z.B. Nachverhandlungen bzw. Konditionen-anpassung im Rahmen von Vertragsänderungen, Zusatzkosten aufgrund nachträglicher qualitativer, preislicher oder terminlicher Änderungen, Lösung von Konflikten).
Man versucht das institutionelle Arrangement zu erreichen, das zwischen den Transaktionspartnern bzgl. der ökonomischen Austauschbeziehungen eine kostenminimale Abwicklung gewährleistet. Dabei werden diese Transaktionen beeinflusst von den (kostenwirksamen) Transaktionscharakteristika wie:
- die Spezifität der für eine Transaktion notwendigen Investitionen,
- die Unsicherheit der Handlungsumwelt,
- die Häufigkeit der Transaktionen.
Insbesondere die Häufigkeit ist von Bedeutung, denn je häufiger die Transaktionspartner identische Transaktionen miteinander durchführen, umso höhere Skaleneffekte lassen sich realisieren. Diese besitzen ebenfalls entscheidenden Einfluss auf die gewählte Transaktion.
Auch das Problem der Verteilung der Verfügungsrechte wird durch die Transaktionskostentheorie abgebildet, wobei diese die theoretische Grundlage der sog. Internalisierungstheorie im Internationalen Management bildet. Die Internalisierungstheorie hat die Fragestellung zum Gegenstand, unter welchen Bedingungen Unternehmen bestimmte Aktivitäten innerhalb des Unternehmens abwickeln, in das Unternehmen „hineinholen“, d.h. internalisieren. Sie thematisiert vor allem die Bedingungen, unter denen Unternehmungen bestimmte Aktivitäten intern vollziehen und beantwortet die Frage nach dem „Wie?“ der internationalen Geschäftsbeziehungen. Es handelt sich dabei also im Kern um die Übertragung transaktionskostentheoretischer Überlegungen.
Wann macht eine Internalisierung nun konkret Sinn? Es werden gerade Güter internalisiert werden, die immaterielle bzw. intangible Ressourcen von Unternehmen darstellen, z.B. Informationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen. Es handelt sich also um Wissen, das nur teilweise in Form von Dokumenten ausgetauscht werden kann, z.B. durch Patente, Copyrights oder Lizenzen. Diese lassen sich nur unter besonderen Schwierigkeiten über den Markt beziehen.
Wenn sie unternehmensintern international kostengünstiger als über Auslandsmärkte disponiert werden können, kommt es zu Direktinvestitionen im Ausland. Aber um Direktinvestitionen zu tätigen braucht man Finanzkraft – dies ist bei mittelständischen Unternehmen bzw. KMU weniger der Fall als bei Großunternehmen. Ein Ansatzpunkt zur Lösung dieser Schwierigkeiten ist Bildung von Kooperationen.
Zwischen den beiden Extremformen Markt und Hierarchie gibt es in der Realität weitere Organisations- und Koordinationsformen, ein vielfältiges Spektrum an Zwischenformen und Mischformen, z.B. langfristige Unternehmenskooperationen, strategische Allianzen, Netzwerke (hybride Organisationformen). So kann man die einzelnen Integrationsformen in Abhängigkeit von den Transaktionskosten und der Spezifität darstellen. Unternehmen (Hierarchien) haben unabhängig von der Spezifität die höchsten fixen Transaktionskosten, z.B. der bürokratische Apparat. Sie stellt jedoch eine Vielzahl von Anreiz- und Kontrollmechanismen bereit, die besonders die Durchführung spezifischer Transaktionen erleichtert. Markttransaktionen dagegen zeichnen sich durch die geringsten Fixkosten aus. Da längerfristige vertragliche Bindungen fehlen, sind die variablen Transaktionskosten zusätzlicher Spezifität sehr hoch.
Generell kann eine hybride Koordinationsform weder dem Markt noch der Hierarchie vorgezogen werden, da alle Formen ihre Vor- und Nachteile haben. Zusätzlich ergeben sich Veränderungen durch die Verbesserung der Informations-und Kommunikationstechnik. Sie reduzieren die Transaktionskosten und führen damit zu einer Tendenz einer wirtschaftlichen Leistungserstellung über den Markt (Move-to-the-Market-Hypothese). Der Zusammenhang lässt sich graphisch wie folgt darstellen:
Abb. 1: Move-to-the-Market durch sinkende Transaktionskosten; Quelle: Picot/ Reichwald/ Wigand 2003, S. 72
Bei steigender Spezifität und damit steigenden Transaktionskosten (z.B. durch die Absicherung gegenüber dem Opportunismus des Transaktionspartners) wird ein Punkt S1 erreicht, bei welchem die Abwicklung über eine Hybridform gegenüber dem Markt zu bevorzugen ist. Steigt die Spezifität weiterhin und über schreitet den Punkt S2, sollte der Prozess im eigenen Unternehmen abgewickelt werden. Mit modernen Informations- und Kommunikations-technik verschieben sich die entsprechenden Übergänge zu den Punkten S1‘ und S2‘. Durch diese Entwicklung entstehen durch Vernetzung unternehmensübergreifende Informations- und Kommunikations-systeme, die nicht nur eine bessere Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette zulassen, sondern auch eine Tenden...