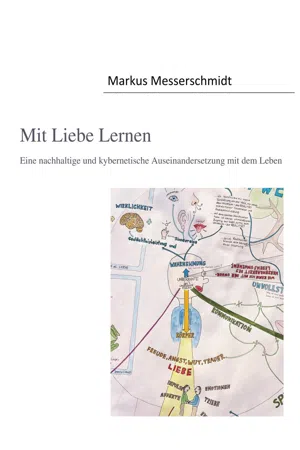![]()
1 Einleitung
Die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung: sie muss sich neu erfinden und lernen wie sie nachhaltig in einer gemeinsamen Welt leben kann. Das erfordert vor allem eines: das Wissen darüber, wie sie das erlernen und folglich tun kann. Diese Arbeit versucht jenen Prozess des Lernens oder genauer des Erlernens des Lernens mit Hilfe der Kybernetik darzustellen. Es soll ein „Werkzeug zum Denken“ – ein konkretes Bewusstsein beschrieben werden,
- das zu nachhaltigem Tun befähigt
- und anleitet, wie jenes Bewusstsein erreicht oder besser erlernt werden kann.
Das Denken in Kybernetik ist auf diese Weise immanenter Bestandteil dieser Arbeit – mit Hilfe diesem ein Denkgebäude entworfen wird, das den Leser im Erlernen eines „Denkens des Erlernens“ bzw. dem Erlangen eines kybernetischen Bewusstseins begleiten soll.
Das Phänomen des Lernens kann aus zahlreichen Perspektiven beschrieben werden. So gibt es Ansätze aus der Psychologie, der Soziologie, der Philosophie, der Pädagogik etc. Die in dieser Arbeit gewählte kybernetische Perspektive spielt in jenen Wissenschaftsdisziplinen jedoch kaum eine Rolle. Noch weniger findet die Kybernetik im Zusammenhang mit den neuesten Erkenntnissen aus den Kognitions- und Neurowissenschaften Erwähnung, um menschliches Lernen zu beschreiben. Ausgehend von „Schlüsselwerken“ der Systemwissenschaften von u.a. Gregory Bateson, Warren S. McCulloch, Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela, Heinz von Foerster wird jenes Modell des Lernens entworfen, das den („kybernetischen“) Prozess des Lernens beschreibt. Dabei hat diese Arbeit nicht den Anspruch die Historie der Kybernetik wiederzugeben, was den Leser (aufgrund des Umfangs und der unterschiedlichen semantischen Herangehensweisen) nur verwirren würde. Sie versucht vielmehr aus der umfangreichen Literatur das aufzugreifen, was den Prozess des Lernens des Menschen darzustellen vermag und verweist an passender Stelle auf den Ursprung der Gedanken.
1.1 Inhalte der Arbeit
Ausgangspunkt der Darstellung ist die Arbeit von Maturana und Varela (2012): Dabei wird besonders auf das Buch „Der Baum der Erkenntnis“ Bezug genommen. Ausgehend von diesem, werden in Kap. 2 Prinzipien des Denkens in Kybernetik (Zirkularität, Autopoiesis etc.) formuliert und mit den Arbeiten von McCulloch, Bateson, von Foersters etc. verknüpft. Jene Überlegungen stellen den Beobachter in den Mittelpunkt der Erkenntnis, der über sein Tun subjektiv eine Vorstellung von dem gewinnt, was allgemein als Leben bezeichnet wird.
In Kap. 3 wird gezeigt, dass eine sich auf diese Weise erschließende Vorstellung – eine Idee des Beobachters von Realität – Ergebnis der Rekonstruktion von Realität ist, aus der sich auf rekursive Weise die Wirklichkeit des Beobachters immerwährend neu ausformt und in und durch die Sprache zum Ausdruck kommt1. Es wird auch gezeigt, dass dadurch – durch ein „Gemeinsam-in-der-Sprache-Sein“ – Wirklichkeit bzw. die Idee von Realität zu einem sozial geteilten Phänomen wird, welches durch das Symbol sozial bindend und ethisch verpflichtend zum Ausdruck kommt. Um darauf dezidiert eingehen zu können nimmt die Arbeit Bezug auf Literatur der Kommunikationswissenschaften. Unter anderem auf das Buch „Die vermittelte Welt“ von Bernhard Pelzl (2011), das Mechanismen zwischenmenschlicher Vermittlungsprozesse beschreibt.
In Kap. 4 und Kap. 5 werden u.a. die Möglichkeiten erläutert, den Mensch als „kybernetisches System“ zu denken. Es wird die Kybernetik als Logik zur Beobachtung sichtbar, welche beschreibt, wie das eine Beobachtete (nämlich Leben) auf ein Ziel zusteuern kann, das es selbst determiniert. Der Mensch erscheint dabei als „Informationssystem“ das auf Basis der logischen Operatoren der Unterscheidung und der Entscheidung bzw. auf Basis des Prinzips der Resonanz steuert. Desweiteren werden dessen prinzipielle Möglichkeiten erläutert, sich in Zielen – seinen Bedürfnissen – lernend wiederzufinden und sich für diese zu entscheiden.
Von Kap. 6 ausgehend wird erläutert, wie der Prozess des Lernens des „kybernetischen Systems Mensch“
- als subjektiver, individueller und rekursiver Prozess,
- als integrierter Bestandteil von sozialer Interaktion,
- als eine individuelle Ethik konstituierend,
- und zu Nachhaltigkeit führend,
gedacht werden kann. Die Darstellung dessen erfolgt im Rahmen des von Bateson (1994) in „Ökologie des Geistes“ beschriebenen „vier-Stufenmodell des Lernens“. Es beschreibt formal den rekursiv organisierten individuellen Prozess des (kybernetischen) Lernens (aus dem sich die Wirklichkeit des beobachtenden Menschen ausformt) auf den Ebenen von „Lernen null“, „Lernen I“, „Lernen II“, „Lernen III“ und „Lernen IV“. Diese „Lernformen“ werden wiedergegeben und mit Literatur aus den Wissenschaftsdisziplinen der Pädagogik, der Entwicklungspsychologie und der Neuro- bzw. Kognitionswissenschaften erweitert. Auf diese Weise wird diese Arbeit einem interdisziplinaren Verständnis gerecht, das der Kybernetik „innewohnt“ und diese mit „Inhalt ausstattet“. Dem entsprechend wird in dieser Arbeit ein „Werkzeug zum Denken“ – ein konkretes kybernetisches Bewusstsein dargestellt.
Darin erschließt sich, so wird gezeigt, eine „ethische Konsequenz“, die Nachhaltigkeit einfordert, welche aus der konzeptuellen Unterscheidung des trivialen und des nichttrivialen Denkens hervorgeht und zugleich zu einer notwendigen Unterscheidung von Moral und Ethik führt. Um dies zu erläutern wird u.a. auf „Understanding Understanding“ und „KybernEthik“ von von Foerster (2003 und 1993) eingegangen. Der kybernetische Prozess des Lernens bzw. die darin enthaltene ethische Konsequenz ist eng verbunden mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit: einer Nachhaltigkeit „erster“ und „zweiter Ordnung“, welche es dem Mensch bzw. der Menschheit ermöglicht, sich nachhaltig (unverändert verändert) immerwährend neu zu erfinden. Jene Zusammenhänge – die Idee einer „kybernetischen Nachhaltigkeit“ – wird in Kap. 7 erläutert.
Die nachhaltige lernende Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst bedeutet auch immer eine Begegnung mit dessen Emotionen bzw. Gefühlen: mit unangenehmen, wie auch angenehmen Empfindungen –mit Ängsten, mit Wut und mit Trauer, aber auch mit Freude, einem empfinden von Glück und das verspüren von Liebe. Jene Mechanismen des Lernens bzw. die für den Menschen sich darbietenden Möglichkeiten des Lernens mit und über Emotionen bzw. Gefühlen werden über eine „psychophysiologische Perspektive“ dargestellt. Dabei wird u.a. auf „Biologische Psychologie“ von Niels Birbaumer und Robert F. Schmidt (2006), auf „EQ: Emotionale Intelligenz“ von Daniel Goleman (2011), auf „Alles fühlt: Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften“ von Andreas Weber (2014) Bezug genommen. Es wird ersichtlich, das sich der Lernende Mensch im Fühlen bedingt: Lernen bedeutet Fühlen. Jener Zusammenhang wird ausführlich in Kap. 6.3 erläutert und findet sich selbstähnlich angewandt in den darauf folgenden Kapiteln wieder.
Diese Arbeit ist in diesem Sinn in der Kognitionswissenschaft beheimatet und versucht, die „Frage des Seins“ (der Ontologie), und die „Frage des Ziels“ (der Teleologie bzw. Teleonomie2) umfassend zu vereinen und zu lösen. Gerade durch die Bezugnahme der erwähnten Literatur soll das Modell des Lernens anschaulich, nachvollziehbar bzw. nutzbar beschrieben werden und theoretisch validiert werden. Von der kybernetischen Konzeption ausgehend sollen die folgenden Forschungsfragen beantwortet werden: Was ist lernen? Wie lernt der Mensch?
Mit dem „Praxiskapitel“ 8 wird die Absicht verfolgt, zu untersuchen, inwiefern das dargestellte kybernetische Modell von Lernen verallgemeinert werden kann. Hierzu wird auf „Reinventing Organizations“ von Frederic Laloux (2015) Bezug genommen, welcher empirisch Strukturen, Prozesse, Praktiken und Kulturen zukunftsweisender „evolutionärer“ Organisationen (Wirtschaftsunternehmen, gemeinnützige Organisationen, eine Schule etc.) untersucht und in der Konzeption eines evolutionären Bewusstseins zusammenfasst. Die weitere praxisorientierte Ausarbeitung des Phänomens Lernen erfolgt in der Auseinandersetzung mit Sandra Krautwaschl. Sie hat nach der Premiere des Kinofilms „Plastic Planet“ von Werner Boote gemeinsam mit ihrer Familie beschlossen fast ohne Plastik zu leben. Das „Experiment“ dauert mittlerweile seit dem Jahr 2009 an und hat das Leben von Frau Krautwaschl und ihrer Familie auf bemerkenswerte Weise nachhaltig verändert. Bezugnehmend auf das von Krautwaschl (2012) veröffentlichte Buch „Plastikfreie Zone: Wie meine Familie es schafft, fast ohne Plastik zu leben“, der Homepage „http://www.keinheimfuerplastik.at/“ und einem geführten Interview (siehe Anhang 11.4; B4) wird untersucht,
- inwiefern formulierte Ziele erreicht wurden und werden
- und wie das Lernen gemeinsam im Familienverbund gelungen ist.
Um nachhaltige päd-(agogische) Aspekte des Lernens zu untersuchen werden Konzepte des Lernens, wie auch praktische Erfahrungen des Lernzentrums des Colearning Wien (2016) untersucht. Dessen im „Selbstexperiment“ angewandte und erforschte (Päd-)Agogik findet sich im Versuch wieder, „natürliches Lernen“ mit „bildendem Lernen“ und deren praktischen Anwendung zu verbinden. Vor allem durch geführte Interviews (siehe Anhang 11.4; B1, B2, B3) mit den Gründern des Colearning Wien soll das Phänomen der Nachhaltigkeit von Lernen in der Pädagogik untersucht werden. Bedeutend hierbei ist die Sichtbarmachung der Antworten auf die Frage, wann Information bzw. Wissen „lebendig“ wird, also Wissen zu nachhaltigen Entscheidungen und nachhaltig veränderten Verhalten führt.
Diese Arbeit stützt sich im Zuge dessen auf eine umfassende Literaturrecherche (Quellen untersuchende Methode). Diese werden mit Interviews und Informationen aus Praxisbeispielen (empirische Methode), sowie mit Wissen aus anderen Disziplinen zusammengeführt (zusammenfassende Methode). Auf Basis dessen werden Möglichkeiten zur Verallgemeinerung erarbeitet und ein theoretisch/philosophisches in der Praxis anwendbares Modell des kybernetischen Lernens des Menschen entworfen.
Das in dieser Arbeit konstruierte Denkgebäude des kybernetischen Lernens des Menschen ist, so wird gezeigt werden, Ausgangspunkt einer Sinn machenden Auseinandersetzung mit der Auseinandersetzung mit dem Leben. Aus einer solchen „Auseinandersetzung zweiter Ordnung“ gehen nicht nur die der Kybernetik innewohnenden Ideen von „Zirkularität“ und „self-correction“ hervor, sondern es werden auch mit Sinn die Begrifflichkeiten des „Selbst-bewusst-Seins“, der „Selbst-Verantwortung“ und der „Selbst-bestimmt-heit“ erläutert – „in denen“ der Mensch auf die Prozesse seines eigenen Zustandekommens zurückgeworfen wird und ihn konsequent dazu auffordern sein eigenes Zustandekommen lernend zu verändern.
1.2 Grundaspekte der Kybernetik
Diese Einleitung erfährt mit den folgenden drei Unterkapiteln eine Fortführung, welche dem Leser vorweg eine „Ahnung“ dessen geben soll, was ihn in dieser Arbeit aus einer kybernetischen Perspektive erwartet. So werden in Kap. 1.2.1 die Grundzüge der hier eingenommenen kybernetischen Perspektive erläutert, welche die Kybernetik als Informationstheorie erscheinen lässt. Kap. 1.2.2 beschreibt den historischen Kontext der Kybernetik und gibt Einblick in die ursprüngliche Motivation, etwas kybernetisch zu denken. Kap. 1.2.3 findet sich im „Ursprung“ (mit dem 1943 verfassten Artikel „Behaviour, Purpose, and Teleology“ von Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener und Julian Bigelow) des kybernetischen Paradigmas wieder und beschreibt ausgehend hiervon einleitend und schemenhaft dessen Anwendung auf das hier im Mittelpunkt stehende „lernende System Mensch“.
1.2.1 Kybernetik als Informationstheorie
Bateson (1994, S. 366-367) zufolge beschreibt das Wort Lernen „eine Veränderung irgendeiner Art“. Beobachtbar wird diese beim Menschen durch eine Verhaltensänderung, welche durch „Erfahrung und Übung“ ausgelöst wird, so Oerter et al. (2008, S. 967). Dabei bedingt sich der Prozess des Lernens zwar in den genetischen Voraussetzungen des Menschen – von übergeordneter Bedeutung ist jedoch dessen Umwelt (Ebd., S. 968).
Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist Lernen von besonderer Bedeutung, wenn es den Charakterzug der „Nachhaltig“ aufweist, sprich Ergebnisse eines vorangegangenen Lernens für den Menschen „anwendbar“ erhalten bleiben (Ebd., S. 967-968): Veränderung bzw. Felxibilität und Stabilität im Laufe des Lebens eines Menschen sind darin unmittelbare „Größen“ der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Das entwicklungspsychologische Paradigma geht in diesem Zusammenhang auch davon aus, dass der Mensch Einfluss auf die eigene Entwicklung hat. Implizit ist dabei die Annahme, der Willensfreiheit und Wahlmöglichkeit, wodurch der mündige Mensch in der Interaktion mit sich selbst und seiner Umwelt sein Potential erforschen und entwickeln kann (Ebd., S. 11). Diese Ansicht findet als Ausgangspunkt – in Form einer Präsumtion des hier konstruierten Denkgebäudes Anwendung.
Die Wissenschaftsdisziplinen der Kognitiven Psychologie und der Kognitiven Neurowissenschaft beschäftigen sich mit den möglichen spezifischen Signalfolgen im Nervensystem des Menschen, die Ergebnis konkreter Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt sind und geben auf diesem Weg Aufschluss über das Phänomen Lernen (Nicholls et al. 1995, S. 5). Die Kognitiven Psychologie, die Kognitiven Neurowissenschaft, wie auch die Entwicklungspsychologie, versuchen dabei Lernen über den abstrakten Weg einer Informationstheorie zu beschreiben und teilen sich aus diesem Grund eine Fülle von Begriffen und Konzepte (Anderson 2007, S. 11-18).
Die in dieser Arbeit verwendete Theorie der Kybernetik (gr. κυΒɛρνήτης „Steuermann“) beschreibt die Steuerung und Regelung von Systemen auf Basis von Informationen (Weller 2011, S. 11). Die Kybernetik kann aus diesem Grund als Theorie über die Physiologie der Information bzw. des Wissens bezeichnet werden und hat Rustemeyer (2005, S. 110) zufolge, zudem den Anspruch eine Einheitswissenschaft zu sein: Sie beschreibt ein disziplinüberschreitendes humanwissenschaftlichen Modell, welches fähig ist, die Grenzen der Geistesund Naturwissenschaften aufzuheben, indem sie als „unterschiedliche Konkretisierungsformen“ eines abstrakten Paradigmas – nämlich im Rahmen einer Informationstheorie formuliert wird (Simon 2005, S. 31). In i...