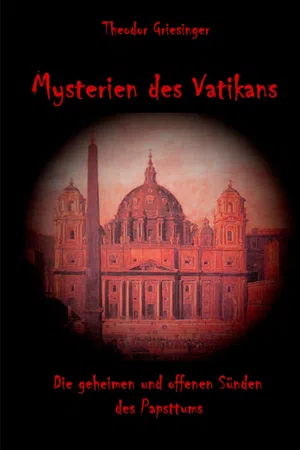![]()
Erster Teil.
Vorwort.
Es dürfte vielleicht manchen wundern, wie ich dazu gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, und Einzelne dürften möglicherweise sogar den Kopf darüber schütteln, dass ich den alten päpstlichen Sauerteig noch einmal aufgerührt habe.
«Lass die Toten ruhen,» werden sie mir entgegenrufen, «die Zeiten der päpstlichen Hierarchie sind längst vorüber. - Warum also die Katholiken an die Sünden der früheren Oberhirten der Kirche erinnern?»
Auf diese Art wird man mir entgegentreten, aber ich frage nun umgekehrt: «Ist das Papsttum wirklich tot, oder hat es sich nicht vielmehr in den letzten zehn Jahren von Neuem aufgerafft und alle ihm zu Gebot stehende Macht angewandt, um das Mittelalter von Neuem heraufzubeschwören? Ist nicht in den letzten zehn Jahren alles geschehen, was nur geschehen konnte, um der Priesterherrschaft den alten Glanz zu verleihen und die christliche Menschheit wieder in die vorreformatorische Macht zurückzustürzen? Ja, war es nicht bereits wieder so weit gekommen, dass man in gewissen Kreisen jeden, welcher pfäffische Übergriffe und ultramontane Intoleranz mit den richtigen Worten zu bezeichnen wagte, als einen Feind der katholischen Religion ausschrie und so, die Begriffe absichtlich miteinander verwechselnd, den Gegner des Papismus als einen Gegner des Katholizismus verlästerte?
Der Ultramontanismus1 ist also nicht tot und ebensowenig die Sucht des Papsttums, die alte despotische Macht wieder zu erlangen. Beweis genug hierfür sind die teils abgeschlossenen, teils versuchten Konkordate2, noch mehr aber das Gebaren des Klerus in den Ländern, in welchen ein solches Konkordat Gesetzeskraft erlangt hatte. Hier wurden nicht mehr bloß die Fühler herausgestreckt, sondern man griff vielmehr mit fast Gregorischen Krallen zu. War es also nicht an der Zeit, den Mund aufzutun und dem Pfaffentum eins auf die Tatze zu geben?
Von diesem Gesichtspunkt aus bitte ich dieses Buch zu betrachten und wenn es auch in historischer Beziehung außer der gewählten Form nichts Originales bietet, so dürfte es doch wenigstens dem Nichttheologen gegenüber den Wert haben, dass es eine klare Übersicht gibt über das, was die Päpste einst taten und bezweckten, sowie darüber, wie sie es taten und mit welchen Mitteln.
Stuttgart, im September 1861.
Theodor Griesinger.
![]()
1. Buch.
Der Papst und die Armut.
Motto:
Wo Geiz ist und Gier nach fremd‘ Geld und Gut,
Da der Betrug auch nicht ausbleiben tut.
Darauf der diebisch‘ Teufel sich nicht säumt,
Sein Ross hat er bald aufgezäumt;
Den Wucher hat er in seinem nächsten Gefolg‘
Und selbst Mord scheut er nicht für‘s Geld.
(Aus dem Buch: Von den zehn Teufeln3)
1. Kapitel.
Die ersten Bischöfe und der Vatikan zu Rom.
Die gesellschaftliche Einrichtung der ersten Christengemeinden war eine äußerst einfache und entsprach ganz dem Geist, welcher vom Gründer des Christentums ausging. In jenen Zeiten, das heißt in den Zeiten, in welchen Christus auf Erden wandelte, hatten sich die verschiedenen Religionen, denen die Völker huldigten, besonders aber auch das Judentum in einen eitlen Zeremonien- und Opferdienst verwandelt und die ganze Gottesverehrung bestand aus einem äußeren Kult, einer äußeren Gesetzesbeachtung, woraus jeder Geist und jedes innere Leben gewichen war. Diesem Zeremoniendienst trat Christus entgegen und lehrte, dass nicht die äußere Beachtung des Kultes oder des Gesetzes die Religiosität ausmache, sondern vielmehr die Gesinnung, die «Anbetung Gottes im Geiste und in der Wahrheit.» Er verwarf die Satzungen der Priester, die den starren Buchstaben befolgt wissen wollten, und bewies, dass nur Liebe, Demut und Duldsamkeit den Menschen zu einem Kind Gottes machen.
Dieser Geist der Liebe, Demut und Duldsamkeit wehte also in den ersten Christengemeinden, welche von den Aposteln und deren Jüngern hier und dort gegründet wurden. Kein Einziger der Neubekehrten stand über dem Anderen, kein Einziger hatte einen Vorzug vor seinem Mitbruder, es sei denn den der größeren Liebe, der größeren Demut. Alle waren gleich und hatten gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Auch die Apostel selbst stellten sich nicht höher als ihre Mitchristen. Sie bestrebten sich bloß eines größeren Eifers, einer größeren Tätigkeit, als die anderen, und setzten ihren Ruhm in die Opfer, welche sie der Verbreitung der neuen Lehre brachten. Demnach kann man sich wohl denken, dass, wenn in den einzelnen Gemeinden jedes Mitglied dem anderen durchaus gleichgestellt war, auch die Gemeinden selbst keinen Vorzug oder gar Vorrang voreinander hatten. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die eine mehr Mitglieder zählte, und vielleicht auch reichere als die andere, und möglicherweise in einer Provinz lag, in der sie sich weniger der Verfolgung ausgesetzt sah, als diese oder jene in einem anderen Land.4
Jede Christengemeinde war also der anderen in Bezug auf Rechte und Pflichten gleich und dasselbe war der Fall mit jedem Mitglied in der Gemeinde. Eine Ordnung herrschte deswegen aber dennoch, und die Geschäfte der Gemeinde, ihre Regierungs- und Verwaltungsangelegenheiten, wenn wir so sagen dürfen, litten durch diese Freiheit und Gleichheit keine Not, denn die Gemeindemitglieder wählten sich ihre Vorsteher und Beamten, denen sie die Handhabung der Ordnung anheimstellten, und somit war eine Regierung vorhanden, wenn auch eine freigewählte. Diese Vorsteher nun nannte man (nach dem Muster der jüdischen Synagogen) Presbyter oder Älteste, nicht selten Episcopi (woraus dann das Wort Bischof entstanden ist) oder Aufseher, einfach weil dieselben die Aufsicht über die Gemeindeangelegenheiten hatten. Neben ihnen fungierten die Diakone oder Almosenpfleger als die «Kassierer» der Gesellschaft, welcher sie auch als solche verantwortlich waren.5 Weitere Beamte aber gab es nicht und namentlich waren keine besonderen Lehrer und Prediger bestellt, sondern jeder, der den Beruf und die Fähigkeit in sich fühlte, durfte in den fast allabendlich stattfindenden Versammlungen als Lehrer, Erbauer und Prediger auftreten. Auch Frauen waren nicht ausgeschlossen, und man hat aus jenen Zeiten verschiedene Beispiele von ihnen, die mit besonderem Eifer und Glück wirkten. Natürlich oder sozusagen selbstverständlich war übrigens, dass man nur solche Männer zu Episcopi oder Ältesten wählte, welche sich durch besondere Frömmigkeit und hervorragende geistige Eigenschaften auszeichneten, und dass dann diese «Aufseher» eben ihrer hervorragenden Eigenschaften wegen auch oft und viel als Lehrer und Prediger auftraten. So wurde es nach und nach Brauch, dass man keinen mehr zum Ältesten wählte, wenn er nicht auch zugleich die Gabe der Redekunst besaß. Aber neben ihm durften, wie schon gesagt, auch andere lehren und predigen, und er als Episcopus hatte keinerlei Privileg oder Vorrecht.
Solcherart war die Verfassung der ersten Christengemeinden zur Zeit der Apostel und ihrer Schüler bis tief ins zweite Jahrhundert nach Christi Geburt hinein. Ja sogar im dritten Jahrhundert, als die Lehre Jesu bereits Hunderttausende von Anhängern zählte, hatte sie sich noch nicht viel anders gestaltet. Doch konnte es nunmehr nicht fehlen, dass einzelne größere Gemeinden ein gewisses Ansehen vor anderen erlangten. Dies waren die Muttergemeinden, von denen aus das Christentum in das Umland gekommen war, denn die Erfahrung lehrt, dass Kolonien immer mit einer gewissen Ehrfurcht auf den Mutterstaat sehen. Überdies erbaten sich die neu entstehenden Dorfgemeinden meist ihre Lehrer und Ordner von den Stadtgemeinden und stellten sich somit zwar in kein „Abhängigkeits-“ aber doch in ein „Anhänglichkeitsverhältnis“ zu den letzteren. So bildeten sich sozusagen von selbst „Parochien“ oder „Diözesen“ 6 um die Muttergemeinde herum, und das Ansehen der Letzteren stieg umso höher, in je größerem Ansehen die Stadt stand, in welcher sich die Gemeinde befand. War dann eine solche Gemeinde gar von einem Apostel gegründet worden, und hatte sie damit die Lehre Christi sozusagen aus erster Hand empfangen, so gab dies ihrer Autorität noch ein besonderes Gewicht, denn man wandte sich nun von allen Seiten an sie, um sich in strittigen Fällen beraten zu lassen und zu erkunden, wie es die Apostel in dieser oder jener Beziehung gehalten hätten. Dies war jedoch nur eine freiwillige Ehrerbietung, keineswegs eine Unterordnung und noch weniger eine Abhängigkeit. Das einzige Band, das sie alle vereinigte, war der gleiche Glaube, die gleiche Liebe und die gleiche Hoffnung.
Gerade wie mit den Gemeinden, so ging es auch mit den Vorstehern der Gemeinden. Wuchs nämlich eine solche bedeutend an, so genügten natürlich ein Diakon und noch weniger ein Presbyter nicht mehr. Mit der Kopfzahl vermehrten sich auch die Geschäfte und es mussten also mehrere Diakone, mehrere Älteste gewählt werden. Diese zusammen bildeten ein Kollegium, welches natürlich seinen Vorstand oder Präsidenten zu wählen hatte, da ja sonst kein ordentlicher Geschäftsgang herzustellen gewesen wäre. Zu diesem Präsidenten oder „Oberältesten“ nahm man gewöhnlich den Tüchtigsten und Angesehensten und man pflegte ihn nun zum Unterschied von seinen Mitpresbytern dadurch auszuzeichnen, dass man ihm «ausnahmsweise» den Titel, «Episcopus oder Bischof» zu geben anfing. Man wollte ihn dadurch von den anderen Ältesten, seinen Kollegen, sozusagen unterscheiden, doch ohne ihm damit eine Gewalt oder ein Vorrecht zu übertragen. Er war der Erste an Ansehen in der Gemeinde, unterschied sich aber sonst durchaus in nichts von den Übrigen, denn alle Christen waren damals noch Brüder und einen Unterschied zwischen Laien und Klerikern oder zwischen Weltlichkeit und Priesterschaft kannte man noch nicht.
Also, o Leser, denke dir die christliche Kirche in den ersten paar Jahrhunderten ihrer Existenz – in jenen Jahrhunderten nämlich, als die neue Religion vom Staat noch nicht anerkannt war und die Reichen und Vornehmen es für unschicklich hielten, sich durch die Taufe der Christensekte anzuschließen. Nun aber, o Leser, folge mir nach Rom, der damaligen Hauptstadt der Welt, damit ich dir das zeige, was in wenigen Jahrhunderten mit dieser selben christlichen Kirche vorgegangen ist, deren außerordentliche Einfachheit du soeben erst kennen gelernt hast. Du erinnerst dich ohne Zweifel aus dem christlichen Schulunterricht, den du genossen hast, dass der Apostel Paulus selbst nach Rom kam, um eine Gemeinde daselbst zu gründen, und dass er zwei Jahre dort verweilte, bis er alles richtig instand gesetzt hatte. Du weißt also, dass Rom schon sehr früh eine christliche Gemeinde besaß, und du kannst dir auch denken, dass der „Oberälteste“ derselben, den man am Ende ausnahmsweise Episcopus nannte, bei den Gemeinden ringsum ein ziemliches Ansehen genoss. Aber du weißt auch, dass die Kaiser Nero und Caligula, nebst vielen anderen ihrer Nachfolger mit großer Grausamkeit über die armen Christusbekenner herfielen und zeitweise nicht wenige von ihnen hinmordeten, so dass die ganze Gemeinde oft in den unterirdischen Kellern der Katakomben7 ihre Zuflucht suchen musste, und du kannst dir also wohl denken, dass nur ein frommer, gottergebener Mann, einer, welcher die Schätze des Himmels dem irdischen Wohlergehen vorzog, sich zu dem gefährlichen Amt, der oberste Vorsteher der Christengemeinde in Rom zu sein, hergeben konnte. Somit wird es dich nicht wundern, wenn ich dir sage, dass die Oberältesten oder Bischöfe Roms in den Urzeiten des Christentums sehr einfache und arme, wenngleich fromme und tugendhafte Menschen gewesen sind, die zwar nichts von Macht und Hoheit wussten, aber desto mehr die Gesetze der Demut, der Eintracht und der Bruderliebe kannten. Hatten sie doch damals noch nicht einmal eine Kirche oder ein Gotteshaus, wo sie ihre Andacht feiern konnten!8 Wussten sie doch oft nicht, wo sie ihr Haupt niederlegen sollten, wenn die grausamen Imperatoren ihre Blutbefehle über sie und ihre Gemeinde ergehen ließen! Starben doch fast alle mit nur ganz wenigen Ausnahmen den Märtyrertod und werden noch jetzt als solche, die ihr Leben für ihren Glauben geopfert haben, in der katholischen Kirche verehrt!9
Du weißt dies alles, o Leser, aber nun komm mit mir, und stelle dich hin vor die Behausung, die ich dir zeige! Siehst du es, das Riesengebäude, das größer ist, als irgendein sonstiger Bau in der Welt? Siehst du den Koloss, der düster und finster drohend gleich einem Donnergott mit dem Haupt in den Wolken zu verschwinden scheint, während seine Felsenfüße die Erde stampfen, dass sie sich ächzend gefangen gibt? Weißt du, wer dieser Koloss ist? Das ist der Vatikan, das Eigentum der Nachfolger jener armen Oberältesten oder Bischöfe, von denen ich dir erzählt habe! Das ist der Vatikan, der Wohnsitz des Papstes, des Stellvertreters Christi auf Erden, des unbeschränkten Gebieters über Glauben und Denken der gesamten christlichen Menschheit, in dessen Hand Himmel, Fegefeuer und Hölle gegeben sind! Das ist der Vatikan, dessen Bauten ein Feld von 500 Metern Länge und 250 Metern Breite bedecken. Der Vatikan, in dessen Inneren es zwanzig Höfe, zweihundert Treppen und elftausend Gemächer, Galerien und Säle gibt, der Vatikan, dessen Herstellungskosten sich auf Hunderte von Millionen beliefen!
Welch furchtbare, wahnsinnige Veränderung von damals und jetzt! Man denke sich auf der einen Seite die demütigen Märtyrer der drei ersten Jahrhunderte und auf der anderen die Beherrscher dieses Palastes, der Seinesgleichen an Reichtum und Herrlichkeit nicht hat in der ganzen Welt! Dieser äußere Gegensatz schon wirkt betäubend, aber es ist nicht genug hieran. Folge mir, o Leser; ich will dich in sein Inneres führen, damit du dich selbst überzeugen kannst.
Durch einen langen Säulengang am St. Petersplatz kommen wir in eine Vorhalle, wo die Reiterstatue Konstantins des Großen steht. Dann betreten wir die „Königliche Treppe des Bernini,“ so genannt, weil sie von dem Künstler Bernini herrührt und eines Königs, ja eines Kaisers wert ist. Von ihr aus gelangen wir in den „Königssaal“ Sala regia, welcher seinen Namen schon seiner Größe wegen mit vollstem Recht trägt. Die Decke ist mit reichen Stukkaturarbeiten geziert und den Boden deckt carrarischer Marmor; die Hauptzierde aber bilden fünf große Gemälde: der Bannfluch Gregors IX. gegen Kaiser Friedrich II. gemalt von Giorgio Vasari; die katholische Liga gegen die Türken anno 1571, ebenfalls von Vasari; die Rückkehr Gregors XI. von Avignon nach Rom, von Taddeo Zuccari; die Schlacht von Lepanto, von demselben, und endlich die Pariser Bluthochzeit von Vasari.
An den Königssaal stößt die Sistina, die Sixtinische Kapelle, deren Ruhm die Welt erfüllt. Die Kapelle, welche Sixtus IV. anno 1473 durch den Baumeister Pintelli anlegen ließ, ist nämlich ein Muster von architektonischer Schönheit und zugleich so reich ausgestattet, dass sie allein fast eine Million wert ist. Den Hauptwert hat aber ein Gemälde von Michelangelo, das „Jüngste Gericht“ vorstellend, welches so groß ist, dass es eine ganze Wand einnimmt. Hier drinnen werden in der Karwoche große Festlichkeiten gefeiert, denen der Papst mit den Kardinälen in voller Amtstracht beiwohnt, und die Misereres eines Allegri und Palestrina10, aufgeführt von den noch nie übertroffenen Sängerchören der päpstlichen Kapelle, können nur hier allein in ihrer ganzen Großartigkeit gewürdigt werden. Darum besucht auch kein Fremder Rom, ohne diese Kapelle gesehen zu haben.
Eine andere Nebenkapelle des Königssaals ist die Paulinische Kapelle, berühmt durch zwei Gemälde Michelangelos, das eine die Bekehrung des Apostels Paulus, das andere die Kreuzigung des Apostels Petrus vorstellend. Auch in dieser Kirche finden zu bestimmten Zeiten große Kirchenfeierlichkeiten statt, und wenn dieselbe bei der Vorstellung des heiligen Grabes durch Tausende von Fackeln und Wachskerzen erleuchtet wird, so glaubt man sich ins Reich der Feen und Zauberer versetzt,
Neben der Paulinischen Kapelle dehnt sich der Herzogssaal aus, ein mächtiges Gewölbe mit Deckengemälden von Lorenzino, Rafaellino, Matteo da Siena und anderen. Am Gründonnerstag findet hier unter großem Andrang des Volks die Fußwaschung der zwölf Apostel statt, und daneben befinden sich die Gemächer der sogenannten Paramente, in welchen der Papst die Messgewänder anlegt, wenn er, gefolgt vom Kardinalskollegium, auf seinem kostbaren Thronsessel in die Peterskirche getragen wird, um dort das Hochamt zu halten.
Die bis jetzt angeführten Säle, Kapellen und Gemächer bilden einen eigenen, vier Stockwerke hohen Flügel des Vatikan, um welchen vier Arkadengänge, die sogenannten Loggias, immer einer über den anderen herumlaufen. Diese Loggias sind äußerst merkwürdig, denn ursprünglich von Giuliano da Maiano herrührend, wurden sie nach einer Zeichnung des Künstlerfürsten Raffael umgebaut und überdies enthalten die Arkaden des zweiten Stockwerkes nicht weniger als zweiundfünfzig Gemälde dieses berühmtesten aller Maler. Man nennt daher den zweiten Arkadengang die „Loggia di Raffaele.“ Auch die anderen Loggias enthalten schöne Gemälde und die Wände des dritten Stockwerks sind mit Landkarten aus der Zeit von 1572 – 1583 geschmückt, welche der Dominikaner Ignazio Danti malte.
Wir betreten nun den sogenannten Neuen Palast, der die Aussicht nach dem großen Platz des Vatikan hat und auf Befehl Gregors XIII. von Fontana erbaut wurde. Darin befinden sich die Wohngemächer des Papstes nebst den Büros des Kardinalstaatssekretäres und den übrigen päpstlichen Beamten. Es ist eine ganze Masse von Zimmern und Sälen, welche einzeln anzuführen zu weit führen würde. Wir nennen daher von den Hunderten nur einige wenige, nämlich den Clementinischen Saal, dessen Fresken die Taten des heiligen Clemens vorstellen, dann die Säle der Gräfin Mathilde, gleichfalls geschmückt mit Bildern aus dem Leben dieser großen «Freundschaft» des Papsts Gregor VII. und der römischen Kirche, und schließlich die Gemächer des Papstes Nikolaus V., welche von Bernardo Rossellini erbaut wurden. Von diesen Gemächern a...