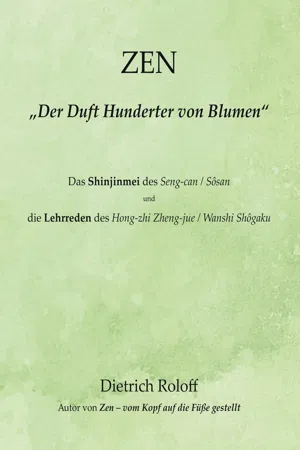![]()
II. Von Wehmut keine Spur
II.1 Xin-xin-ming / Shinjinmei (8. Jh.)
Wie weit wir uns mit alledem vom traditionellen Zen entfernt haben, mag ein ausführlicher ›Blick zurück‹ erweisen, zurück auf zwei chinesische Texte, die auch heute noch im Rinzai- und noch mehr im Sôtô-Zen eine erhebliche Rolle spielen. Das läuft weder auf einen ›Blick zurück im Zorn‹ hinaus noch auf einen ›Blick zurück in Wehmut‹, voll Trauer über unwiederbringlich Verlorenes. Vielmehr sollen diese zwei Texte, ernst genommen und in ihrer jeweiligen Eigenheit möglichst klar vor Augen gestellt, die Brisanz eines neuen ›ZEN aus MU‹ umso deutlicher hervortreten lassen.
Da ist zunächst, als eines der ältesten Zeugnisse des Tang-zeitlichen Chan, das Lehrgedicht Xin-xin-ming, Japanisch Shinjinmei, im Deutschen als die Meißelschrift vom Glauben an oder Vertrauen in den Geist bekannt. Dieses Gedicht – einem Seng-can zugeschrieben und vermutlich nach dessen Tod († 606) erst im Verlauf des 8. Jahrhunderts entstanden – ist auch schon als einer der Gründungstexte des Zen bezeichnet worden und belegt auf eine besonders eindringliche Weise, wie sich im chinesischen Chan von Anfang an wesentliche Elemente aus der Lehre vom DAO mit Inhalten des Buddha-Dharma zu einem neuen Ganzen verbunden haben. Dieser Einsicht versperren wir uns freilich von vornherein, wenn wir das chinesische Wort dao mit der ursprünglichen Bedeutung ›Weg‹, nur um es als Hinweis auf den ›Buddha-Weg‹ ausgeben zu können, nicht im Sinne des Daoismus als das DAO verstehen, wie ich es im Folgenden mit Nachdruck vertrete.
II.1 (1) Der Text
[1]
Das DAO zu erreichen [ist] nicht schwierig –
[du musst] nur das Auswählen von dir tun!
Die beiden ersten Schriftzeichen dieser einleitenden Doppelzeile, zhì dào, werden gewöhnlich als ›der höchste Weg‹ übersetzt. Doch zhì ist kein Adjektiv, das als ›der höchste‹ verstanden werden könnte, sondern unter anderem auch ein Adverb mit der Bedeutung ›äußerst‹ oder ›sehr‹. Allenfalls könnte zhì dào analog zu der Wortfügung zhì rén gleich ›vollkommener Mensch‹ als ›vollkommener Weg‹ gelesen werden. Doch vorrangig stellt zhì ein Verbum dar, das besagt: ›(einen Ort, ein Ziel) erreichen‹ oder ›(an einem Ort oder Ziel) ankommen‹ oder ›(zu ihm) hingehen‹. Dementsprechend darf dào nicht als ›Weg‹ übersetzt und dabei unausgesprochen als ›Buddha-Weg‹ verstanden werden; denn zu einem ›Weg‹ geht man nicht hin (schon dazu bedürfte es eines weiteren Weges, und so ins Unendliche fort), sondern bewegt sich auf ihm, zu welchem Ziel auch immer. Stattdessen gibt dào eben das Ziel an, das es – durch den Verzicht auf jedes Auswählen (wörtl. ›Verwerfen‹, xián) – zu erreichen gilt. Und dann bezeichnet dào eben das DAO, den Urgrund der Welt!
[2]
[Du darfst] nur nicht verabscheuen [und] lieben,
[dann] durchdringst [du es und] verstehst!
Die beiden letzten Schriftzeichen dieser Doppelzeile, míng baí, die hier als feste Redewendung verstanden und mit ›verstehen‹ übersetzt werden, können auch als ›klare Helle‹ oder ›helle Klarheit‹ gedeutet werden – doch im weiteren Verlauf des Gedichts findet sich kein Hinweis darauf, dass das DAO als ›helle Klarheit‹ umschrieben würde. Hinzukommt, dass auch die beiden ersten Schriftzeichen der zweiten Zeile, dòng-rán, ›durchschauen‹ oder ›gründlich verstehen‹ bedeuten und somit die gesamte zweite Zeile einen Hendiadyoin (ein ›Eins durch Zwei‹) darstellt, wie er schon in der ersten Doppelzeile in Gestalt des chinesischen Pendants zu ›Auswählen‹, jiăn zé, vorliegt. – Als zwangsläufig zu ergänzendes Objekt zu ›durchdringen‹ und ›verstehen‹ bietet sich nach [1] nur das DAO an; daher das auf das DAO bezügliche eingefügte Personalpronomen ›es‹.
[3]
Weichst [du auch nur] ein Hundertstel Härchen ab,
[sind] Himmel [und] Erde voneinander geschieden.
Die Metapher ›ein Hundertstel Härchen‹ (háo lí) steht für die minimalste Abweichung von dem Zustand, der mit dem Durchdringen des DAO verbunden ist: dem des Eins-Seins mit dem ›Einen‹. In das ›Eine‹ – gemeint ist das DAO – eingegangen zu sein bedeutet einen Zustand der Weltlosigkeit, insofern das ›Eine‹ inhaltsleer ist; schon die geringste Abweichung von dieser inhaltlichen Leere des ›Einen‹ versetzt uns zurück in die – aus Himmel und Erde (tiān dì) aufgespannte – Welt. – Der erste Teil dieser Doppelzeile ist sehr frei übersetzt; eine wörtliche Übersetzung der vier chinesischen Schriftzeichen háo lí yŏu chā müsste lauten: ›Ein Hundertstel Härchen hat/enthält einen Unterschied / ein Abweichen.‹
[4]
Willst [du] erreichen, [dass es] vor [dir] erscheint,
[dann] halte nicht fest an ›Günstig‹ und ›Ungünstig‹!
Auch in dieser Doppelzeile ist – abermals – das DAO zu ergänzen, diesmal als das logische Subjekt zu ›vor [jemandem] erscheinen‹; es verbirgt sich in dem von mir eingefügten ›es‹. Insgesamt stellt diese Doppelzeile mit ihrem Verbot einer dualistischen Antithese wie ›Günstig‹ und ›Ungünstig‹ eine inhaltliche Wiederholung der zweiten Doppelzeile dar, in der – anlässlich eines gleichbedeutenden Verbots von ›Lieben‹ und ›Verabscheuen‹ – erstmals das DAO, dort als Objekt, zu ergänzen war.
[5]
[Wenn] Sich-Auflehnen und Willfahren miteinander kämpfen,
[so] ist das eine Krankheit des Geistes.
Und noch einmal eine gleichgerichtete Antithese, die von ›Sich auflehnen‹ und ›Willfahren‹. Sie läuft darauf hinaus, dass wir uns, unter Verwendung dualistischer Kategorien wie ›Günstig‹ und ›Ungünstig‹, gewöhnlich eines unterscheidenden und bewertenden Denkens bedienen, das hier, in der zweiten Zeile, völlig überraschend zu einer Krankheit des Geistes (xīn bìng) erklärt wird. Damit wird indirekt das Nicht-Denken, in der folgenden Doppelzeile als Stillstand des Denkens umschrieben, zur Gesundheit des Geistes erklärt, was seinerseits aus dem Geist einen Nicht-Geist macht, einen Geist, der sich darin vollendet, dass er nicht mehr denkt und sich somit – letztlich – als Nicht-Geist erweist. – Im Übrigen erscheint mit dem Geist (xīn) in dem bis hierher eindeutig daoistisch gefärbten Text zum ersten Mal ein Chan-buddhistischer Terminus.
[6]
[Wenn du] den Sinn des Geheimnisses nicht verstehst,
mühst [du dich] vergeblich um Stillstand des Denkens.
Mit dem Geheimnis (xuán) ist wiederum das DAO gemeint, das eben deshalb geheimnisvoll ist, weil selbst derjenige, der das DAO durchdringt und versteht [2], über das, was er da versteht, nichts aussagen kann. Gleichwohl hat dieses Geheimnis seinen Sinn (zhĭ), der darin besteht, dass wir in ihm zur Ruhe kommen, in einem Zustand unbedingter Fraglosigkeit. – Der Terminus ›Stillstand des Denkens‹ (nièn jìng) verweist auf das Nicht-Denken, das Erlöschen allen Denkens im Eins-Sein mit dem Einen, dem DAO.
[7]
[Das DAO ist] vollständig wie die ›Große Leere‹,
[denn es ist] ohne ›Zuwenig‹ [und] ohne ›Zuviel‹.
Wenn im Voraufgegangenen das Geheimnisvolle, in dem das Denken zum Stillstand kommt, als das DAO zu verstehen ist, dann muss es auch hier als logisches Subjekt zu der verkürzten Aussage: vollständig wie die ›Große Leere‹ (yuán dóng taì-xū) ergänzt werden. Damit aber wird hier das DAO mit dem gleichgesetzt, was im Mahâyâna als der Grund der Welt postuliert wird, eben die ›Große Leere‹ (taì-xū). – Wenn in der zweiten Zeile die Vollständigkeit des mit der Leere identischen DAO damit begründet wird, dass es ohne Zuwenig (wú qiàn) und ohne Zuviel (wú yú) ist, so darf darin eine Anspielung auf das Herz-Sûtra gesehen werden, wo es von eben der ›Leere‹ heißt, dass es dort kein Zunehmen und kein Abnehmen gibt.
[8]
Weil [du] erwählst [und] verwirfst,
deshalb [erreichst du] nicht die ›Soheit‹!
Infolge (so die wörtliche Übersetzung der beiden ersten Schriftzeichen liáng-yóu) der Krankheit des Geistes, nämlich zu erwählen und zu verwerfen, begeben wir uns selbst der Möglichkeit, zur ›Soheit‹ (rú) vorzudringen, in jene tiefste und letzte Seins-Schicht, in der die Dinge – nach dem Verständnis des Mahâyâna – so sind, wie sie sind, nämlich leer – wir bleiben von der rettenden ›Soheit‹ ausgesperrt: bù rú.
[9]
Weder vertreibe das Gefüge des Seins,
noch verharre [im] Erdulden der ›Leere‹.
Was wie eine Antithese aussieht (›weder – noch‹), ist tatsächlich nur ein in beiden Teilen gleich gerichteter Imperativ: sich nicht der ›Leere‹ zu überlassen und damit auch nicht den Gegenpol der ›Leere‹, das Gefüge des Seins, die geradezu sprichwörtlichen Zehntausend Dinge, von sich zu weisen. Dieselbe Doppelzeile kann aber auch als die paradoxe Aufforderung gelesen werden: sich – einerseits – der Leere und damit der ›Soheit‹ zuzuwenden, dabei jedoch – andererseits – auch den Zehntausend Dingen ihr Recht zukommen zu lassen.
[10]
Das Eine erzeugt gewöhnliche Gedanken,
[es] vernichtet ganz und gar [dein] Selbst.
Diese Doppelzeile ist wieder ganz vom Geist des Daoismus erfüllt: Das ›Eine‹ ist geradezu ein Terminus technicus in der Lehre vom DAO – man vergleiche den Text 39 des Dao De Jing: Der Himmel erlangt das Eine und wird dadurch klar und rein; die Erde erlangt das Eine und wird dadurch friedlich; die Gottheit erlangt das Eine und wird dadurch göttlich; das Tal erlangt das Eine und wird dadurch voll; die Zehntausend Dinge erlangen das Eine und dadurch das Leben. Ebenfalls durch und durch daoistisch ist der Gedanke, dass das Eine oder DAO demjenigen, der darin eintaucht, nur gewöhnliche, u.d.h. dem Alltag angemessene selbstverständliche Gedanken eingibt und ihn daran hindert, sein Selbst durch kühne, extravagante Vorsätze aufzublähen. So verhindert das DAO ein stolzerfülltes, nur um sich selbst kreisendes Selbst.
[11]
Hörst [du] auf, tätig zu sein, kehrst [du] zurück [in den] samâdhi;
hörst [du] auf, verändern [zu wollen, ist das] überall hindringende Tätigkeit.
Aufhören, tätig zu sein (zhĭ dòng) entspricht der daoistischen Formel wú-weí, die das Nicht-Handeln des Weisen bezeichnet; und habituellem Nicht-Handeln wird hier der Charakter von samâdhi, einem Leben aus Versenkung, zugesprochen. Auf gleiche Weise entspricht die überall hindringende Tätigkeit (mí dòng) der daoistischen Formel ›nichts bleibt ungetan‹ (wú bù weí): Das DAO handelt nicht – und nichts bleibt ungetan (dào wú weí ér wú bù weí – Dao De Jing, Text 37).
[12]
Versperre nur die Seite der Zweiheit,
sei lieber vertraut mit dem Samen des Einen!
[13]
[Hast du] den Samen des Einen nicht verstanden,
verliert die Seite der Zweiheit [ihr] Verdienst.
Die Doppelzeilen [12] und [13] bilden eine inhaltliche Einheit: Sie schreiben dem Einen, also dem DAO, die Eigenschaft zu, Samen zu sein. Damit kann zweierlei gemeint sein: Das DAO ist der Samen, dem die Zehntausend Dinge entspringen, und zum anderen stellt es den Samen für die Lebensführung dessen dar, das aus dem DAO lebt. Hier aber geht es nur um Letzteres. Die Aufforderung an den Leser lautet dahin, ein Leben im Gefolge des Einen höher zu schätzen als das bloße Verharren in den Dualismen der Welt, aber andererseits – analog zu dem Imperativ: Die Seele anleiten und das Eine festhalten (Dao De Jing, Text 10) – aus dem Einen heraus in die dualistische Welt der Zehntausend Dinge einzutreten und diese ihren Beitrag zu einem gelingenden Dasein leisten zu lassen.
[14]
Verbannst [du] das Sein, ist kein Sein vorhanden;
fügst [du dich] der ›Leere‹, handelst [du] der ›Leere‹ zuwider.
Die A...