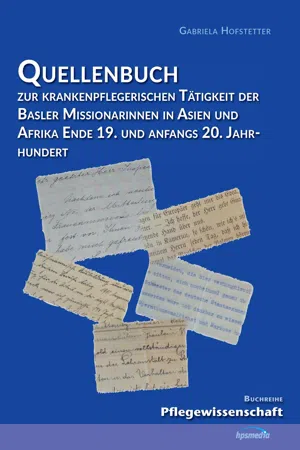![]()
QUELLENTEIL
- Für und wider die Frauenmission
- Protokollsitzung des Komites vom Mittwoch, 17. Januar 1894
- Königl. Württembg. Landes-Hebammenschule
- Fräulein L. Müller, Kalikut, den 25. März 1903
- Jahresbericht von Sophie Hertlein, Februar 1907
- Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat
- An das Missionskomitee in Basel, September 1908
- Fräulein Adèle Verdan, Bonaku, den 3. April 1909
- Mohammedanische Dankbarkeit
- Fräulein Marie Geiger, Kalikut, 21. Oktober 1909
- An das Missionskomitee in Basel, Dezember 1909
- Aus dem Bericht von Frl. E. Lempp in Bettigeri (Indien)
- Brief von Fräulein Emma Lempp aus Bettigeri, 8. Februar 1911
- Zeugnis der königl. Württembergischen Landeshebammenschule
- Goldküste
- Brief von Fräulein Adele Verdan, Aburi, den 26. März 1912
- Brief von Mina Bahlinger an den Missionsinspektor
- Blick in ein afrikanisches Missionsspital
- Die ärztliche Mission in Bali
- Fräulein Mina Föll, Bonaku, 16. Juli 1913
- Fräulein Mina Bahlinger, Bettigeri, den 15. Januar 1914
- Lebenslauf von Elisabeth Niederhäuser
- Die Arbeit der ärztlichen Missionsschwester und ihrer Gehilfinnen in Indien
- Verlobungserlaubnis
- Instruktionen für die zum zweitenmal aufs Missionsfeld aber zum erstenmal nach China ausreisende Schwester Anna Hetzler, Basel, den 23. Januar 1924
- Gesuch zur Heimkehr
- Auszug aus einem Brief von Schwester Christina Bauer
- Nachruf von Elisabeth Weinbrenner, geb. Niederhäuser
- Das missionsärztliche Personal
- Die Schwesternausbildung
- Arbeitszeugnis
- Als die Boten, die Frieden verkündigen
- Brief aus dem Missionsspital in Calicut an den Direktor in Basel, 11. August 1930
- Brief aus dem Missionsspital in Calicut an den Direktor in Basel, 8. Juni 1930
- Brief aus dem Missionsspital in Calicut an den Direktor in Basel, 29. Juni 1931
- Brief aus Koeala Kapoeas, 13. Januar 1932
- Eine Munschi-Stunde
- An das Borneo-Inspektorat
- Vom Missions=Spital in Agogo (Goldküste)
- Not und Hilfe bei unsern schwarzen Kranken
- Heidnischer Aberglaube
- Diakonissendienst in Indien
- Ein Chinesenkind kommt zur Welt
- Einiges über die Zusammenarbeit mit inländischem Personal
- Schwesternhilfe auf engstem Raum
- Die Ausbildung von eingeborenen Krankenpflegern und –pflegerinnen
![]()
1. FÜR UND WIDER DIE FRAUENMISSION
(Evangelisches Missionsmagazin, 1884, S. 184-185)
„Sollte man aber etwa daran denken, eine zukünftige Zenanamissionsjungfrau in einem Missionsspital zu beschäftigen, so würde dies wiederum mehr zu einer Umgehung als zur Erreichung der Heidenfrauen führen. Ich will nicht davon reden, dass man in den ca. 12 Spitälern, die jetzt schon in Malabar existieren, fast nur männliche Krankenpfleger und Diener anstellt und anstellen kann. Auch in einem Missionsspital, wo männliche und weibliche Kranke sind, gienge die Anstellung von europäischen Jungfrauen absolut (?) nicht an. Man müsste ein Spital speziell für Frauen einrichten und NB. in jedem Fall die Medizin, Kost usw., sowie jetzt die Regierung auch thut, gratis verabreichen, um überhaupt Patienten zu kriegen. Allein, weshalb soll man unseren weiblichen Gemeindegliedern die Gelegenheit abschneiden, sich und den Christen unter einander auch durch Krankenpflege Handreichung zu thun! Sobald es die Europäer thun, halten sich die schwarzen Christen erfahrungsgemäss dieser Pflicht für entbunden.
Ein Missionsspital aber, würde eben ohne allen Zweifel eine neue Auflage der Gemeindeunterstützung und Armenversorgung werden und vielleicht auch eine Taufbewerbermaschine für das zweite Jahrhundert unsrer indischen Mission. Da würde es eben viele kranke oder krank sein wollende Gemeindeglieder oder Taufbewerber geben, welche in Krankenhaus und Armenhaus nebst Medizin auch Nahrung, Kleidung, Obdach und ein bequemes Leben von der Mission erhalten wollen. Man würde wohl dieselben Erfahrungen machen, die man auch in der Missionsökonomie gemacht hat. Dass sonach ein deutsches Fräulein sich bei solcher Art von Zenanamissionsarbeit nicht befriedigt fühlen könnte und sich möglichst bald hinaussehnen würde, bedarf wohl keines Beweises.“
![]()
2. PROTOKOLLSITZUNG DES KOMITES VOM MITTWOCH, 17. JANUAR 1894
(Archiv Basler Mission: Komiteeprotokoll vom 17. Januar 1894, § 35)
Frl. Vogel Stuttgart 12. I; vgl. § 3 Bruder Schulers Braut spricht selber die Bereitwilligkeit aus, einen geburtshilflichen Kurs mitzumachen, was das Komite begrüsst.
Bei diesem Anlass werden die prinzipiellen Gedanken über die Teilnahme von Bräuten an solche Kurse ausgetauscht, und Inspektor beantragt, den Entwurf eines zu druckenden Schriftstücks auszuarbeiten, worin die Stellung des Komites zu den geburtshilflichen Kursen wiederlegt ist. Es wird darin auszuprobieren sein, 1) wie wichtig es ist, dass Missionsfrauen sowohl den europäischen Schwestern als auch den eingeborenen Frauen bei Geburten die oft für Leben oder Tod entscheidende Hilfe leisten können; 2) dass aber, wie das Komite völlig ausklemmt, nicht jedes Mädchen die richtige körperliche Kraft und innere Freudigkeit für diese Sache besitze und es daher jeder Braut freistehen solle, sich die allerdings sehr wünschenswerte Hebammenausbildung zu erwerben oder nicht.
![]()
3. KÖNIGL. WÜRTTEMBG. LANDES-HEBAMMEN-SCHULE
HEBAMMENZEUGNIS VON FRÄULEIN MATHILDE KALMBACH, 31. JANUAR 1898
(Archiv Basler Mission: Schwesternverzeichnis Nr. 46/Mathilde Kalmbach)
Königl. Württembg. Landes-Hebammenschule
Nachdem die Hebammenschülerin Mathilde Kalmbach von Überberg, o/a Nagold einen vollständigen Unterrichtskurs in der Hebammenkunst an der Lehranstalt zu Stuttgart durchgemacht hat u. auch über die Pflichten u. das Verhalten der Hebammen in ihrem Dienste gehörig belehrt worden ist, hat sie bei der am 27. u. 28. Januar bestandenen Prüfung
im theoretischen Teil: sehr gute Kenntnisse
im praktischen Teil: sehr gute Kenntnisse gezeigt,
im Betragen das Zeugnis sehr gut
im Fleiss das Zeugnis sehr gut erhalten.
Derselben wird hiernach das Zeugnis I. Klasse erteilt u. sie zur Übung der Hebammenkunst in ihrem ganzen Umfang ermächtigt, ihr die Erlaubnis erteilt, auf ärztliche Verordnung beim weiblichen Geschlecht zu schröpfen.
Stuttgart, d. 31. Januar 1898
Mitglied des Medizinischen Kollegiums: — Direktor:
gez. Kocher — gez. Dr. Walcher
![]()
4. FRÄULEIN L. MÜLLER, KALIKUT, DEN 25. MÄRZ 1903
(Archiv Basler Mission: Y. 5: Mitteilungen aus der Basler Frauenmission, Nr. 4, Juli 1903, S. 60-62)
Habe ich morgens 9 Uhr meinen Munschi absolviert, so greife ich flugs nach meinem Sonnenhut und gehe hinüber in unsern Spital. Die Arbeit ist schon in vollem Gange, und es ist ein buntes Bild, das sich mir bietet. Die Veranda ist voll von Männern, Frauen und Kindern jeden Alters, die alle auf Linderung ihrer Schmerzen und Heilung ihrer Gebrechen warten. Aber es kann eben nur eins ums andere untersucht und beraten werden, und immer strömen wieder neue Leute herein, so dass es für manche eine lange Wartezeit gibt. Aber diese Wartezeit sollte den Leutchen nicht gar so lästig sein, steht doch den Männern, unser lieber alter Katechist, der sie mit ganzem Eifer und aller Freundlichkeit einladet, zum Wunderarzt Jesus zu kommen, um bei ihm Heilung und Frieden für Leib und Seele zu finden. Zu den Frauen hat sich unsere bewährte Bibelfrau Maria gesetzt. Sie liest ihnen eine biblische Geschichte vor, die sie nachher mit beredeter Zunge auslegt.
Ich lasse meine Augen über die bunte Gesellschaft schweifen, um zu sehen, wo meine Hilfe am nötigsten ist. Gerade vor dem Eingang ins Konsultationszimmer ist von aussen her eine Tragbahre angelehnt. In dieser haben vier Männer ein etwa 6jähriges Büblein gebracht. Als sie es das erste Mal brachten, war sein Körperchen dick mit Wasser angefüllt, die Beine fest geschwollen, die Arme hingegen wie ein paar dünne Stecken an den unförmigen Körper, und das Gesichtchen sah so elend aus. Das Kind wurde jeden zweiten Tag gebracht, und nun hat sich das Wasser fast verloren, die Beine sind lange nicht mehr so geschwollen, und der kleine Bursche sieht viel heller aus seinen Augen. Die Leute sind so dankbar. Einmal brachten sie einen Korb Gemüse, und neulich kam der Vater mit einem lebendig eingefangenen Hasen an einer Schnur.
In dem kleinen Raum, in dem ich mit meiner Gehilfin die Frauen und Kinder verbinde, haben sich auch schon die Stammgäste eingefunden. Am Boden sitzt ein altes Mapla = Mütterchen und lächelt mir freundlich entgegen. Sie kommt schon bald zwei Monate Tag für Tag zum Verbinden. Anfangs hatte sie einen furchtbar schlimmen Finger. Auf irgend eine Weise ist ihr der halbe Finger abhanden gekommen. Die Wundfläche war in einem schauderhaften Zustand und verbreitete einen Geruch, der einem beinahe die Fassung raubte. Seitdem kam sie nun treulich Tag für Tag und hielt die Schmerzen, die man ihr hie und da verursachen musste, tapfer aus, so dass ihr Finger jetzt schön im heilen begriffen ist.
Dort in der Ecke steht mein besonderer Freund, ein kleiner Mapla = Bursche. Er guckt mit seinen schelmischen Augen zu mir herüber, ob die Reihe noch nicht an ihn komme. Eigentlich verdient er meine Zufriedenheit erst seit kurzem, denn bis vor wenigen Tagen schrie er aus vollem Halse, sobald ich anfing seinen Verband loszumachen. Er hatte einen schlimmen Abszess an der Hand. Und da half kein freundliches Wort und kein drohendes Gesicht, er schrie eben bis der Verband fertig war. Seit einigen Tagen hat sich nun seine Hand gebessert, und er scheint es auf einmal unter seiner Würde zu halten, zu schreien, und erscheint er jetzt sehr selbstständig allein, während ihn vorher seine Mutter begleitete.
Dann sind auch noch zwei ganz Kleine da. Das eine hat einen Abszess am Hinterkopf, das andere einen unter dem Arm. Da gibt es natürlich herzzerreissendes Geschrei und Gestrampel, bis der Verband sitzt; wissen doch die kleinen Patienten auch gar nicht, warum die bösen Leute sie so plagen. Doch bald sind sie getröstet und werden von ihren zärtlichen Müttern geliebkost und heimgetragen.
Nun ist mein kleines Zimmer auf einmal leer, aber draussen auf der Veranda sind noch viele. Dort steht ein 10-jähriger Bub mit seiner Mutter. Er hat sich die Schulter ausgerenkt, und ausserdem hat er noch ein Geschwür unter dem Arm. Da ist ein anderer kleiner Junge, dem beim Spielen ein Auge schwer verletzt worden ist. Er ist ein tapferer kleiner Bursche und zuckt nie beim Verbinden. Ja wenn man an ihm vorbeigeht, strahlt er einen mit dem unverbundenen Auge glücklich an. Das arme Kind weiss nicht, dass das eine Auge wahrscheinlich verloren ist.
Mein kleiner Musikmeister ist auch da und thront auf Grossmutters Hüfte. Er ist ein herziger, zehn Monate alter Junge, der wegen seiner krummen Füsschen wohl zwei Monate im Spital war. Da hat er dann gar oft meiner Gehilfin, die im Spital ihr Zimmer hat, ein langes Schlaflied gesungen, wofür sie ihm jenen Schmeichelnamen gab. Und der Musikmeister ist er geblieben. Aber trotz allem Schreien ist er mein erkorener Liebling. Wenn einen der kleine schwarze Lockenkopf mit den schwarzen Augen so herzig ansieht, so muss man ihn lieb haben. Er war ja auch lange bei uns, bis seine operierten Füsschen heil waren. Die Grossmutter bringt ihn noch alle paar Tage, denn der kleine Mann hat Husten und Fieber. Überhaupt wird er, seit er daheim ist, immer elender, dass man ihn am Ende wieder ins Spital nehmen muss.
Wenn ich zwischen dem Verbinden Zeit habe, so gehe ich hinüber in unser Frauenspital, Bethlehem, um die Frauen fertig zu machen und meine kleinen braunen Kindchen zu baden. Es sind selten mehr als zwei Frauen auf einmal da.
Gegen ½12 Uhr lichtet sich allmählich das Getriebe auf der Veranda. Doch was kommt denn dort noch? Am Ende ein Schwerkranker? Was wollen wohl all die vielen Leute? Zwölf erwachsene Männer bringen einen Knaben, der aber nicht sterbenskrank ist, sondern stramm an seines Vaters Hand einhergeht. Er hat nur einen Polypen in der Nase, der bald entfernt ist, und fröhlich zieht er mit seiner Eskorte wieder ab.
Jetzt ist die Veranda ganz leer, und wir verlassen den Schauplatz unserer Morgenarbeit und gehen zum Frühstück. Nachmittags von 3 Uhr an ist das Spital wieder offen für Hilfsuchende von auswärts, doch kommen nicht so viele wie am Morgen. Die Zahl der täglichen Patienten schwankt zwischen 100 und 150.
Es ist eine herzerfreuende Arbeit und trägt manch freundliches Salim ein. Doch ist das, will’s Gott, nicht das einzige Resultat unserer Arbeit, sondern dass alle die vielen, die hilfsuchend hierher kommen, eine Ahnung bekommen und ein Verlangen nach dem Herrn, der unser Licht und Leben, unsere Freude und Trost, unser Erlöser, unser Ein und Alles ist. Das ist die Frucht, die wir von unserer Arbeit wünschen und erbitten.
![]()
5. JAHRESBERICHT VON SOPHIE HERTLEIN, ABURI, 6. FEBRUAR 1907
(Archiv Basler Mission: Jahresbericht von Sophie Hertlein, Aburi, den 6. Februar 1907, D-1,86-12)
Bald bin ich ein und ein halbes Jahr hier auf der Goldküste in meiner Arbeit, über die ich in den folgenden Zeilen einiges berichten will.
Am ersten Oktober 1905 kam ich nach glücklicher Seereise und nachdem ich mich einige Tage in Akra, Christiansborg und Abokobi aufgehalten hatte, an meinem Bestimmungsort Aburi an, wo ich mit viel Liebe aufgenommen und von Herrn Dr. Fisch in meine Arbeit eingeführt wurde, so dass das Heimweh gar nicht aufkommen konnte. An Arbeit fehlt es nicht und damit auch nicht an Abwechslung. Ich half Dr. Fisch bei der Behandlung der Patienten, nahm daneben Sprachstunden und hatte von Zeit zu Zeit auf auswärtige Stationen zu gehen, wo meine Hilfe nötig war.
Kaum war ich drei Wochen im Land, so wurde ich schon nach Ada gerufen. Dies war meine erste grössere Reise in Afrika; es war mir deshalb alles neu und interessant. Von Aburi reiste ich in der Hängematte über Akropong nach Akuse und von dort im Dampfboot den Volta hinab nach Ada. Hier blieb ich drei Wochen, dann trat ich die Rückreise an, besuchte unterwegs noch die Stationen Bana und Odumase und kam über Akropong wieder nach Aburi zurück.
In Aburi lebte ich mich aufs Neue in meine Arbeit ein. Wir bekamen in dieser Zeit nacheinander drei Angeschossene, die alle schwer verletzt waren. Einem war ein Arm zerschossen und dabei hatte er noch ein grosses Stück Haut daran eingebüsst. Ein junger Mensch verlor durch eigene Unvorsichtigkeit eine Hand und ein Auge, auch sonst war er noch schrecklich zugerichtet, doch heilte auch bei ihm alles gut und in kurzer Zeit. Der dritte war ein alter Mann, dem durch einen Schuss das eine Bein zerschmettert worden war. Die Leute schmierten Landesmedizin auf die Wunde und infizierten sie so, dass sie sich immer mehr verschlimmerte. Schliesslich musste Herr Doktor den Angehörigen des Mannes erklären, dass nur noch durch eine Amputation zu hoffen sei, das Leben des Verletzten zu erhalten, doch davon wollten sie nichts wissen und nahmen den todkranken Man nach Hause. So erleben wir manche Freude, aber auch manches Traurige in unserer Arbeit.
Im Februar musste ich zu einer Pflege nach Akra gehen. Um mich nun mit allen Genüssen der Hängemattreise bekannt zu machen, liessen mich diesmal die Träger, als es einen Berg hinunterging, samt der Hängematte fallen. Dies war bis jetzt meine letzte Hängemattreise, ich lernte Radfahren, aber nicht, um nicht wieder hingeworfen zu werden – denn das kann einem mit dem Rad auch passieren, ohne Hilfe von Trägern -, sondern weil es hier so schwer ist, Träger zu bekommen, hauptsächlich aber; weil man mit dem Rad viel schneller an Ort und Stelle ist, als in der Hängematte, und das ist für mich sehr wichtig. Nach dreiwöchentlichem Aufenthalt in Akra konnte ich meine Pfleglinge wieder verlassen und nach Aburi zurückkehren.
Bald nach meiner Ankunft in Aburi wurde Herr Dr. Fisch zu einer sehr kranken Frau in dem Dörfchen Asantema, nicht ganz eine Stunde von hier entfernt, gerufen, die operiert werden musste. Ich begleitete ihn. Der Operationssaal war ein enger, schmutziger Raum in einer Negerhütte. Die Operation ging gut vorüber, und ich fand die Frau sechs Tage nachher bei einem Besuch schon wieder auf.
In Aburi war diesmal...