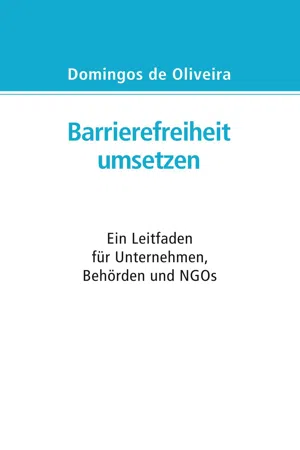
eBook - ePub
Barrierefreiheit umsetzen
Ein Leitfaden für Behörden, Unternehmen und NGOs
- 112 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Barrierefreiheit ist ein komplexes Thema. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie die Zugänglichkeit für behinderte Menschen in die Praxis umsetzen. Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Angebot oder gleich Ihre gesamte Organisation barrierefrei umgestalten wollen. In diesem Buch erfahren Sie, was Sie in den einzelnen Phasen des Projektes beachten sollten. Die dargestellten Konzepte sind problemlos auf Ihre speziellen Anforderungen anwendbar.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Barrierefreiheit umsetzen von Domingos de Oliveira im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Verwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil I
Behinderung und Barrierefreiheit
Im ersten Abschnitt dieses Themenbereichs geht es um die Frage, warum Inklusion und Barrierefreiheit heute so stark öffentlich diskutiert werden. Diese Informationen sind zum Verständnis der inhaltlichen Kapitel sinnvoll, aber nicht notwendig und können übersprungen werden. Im zweiten Abschnitt geht es um die theoretischen und praktischen Grundlagen der Barrierefreiheit und im dritten Abschnitt möchte ich Ihnen zeigen, wie vielfältig die Barrieren sein können.
Das Verständnis von Behinderung
Die Wahrnehmung von Behinderung hat sich in den letzten Jahren stetig gewandelt. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, der bereits einige Jahrzehnte andauert und noch weitere Jahrzehnte andauern wird. In diesem Abschnitt möchte ich zeigen, wie und warum sich die Vorstellungen zu Behinderung gewandelt haben.
Der moderne Begriff von Behinderung
Das Bild von Behinderung hat sich im Laufe der Zeit stetig verändert. Bis zu den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurden behinderte Menschen vor allem als Belastung betrachtet. Sie wurden in ihren Familien oder in speziellen Einrichtungen untergebracht, wo sie vor der Außenwelt und die Außenwelt vor ihnen geschützt wurde. Zumindest war das die Absicht hinter diesen Maßnahmen.
Das änderte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Gesellschaft begann, einige Teilgruppen von Behinderten als eingeschränkt arbeits- und leistungsfähig zu betrachten. Im ganzen Land entstanden spezielle Einrichtungen wie Sonderschulen, Ausbildungs- und Berufsförderungsstätten sowie Behindertenwerkstätten. In diesem Zusammenhang wurde von Integration gesprochen. Behinderte Menschen sollten so darauf vorbereitet werden, in die bestehende Gesellschaft integriert werden zu können. Wer hingegen nicht als integrationsfähig galt, sollte durch Werkstätten oder Tagesförderstätten zumindest die Möglichkeit zu einem würdigen Leben erhalten. Zu den wenig bis kaum integrierbaren Personen wurden vor allem lernbehinderte Menschen gezählt.
Wir befinden uns aktuell in einer Übergangsphase von der Integration zur Inklusion. Heute gilt eine möglichst geringe Trennung von behinderten und nicht behinderten Menschen als erstrebenswert. Behinderte Menschen müssen sich nicht vollständig an die Gesellschaft anpassen. Vielmehr findet ein Prozess statt: Behinderte Menschen gestalten die Gesellschaft gemeinsam mit nicht behinderten Menschen, um eine für alle Menschen geeignete und lebenswerte Gesellschaft zu erschaffen.
Es gibt, angelehnt an diese Weltbilder, drei Modelle von Behinderung und Erkrankung.
- Das älteste Modell ist rein biologisch orientiert: Der Mensch wird nach seiner Leistungsfähigkeit gemessen. Da es zur Zeit seiner Entstehung nur einfache Hilfsmittel und kaum Barrierefreiheit gab, war es den behinderten Menschen kaum möglich, an der Gesellschaft teilzuhaben. Es lag im Wesentlichen beim Individuum, seine Einschränkungen auszugleichen. Dieses Modell war lange Zeit vorherrschend und ist es in vielen Weltregionen nach wie vor.
- Das bio-soziale Modell geht davon aus, dass die Gesellschaft dafür verantwortlich ist, dass Barrieren entstehen. Diese Sichtweise drückt sich in dem Slogan »Ich bin nicht behindert, die Gesellschaft behindert mich« aus. Dieses Modell ist aktuell beliebt bei großen Teilen der Behindertenbewegung. Doch schlägt dieses Modell, im Vergleich mit dem rein biologischen Modell, stark ins andere Extrem aus. Das rein biologische Modell bürdet dem Individuum sämtliche Verantwortung auf wohingegen das bio-soziale Modell der Gesellschaft die gesamte Verantwortung aufbürdet, während das Individuum als ein handlungsunfähiges Objekt der Gesellschaft erscheint.
- Das sich heute allmählich etablierende Modell ist das bio-psycho-soziale Modell. Es geht von einer Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft aus. Der Mensch hat Einschränkungen und die Gesellschaft schafft zusätzliche Barrieren. Durch spezifische Maßnahmen können die Einschränkungen ausgeglichen und die Barrieren reduziert werden. Behinderte Menschen werden unterstützt und nicht allein gelassen, behalten jedoch den Einfluss auf ihr Schicksal.
Vor allem bei den jüngeren behinderten Menschen werden sich voraussichtlich das dritte Modell und das entsprechende Selbstbild durchsetzen. Sie werden selbstverständlich davon ausgehen, dass sie Teil der Gesellschaft sind und diese mitgestalten wollen. Sie werden sich jedoch nicht als Opfer der Gesellschaft betrachten, da ihr Selbstverständnis als handlungsfähiges Subjekt das nicht widerspiegelt.
Die Konvention über die Rechte behinderter Menschen
Wie bei vielen Minderheiten entwickelte sich auch bei behinderten Menschen der Wunsch, selbstbestimmter zu sein und die eigenen Interessen selbst zu vertreten. Lange Zeit war es üblich, dass die Interessen behinderter Menschen durch Nichtbehinderte vertreten wurden. Obwohl das teilweise heute noch so ist, entspricht dies nicht mehr dem Selbstverständnis der neuen sozialen Bewegungen. Lebendiger Ausdruck dieser Veränderungen ist die Konvention über die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen (UN-BRK).
Mit der UN-BRK sind Konzepte, wie der ressourcenorientierte Ansatz, eingeführt worden. Dieser Ansatz ist stärkenorientiert. Man betrachtet die Fähigkeiten des Einzelnen und nicht seine Schwächen. Tatsächlich ist das vielleicht der revolutionärste Ansatz der UN-BRK. In allen Bereichen unserer Gesellschaft zeigt sich die Fixierung auf mögliche Probleme und Schwächen. Denken Sie einmal an Bewerbungsverfahren. Die Verfahren zielen, vor allem in der Sichtungsphase, darauf ab, die Schwächen von Bewerbern zu ermitteln. Eine einzige dieser Schwächen, wie z. B. eine schlechte Schulnote, reicht bereits aus, um den Bewerber auszusortieren.
Inklusion und Barrierefreiheit werden häufig in einem Atemzug genannt. Es sind aber verschiedene Konzepte. Inklusion heißt, dass behinderte und nicht behinderte Menschen die Gesellschaft gemeinsam gestalten und gleichberechtigt miteinander leben. Barrierefreiheit ist die Voraussetzung für gelungene Inklusion. Aber sie ist bei Weitem nicht die einzige. Barrierefreiheit ist also ein Unterthema oder Querschnittsthema der Inklusion.
Wenn Sie Inklusion in Ihrer Organisation umsetzen möchten, ist der Aktionsplan ein sinnvolles Instrument. In Aktionsplänen entwickeln Sie Strategien, um Ihre Organisation umfassend inklusiv zu gestalten. Wie auch die Barrierefreiheit ist dies ein langfristiges Projekt. Auch einige Privatunternehmen, wie z. B. das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, haben sich der Inklusion verpflichtet.
Was heißt Barrierefreiheit?
Ebenso wie das Verständnis von Behinderung hat sich auch der Blick auf die Barrierefreiheit gewandelt. In diesem Abschnitt werbe ich für ein breites und universelles Verständnis.
Der Begriff Barrierefreiheit
Die Begriffe Barrierefreiheit, Barrierearmut und Zugänglichkeit werden in diesem Leitfaden synonym verstanden.
Unter Experten und Betroffenen wird diskutiert, ob Barrierefreiheit überhaupt ein angemessener Begriff dafür ist, was wir erreichen wollen und können. Ich halte Barrierefreiheit generell nicht für den optimalen Begriff für das, worum es in diesen Leitfaden hauptsächlich geht. Zum einen suggeriert Barrierefreiheit einen Zustand, der, wie wir später sehen werden, nicht erreichbar ist. Zum anderen setzt er sich aus dem negativ besetzten Begriff »Barriere« und dem positiv besetzten Begriff »Freiheit« zusammen. Der Begriff beschreibt mit dem Wort Barriere etwas zu Vermeidendes anstelle eines positiven Zieles. Ein positiv besetzter Begriff wie »Zugänglichkeit« passt hier besser. Zugänglichkeit ist außerdem nicht so stark auf den Bereich Behinderung fokussiert, sondern schließt auch weitere Einschränkungen ein. Der Begriff Barrierearmut besteht aus gleich zwei negativ besetzten Begriffen. Er ist zwar ein wenig schärfer und vielleicht auch ehrlicher als »Barrierefreiheit«, dennoch ist er zu unspezifisch, um wesentlich aussagekräftiger zu sein. Ich werde später zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, von Barrierefreiheit an sich zu sprechen. Barrierefreiheit steht immer in Bezug entweder zu einer Personengruppe oder zu einem Sachverhalt. Da sich aber der Begriff Barrierefreiheit etabliert hat, werde ich diesen Begriff trotz seiner Schwächen verwenden. So viel sei an dieser Stelle verraten: Die Aussage, etwas sei »barrierefrei« oder »nicht barrierefrei« ist in dieser allgemeinen Form immer falsch.
Der Begriff Barrierefreiheit wird in diesem Leitfaden im weitesten Sinne verstanden. Es geht um alle Menschen, die wegen körperlicher, geistiger oder psychischer Probleme Gegenstände, Oberflächen oder Informationen nicht uneingeschränkt nutzen können. Das schließt den Blinden ein, der problemlos den Mount Everest besteigt. Oder den Senioren, der einen Marathon läuft. Oder den psychisch Erkrankten, der ein herausragender Maler ist. Jeder Nutzer kann in bestimmten Bereichen auf Barrieren stoßen. Das ist unabhängig davon, wie selbstständig er in anderen Bereichen ist.
Psychische und chronische Erkrankungen können ebenso einschränken wie körperliche oder kognitive Behinderungen. Diese Gruppen bezüglich der Barrierefreiheit zu unterscheiden ist deshalb nicht sinnvoll.
Barrierefreiheit ist ein Prozess
Der Begriff Barrierefreiheit suggeriert einen Zustand. In diesem Zustand kommen alle Personen wunderbar zurecht. Ein solcher Zustand ist aber nicht erreichbar. Die Art und Anzahl der Einschränkungen sind so vielfältig, dass wir in keinem Fall alle denkbaren Szenarien abdecken können. Es gibt zum Beispiel Menschen, die nur im Liegerollstuhl mobil sind. In einem Krankenhaus ist das kein Problem. Aber schon in einer normalen Wohnung ist das praktisch nicht machbar und ein Bürogebäude müsste umfassend umgebaut werden, damit der Betroffene mobil sein könnte.
Teilweise widersprechen sich die Anforderungen auch. Sehbehinderte mögen eine kontrastreiche Gestaltung von Räumen. Mancher Autist mag sich aber von kontrastierenden Elementen so stark gestört fühlen, dass er nicht arbeiten kann. Sehbehinderte und Blinde mögen Hindernisse wie Bürgersteige, weil sie sich daran orientieren können. Für einen Rollstuhlfahrer hingegen kann eine Bürgersteigkante eine unüberwindbare Hürde sein.
Manche Aspekte der Barrierefreiheit sind schnell umgesetzt. Sie legen Leitlinien fest, wie Sie Ihre Texte gestalten wollen. Ihre Mitarbeiter setzen das im besten Fall sofort um. Das war es.
Doch es gibt auch Projekte, die Jahre oder Jahrzehnte dauern können. Ein Gebäude barrierefrei zu gestalten, während der Betrieb weiterläuft, ist eine große Herausforderung. Zudem kann das sehr viel Geld kosten. Deshalb werden aufwendigere Maßnahmen oft über mehrere Jahre hinweg verteilt durchgeführt.
Unabhängig davon, wie lange eine Maßnahme dauert, sollten Sie Barrierefreiheit nicht als Zustand, sondern als Prozess verstehen. Websites, Gebäude, Technologien und die Sprache entwickeln sich immer weiter. Ansprüche ändern sich, es kommen vielleicht neue hinzu und einige alte verschwinden.
Ein universelles Verständnis von Barrierefreiheit
Es hat sich im Diskurs über Barrierefreiheit etabliert, sich relativ stark auf Normen und Regelwerke zu beziehen. Diese Regeln sind zweifellos sinnvoll und haben die Arbeit an Projekten auch stark vereinfacht. Sie müssen keine eigenen Kriterien entwickeln, sondern können einfach nachschlagen, was in den Regelwerken steht und sich buchstabengetreu daranhalten.
Das Ergebnis sind aber häufig unübersichtliche Websites, unattraktive Gebäude und auch Systeme ohne echten Mehrwert für behinderte Menschen. Wegen solcher Projekte steht die Barrierefreiheit im Ruf, unattraktiv zu sein. Zweifellos sind diese Regeln sinnvoll und man sollte nur ausnahmsweise davon abweichen. Andererseits geht es bei der Barrierefreiheit um Menschen. Und wenn diese Menschen und ihre Anforderungen in diesem Prozess nicht berücksichtigt werden, können nur halb gare Lösungen entstehen.
Ich sage gerne: Barrierefreiheit ist die größtmögliche Benutzbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die größtmögliche Zahl an Menschen. Das heißt, wie barrierefrei etwas ist, wird am konkreten Menschen und seinen Bedürfnissen gemessen und nicht an Richtlinien und Normen.
Es besteht natürlich die Gefahr, dass der Begriff Barrierefreiheit bei einer zu breiten Definition beliebig wird. Jede Einzelmaßnahme, wie das Anbringen von Rollläden, könnte als Maßnahme der Barrierefreiheit angepriesen werden.
Auf der anderen Seite lässt sich Barrierefreiheit nur schwer definieren, wenn es keine Person gibt, der sie zugutekommt. Zudem hat sich ein Standardset an Voraussetzungen etabliert. Unterhalb dieses Standards kann in keinem Fall von allgemeiner Barrierefreiheit gesprochen werden. Ein Café mit Treppenstufen am Eingang wird sich kaum als barrierefrei bezeichnen können. Das gilt auch, wenn es gut rollstuhlzugängliche Toiletten hat. Diese Standards gelten für bestimmte Bereiche. Zum Beispiel gibt es die WCAG 2.0 für das Internet oder die DIN 18040 für Gebäude. Sind diese Standards nicht zumindest zu einem gewissen Grade erfüllt, können Sie nicht von allgemeiner Barrierefreiheit sprechen.
Auch in der internen und externen Kommunikation sollten Sie den Begriff Barrierefreiheit nur mit Bedacht einsetzen. Eine vollständige Barrierefreiheit ist nicht möglich.
Haben Sie zum Beispiel alle Ihre Textinhalte für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt, können Sie von einem hohen Grad an Barrierefreiheit für Gehörlose sprechen, nicht jedoch von allgemeiner Barrierefreiheit, denn der Blinde profitiert nicht direkt von Videos in Gebärdensprache. Um die Sache weiter zu verkomplizieren: Auch ein Gehörloser versteht nicht unbedingt die Gebärdensprache. Wenn er gehörlos zur Welt kam, hat er wahrscheinlich die Gebärdensprache gelernt. Ist er jedoch im reiferen Alter ertaubt, hat er die Gebärdensprache vielleicht gar nicht oder nur eingeschränkt gelernt.
Falls Sie also die Barrierefreiheit für eine bestimmte Gruppe umsetzen, etwa für Schwerhörige oder Sehbehinderte, können Sie sagen, Ihr Angebot ist für diese bestimmte Gruppe relativ barrierefrei. Von allgemeiner Barrierefreiheit kann aber keine Rede sein. Dieser Fehler wird leider auch von Experten der Barrierefreiheit gemacht. Ich schreibe das nicht, um Ihnen den Wind aus den Segeln zu neh...
Inhaltsverzeichnis
- Widmung
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Behinderung und Barrierefreiheit
- Teil II: Vorbereitende Maßnahmen
- Teil III: Kompetenz finden und aufbauen
- Teil IV: Projektsteuerung
- Teil V: Nach dem Projekt
- Zum Schluss
- Zum Weiterlesen
- Impressum